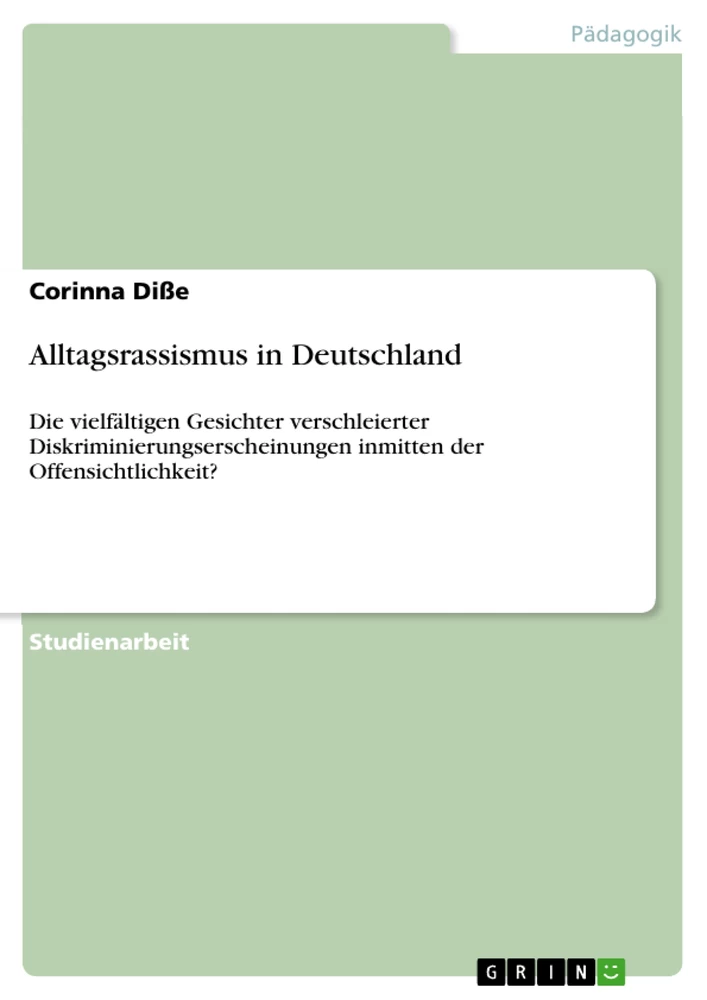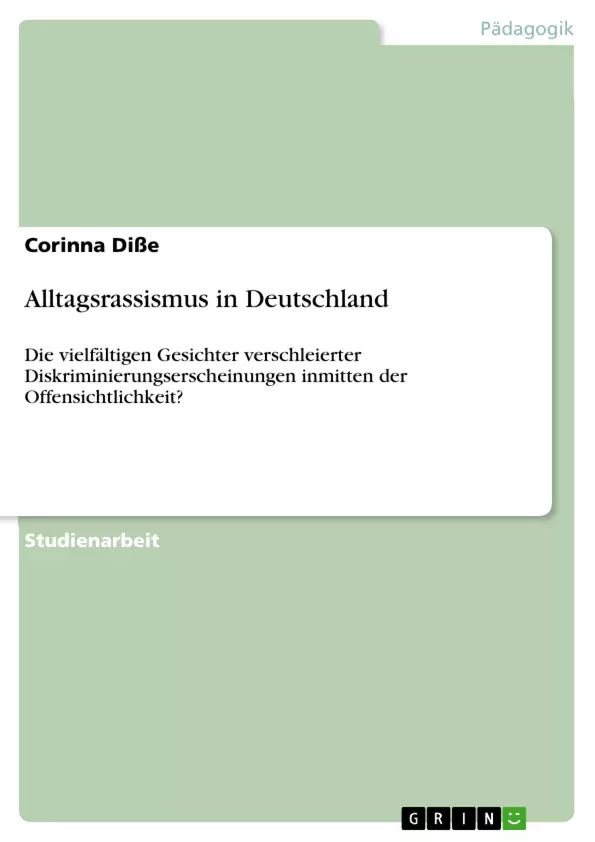Im Kontext der Rassismusforschung und kritischen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen wird dem Alltagsrassismus oftmals eine gesellschaftliche „Verharmlosung“ angelastet, während rechtsextremistische Denk- und Handlungsweisen als „verschleiert“ angesehen werden. Rassismus erfährt sozusagen einen Normalitätscharakter und dies auf unterschiedlichen Ebenen.
Aufgrund dieser Thesen soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Forschungsfrage beantwortet werden, in welchen möglichen Ursachen die Schwierigkeiten gesehen werden können, das Phänomen des Alltagsrassismus in Deutschland zu erkennen und worin folglich eventuelle Herausforderungen liegen könnten, dem Alltagsrassismus langfristig und effektiv entgegenzuwirken.
Um diese Frage zu klären, wird zunächst der Begriff des Alltagsrassismus in seinen Charakteristika erklärt. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung der Mehrdimensionalität dieser Begrifflichkeit anhand einer Auswahl einiger Alltagsbeispiele, in denen Diskriminierungserscheinungen zu beobachten sind unter Berücksichtigung der psychologischen Denkmuster, durch die Alltagsrassismus (re-)produziert wird. Daraufhin wird erläutert, worin der Zusammenhang bzw. die Schwierigkeiten zwischen der Aufdeckung, der Eliminierung und der Reproduktion des Alltagsrassismus gesehen werden können. Das darauffolgende Kapitel thematisiert mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Eliminierung des Alltagsrassismus mit Blick auf politische und pädagogische Maßnahmen. Im Anschluss werden diese Ansätze im Hinblick auf ihre möglichen Grenzen der praktischen Umsetzung kritisch reflektiert. Zur Abrundung dieser Arbeit erfolgt ein Fazit, das die Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst und die Forschungsfrage schlussendlich beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alltagsrassismus
- 2.1. Charakteristika
- 2.2. Ein Begriff, viele Dimensionen – Fremdenfeindliche Normalität in unterschiedlichen Kontexten des Alltags
- 2.3. Der Spagat zwischen Aufdeckung, Eliminierung und subtiler Reproduktion des Alltagsrassismus
- 2.4. Psychologische Denkmuster – Das vertraute Wir und der fremde Andere
- 3. Mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Eliminierung des Alltagsrassismus
- 3.1. Politische und pädagogische Maßnahmen
- 3.2. Herausforderungen und Grenzen der praktischen Umsetzung
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schwierigkeiten, Alltagsrassismus in Deutschland zu erkennen und effektiv entgegenzuwirken. Die Forschungsfrage fokussiert auf die Ursachen dieser Schwierigkeiten und möglichen Herausforderungen bei der langfristigen Bekämpfung des Phänomens.
- Charakteristika von Alltagsrassismus und seine Definition
- Manifestationen von Alltagsrassismus in verschiedenen Kontexten des Alltagslebens
- Der schwierige Zusammenhang zwischen Aufdeckung, Eliminierung und Reproduktion von Alltagsrassismus
- Mögliche präventive und interventive Maßnahmen
- Herausforderungen und Grenzen bei der praktischen Umsetzung von Maßnahmen gegen Alltagsrassismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Alltagsrassismus in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen der Schwierigkeiten bei der Erkennung und Bekämpfung dieses Phänomens. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition und Charakteristika von Alltagsrassismus, seine Manifestationen im Alltag, den Zusammenhang zwischen Aufdeckung, Eliminierung und Reproduktion, sowie mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen und deren Grenzen umfasst. Die Einleitung betont die gesellschaftliche „Verharmlosung“ von Alltagsrassismus im Gegensatz zu offen rechtsextremistischen Handlungen.
2. Alltagsrassismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Komplexität des Themas und beschränkt sich auf geisteswissenschaftliche Erkenntnisse. Es wird betont, dass biologische Konzepte von Rasse obsolet sind und Rassismus als soziale Praxis definiert wird, bei der körperliche Merkmale zur Klassifizierung von Bevölkerungsgruppen benutzt und instrumentalisiert werden, um soziale und politische Ungleichheiten zu rechtfertigen. Die Kapitel skizziert die Problematik der Kategorisierung von Menschen in „Wir“ und „die Anderen“ und die damit verbundene Stigmatisierung.
2.1. Charakteristika: Dieses Unterkapitel definiert Rassismus als soziale Praxis, die körperliche Merkmale zur Klassifizierung von Bevölkerungsgruppen missbraucht, um soziale, politische und ökonomische Ungleichheiten zu begründen. Es betont, dass Rassismus nicht die neutrale Beobachtung von Unterschieden ist, sondern deren Instrumentalisierung zur Schaffung hierarchischer Strukturen und der damit verbundenen Bevor- bzw. Benachteiligung bestimmter Gruppen.
2.2. Ein Begriff, viele Dimensionen – Fremdenfeindliche Normalität in unterschiedlichen Kontexten des Alltags: Dieses Kapitel illustriert anhand von Beispielen, wie Alltagsrassismus in verschiedenen Kontexten des Alltags auftritt. Es wird das „Messen mit zweierlei Maß“ thematisiert, wobei unterschiedliche Maßstäbe für die Beurteilung von Handlungen verschiedener Gruppen angewendet werden. Beispiele beinhalten die unterschiedliche öffentliche Reaktion auf Mordfälle mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund der Opfer.
Schlüsselwörter
Alltagsrassismus, Deutschland, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismusforschung, Prävention, Intervention, politische Maßnahmen, pädagogische Maßnahmen, psychologische Denkmuster, „Wir“ und „die Anderen“, gesellschaftliche Normalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Alltagsrassismus in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Erkennung und Bekämpfung von Alltagsrassismus in Deutschland. Sie fokussiert auf die Ursachen dieser Schwierigkeiten und mögliche Hürden bei der langfristigen Bekämpfung des Phänomens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakteristika von Alltagsrassismus, seine Manifestationen in verschiedenen Alltagssituationen, den komplexen Zusammenhang zwischen Aufdeckung, Eliminierung und Reproduktion von Alltagsrassismus, sowie mögliche präventive und interventive Maßnahmen und deren Grenzen. Ein besonderer Fokus liegt auf der gesellschaftlichen „Verharmlosung“ von Alltagsrassismus im Vergleich zu offen rechtsextremistischen Handlungen.
Wie wird Alltagsrassismus definiert?
Alltagsrassismus wird als soziale Praxis definiert, bei der körperliche Merkmale zur Klassifizierung von Bevölkerungsgruppen benutzt und instrumentalisiert werden, um soziale und politische Ungleichheiten zu rechtfertigen. Es ist nicht die neutrale Beobachtung von Unterschieden, sondern deren Instrumentalisierung zur Schaffung hierarchischer Strukturen und der damit verbundenen Bevor- bzw. Benachteiligung bestimmter Gruppen.
Wo manifestiert sich Alltagsrassismus?
Die Arbeit illustriert anhand von Beispielen, wie Alltagsrassismus in verschiedenen Kontexten des Alltags auftritt. Ein zentrales Thema ist das „Messen mit zweierlei Maß“, wobei unterschiedliche Maßstäbe für die Beurteilung von Handlungen verschiedener Gruppen angewendet werden. Beispiele beinhalten die unterschiedliche öffentliche Reaktion auf Mordfälle mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund der Opfer.
Welche Maßnahmen zur Prävention und Intervention werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert politische und pädagogische Maßnahmen zur Bekämpfung von Alltagsrassismus. Sie beleuchtet auch die Herausforderungen und Grenzen bei der praktischen Umsetzung dieser Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alltagsrassismus, Deutschland, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismusforschung, Prävention, Intervention, politische Maßnahmen, pädagogische Maßnahmen, psychologische Denkmuster, „Wir“ und „die Anderen“, gesellschaftliche Normalität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Alltagsrassismus (mit Unterkapiteln zu Charakteristika und Manifestationen im Alltag), ein Kapitel zu Präventions- und Interventionsmaßnahmen, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum ist es so schwierig, Alltagsrassismus in Deutschland zu erkennen und effektiv entgegenzuwirken?
- Quote paper
- Corinna Diße (Author), 2017, Alltagsrassismus in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416970