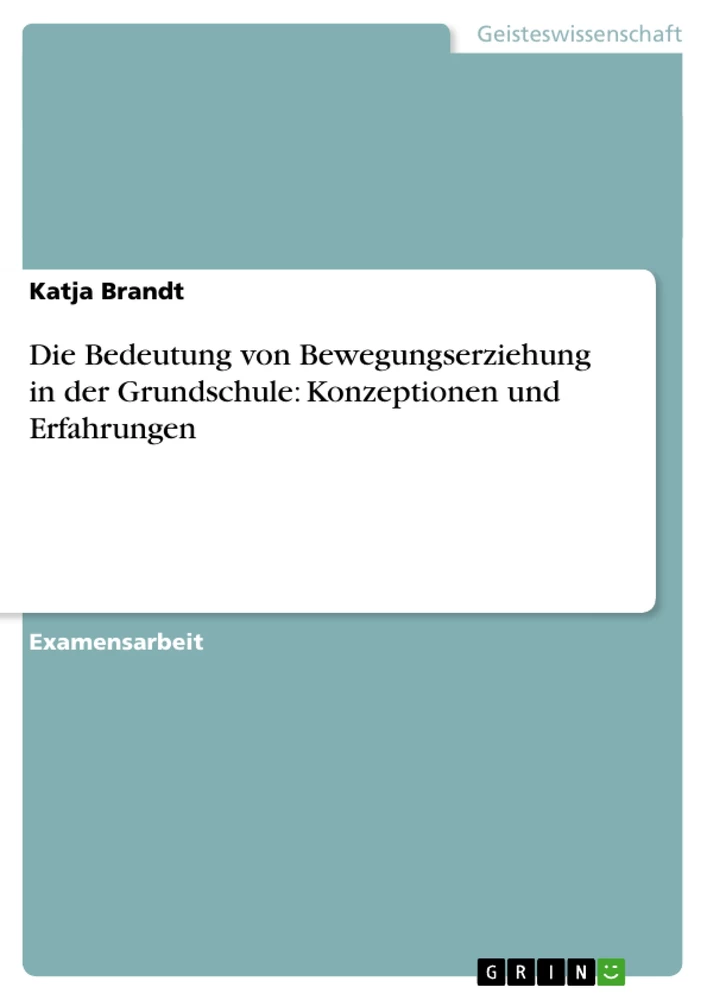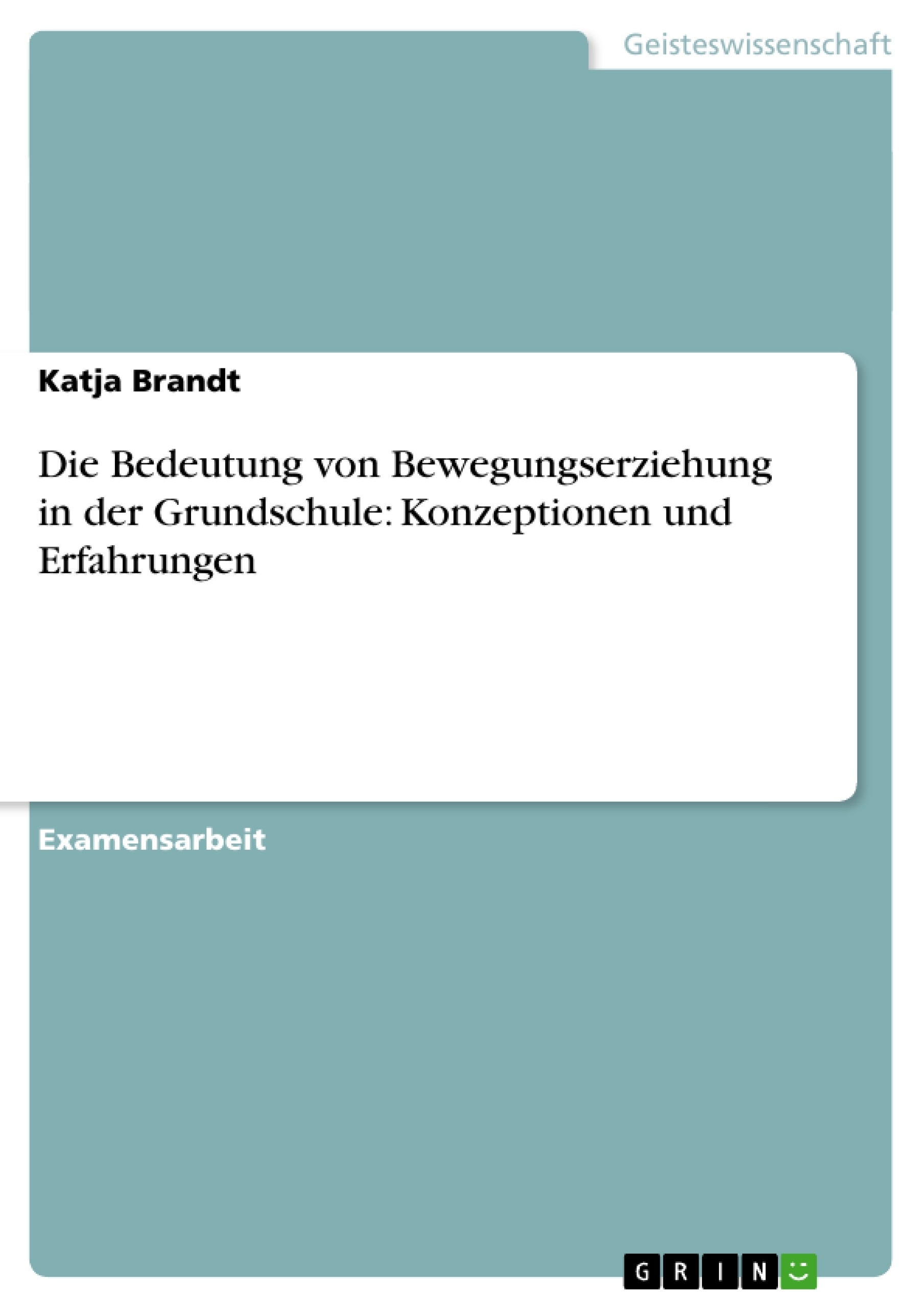Es kommt das ganze Kind – nicht nur der Kopf“
(Dr. Renate Zimmer)
Während meiner beiden Praktika an zwei Grundschulen im Rahmen des Studiums begegneten mir sehr häufig die Schlagworte „Bewegte Schule“, „Bewegtes Lernen“, „Veränderte Kindheit“. Da ich auch in meiner Freizeit regelmäßig mit dem Bewegungsverhalten von Vor- und Grundschulkindern in Berührung komme, ist mir schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass die Kinder über sehr unterschiedliche motorische Kompetenzen verfügen. Durch diese Erfahrungen habe ich angefangen, mich stärker mit dem Thema „Bewegungserziehung“ zu beschäftigen.
Bei vielen Erwachsenen ist immer noch die Vorstellung des „idealen“ Schülers präsent, der rezeptiv, aufmerksam und eher motorisch passiv dem kognitiv vermittelten Stoff zugewandt ist. Als eine Begründung für mehr Bewegung in der Schule kann man zunächst „das Anliegen der Gesundheitsförderung mit präventiven und kompensatorischen Aspekten, mit Maßnahmen der Verhältnis- und der Verhaltensprävention“ sehen.
„Im Mittelpunkt des Interesses und der Erwartungen von Eltern und Lehrern steht jedoch vielfach die Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit und des Schulerfolgs der Kinder“ . Bewegung trägt zu einem immerwährenden Wechsel von Dynamik und Statik bei. Einige empirische Studien (Breithecker 1998, Dordel 2000, Gröbert, Kleine & Podlich 2002, Kahl 1993, Müller 2000) weisen auf vielfältige positive Effekte von Bewegung auf Leistungsfähigkeit hin.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist auf die Klärung der folgenden Fragen gerichtet: Wie bekannt sind die einzelnen Konzeptionen der Bewegungserziehung? Wie werden diese im Unterrichtsalltag umgesetzt? Wie wirkt sich die Arbeit damit auf die Schüler aus?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Entwicklungspsychologische Grundlagen der Bewegungserziehung
- 2.1 Bestimmung des Bewegungsbegriffs
- 2.2 Entwicklung der Wahrnehmung
- 2.2.1 Entwicklung der taktilen Wahrnehmung
- 2.2.2 Entwicklung der visuellen Wahrnehmung
- 2.2.3 Entwicklung der auditiven Wahrnehmung
- 2.2.4 Entwicklung der vestibulären Wahrnehmung
- 2.2.5 Entwicklung der propriozeptiven Wahrnehmung
- 2.3 Bedeutung der Wahrnehmung
- 2.4 Sensorische Integration
- 2.5 Motorische Entwicklung
- 2.6 Sprache und Bewegung
- 2.7 Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung
- 2.8 Wie Kinder lernen
- 2.8.1 Bestimmung des Lernbegriffs
- 2.8.2 Lernen durch Konditionierung
- 2.8.3 Lernen am Modell - Lernen durch Beobachtung
- 2.8.4 Kognitives Lernen
- 2.8.5 Konsequenzen des Lernens für die Praxis der Bewegungserziehung
- 3 Konzeptionen der Bewegungserziehung
- 3.1 Klassenraum - Bewegungsraum
- 3.2 Bewegungpausen während des Unterrichts
- 3.3 Themenbezogenes Bewegen während des Unterrichts
- 3.4 Dynamisches Sitzen
- 3.4.1 Das Sitzdogma von gestern
- 3.4.2 Folgen von Sitzfehlverhalten
- 3.4.3 Dynamisches Sitzen
- 3.5 Stille im Unterricht
- 3.6 Sport- und Bewegungs Unterricht
- 3.7 Bewegungschance in den Pausen
- 3.8 Außerunterrichtliche Bewegungsangebote
- 4 Didaktische Prinzipien der Bewegungserziehung
- 5 Ziele der Bewegungserziehung
- 6 Empirische Untersuchung zu Konzeptionen und Erfahrungen der Bewegungserziehung in der Grundschule
- 6.1 Auswahl und Beschreibung der Grundschulen
- 6.1.1 Die Goetheschule in Großen-Buseck
- 6.1.2 Die Grundschule in Beuern
- 6.1.3 Die Kirschbergschule in Reiskirchen
- 6.2 Die Untersuchung
- 6.2.1 Methode
- 6.2.2 Durchführung
- 6.2.3 Auswertung
- 6.2.4 Die Fragestellung
- 6.1 Auswahl und Beschreibung der Grundschulen
- 7 Ergebnisse der Lehrerbefragung
- 7.1 Auswertung der Ergebnisse getrennt nach Schulen
- 7.1.1 Goetheschule Großen-Buseck
- 7.1.2 Grundschule Beuern
- 7.1.3 Kirschbergschule Reiskirchen
- 7.2 Auswertung der Ergebnisse schulübergreifend
- 7.1 Auswertung der Ergebnisse getrennt nach Schulen
- 8 Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Bewegungserziehung in der Grundschule. Ziel ist es, die Bekanntheit verschiedener Konzeptionen der Bewegungserziehung, deren Umsetzung im Unterricht und deren Auswirkungen auf die Schüler zu klären. Die Arbeit stützt sich auf eine empirische Untersuchung an mehreren Grundschulen.
- Entwicklungspsychologische Grundlagen der Bewegungserziehung
- Verschiedene Konzeptionen der Bewegungserziehung
- Didaktische Prinzipien der Bewegungserziehung
- Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Bewegungserziehung
- Diskussion der Ergebnisse im Kontext der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bewegungserziehung in der Grundschule ein und beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit basierend auf den Erfahrungen der Autorin während ihrer Praktika. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Bekanntheit, Umsetzung und Wirkung verschiedener Konzeptionen der Bewegungserziehung im Schulalltag und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Entwicklungspsychologische Grundlagen der Bewegungserziehung: Dieses Kapitel beleuchtet die entwicklungspsychologischen Grundlagen der Bewegungserziehung. Es behandelt die Entwicklung der Wahrnehmung (taktil, visuell, auditiv, vestibulär, propriozeptiv) und deren Bedeutung für die motorische Entwicklung. Die Rolle von Sprache und Spiel in der kindlichen Entwicklung sowie verschiedene Lerntheorien (Konditionierung, Lernen am Modell, kognitives Lernen) werden im Kontext der Bewegungserziehung diskutiert, um das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Bewegung, Wahrnehmung und Lernen zu vertiefen. Die Kapitel verbindet die verschiedenen Aspekte der kindlichen Entwicklung mit dem praktischen Aspekt der Bewegungserziehung.
3 Konzeptionen der Bewegungserziehung: Kapitel 3 präsentiert verschiedene Konzeptionen der Bewegungserziehung, wie z.B. den Einsatz des Klassenraums als Bewegungsraum, Bewegungpausen, themenbezogenes Bewegen im Unterricht und dynamisches Sitzen. Jedes Konzept wird kurz vorgestellt und mit konkreten Beispielen für den Schulalltag veranschaulicht. Das Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Ansätze und Methoden, die die Bewegung in den Unterricht integrieren.
4 Didaktische Prinzipien der Bewegungserziehung: In diesem Kapitel werden die didaktischen Prinzipien der Bewegungserziehung, wie Kindgemäßheit, Offenheit, Freiwilligkeit, Erlebnisorientierung, Sinnhaftigkeit, Entscheidungsfreiheit und Selbsttätigkeit, detailliert erläutert. Es werden die pädagogischen Überlegungen hinter diesen Prinzipien dargelegt und deren Bedeutung für eine erfolgreiche und kindgerechte Umsetzung der Bewegungserziehung hervorgehoben. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für die Gestaltung von Bewegungseinheiten und -angeboten.
5 Ziele der Bewegungserziehung: Kapitel 5 definiert die Ziele der Bewegungserziehung in der Grundschule. Es beschreibt die angestrebten Kompetenzen und Entwicklungen bei den Kindern im Bereich der Motorik, der Wahrnehmung, des Sozialverhaltens und des Lernens. Die Ziele werden im Kontext der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes erläutert, und die Bedeutung von Bewegung für das Lernen und Wohlbefinden wird hervorgehoben. Die Ziele bilden die Basis für die Planung und Evaluation von Bewegungserziehungsmaßnahmen.
6 Empirische Untersuchung zu Konzeptionen und Erfahrungen der Bewegungserziehung in der Grundschule: Kapitel 6 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die durchgeführt wurde um die Forschungsfragen zu beantworten. Es erläutert die Auswahl der Schulen, die Methoden der Datenerhebung und -auswertung und stellt die Fragestellungen der Untersuchung dar. Das Kapitel bildet die Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln und gewährleistet die Nachvollziehbarkeit der Untersuchung.
7 Ergebnisse der Lehrerbefragung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Lehrerbefragung. Die Ergebnisse werden sowohl schul- als auch schulübergreifend ausgewertet und in detaillierten Tabellen und Grafiken dargestellt. Die Ergebnisse werden in verschiedenen Zusammenhängen betrachtet und bilden die empirische Basis für die anschließende Diskussion.
Schlüsselwörter
Bewegungserziehung, Grundschule, motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Konzeptionen, empirische Untersuchung, Lehrerbefragung, didaktische Prinzipien, Lernen, Spiel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bewegungserziehung in der Grundschule
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bewegungserziehung in der Grundschule. Sie umfasst eine Literaturrecherche zu den entwicklungspsychologischen Grundlagen, verschiedenen Konzeptionen und didaktischen Prinzipien der Bewegungserziehung. Der Kern der Arbeit besteht in einer empirischen Untersuchung an drei Grundschulen, die die Bekanntheit, Umsetzung und Wirkung verschiedener Konzeptionen in der Praxis beleuchtet. Die Ergebnisse der Lehrerbefragung werden detailliert analysiert und diskutiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Entwicklungspsychologische Grundlagen der Bewegungserziehung (Wahrnehmung, motorische Entwicklung, Lernen), verschiedene Konzeptionen der Bewegungserziehung (Bewegungsraum, Bewegungpausen, dynamisches Sitzen etc.), didaktische Prinzipien der Bewegungserziehung, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung an drei Grundschulen (Methoden, Ergebnisse, Diskussion), und die Ziele der Bewegungserziehung in der Grundschule.
Welche Methode wurde in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einer Lehrerbefragung an drei ausgewählten Grundschulen (Goetheschule Großen-Buseck, Grundschule Beuern, Kirschbergschule Reiskirchen). Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik, einschließlich der Datenerhebung und -auswertung.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die Ergebnisse der Lehrerbefragung werden sowohl schul- als auch schulübergreifend ausgewertet und in Tabellen und Grafiken dargestellt. Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse und diskutiert diese im Kontext der Praxis der Bewegungserziehung.
Welche Ziele verfolgt die Bewegungserziehung in der Grundschule laut dieser Arbeit?
Die Arbeit definiert die Ziele der Bewegungserziehung als die Förderung der motorischen Entwicklung, der Wahrnehmung, des Sozialverhaltens und des Lernens bei Kindern. Bewegung wird als wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes betrachtet.
Welche didaktischen Prinzipien werden in der Arbeit hervorgehoben?
Die Arbeit erläutert wichtige didaktische Prinzipien der Bewegungserziehung, wie Kindgemäßheit, Offenheit, Freiwilligkeit, Erlebnisorientierung, Sinnhaftigkeit, Entscheidungsfreiheit und Selbsttätigkeit. Diese Prinzipien sollen eine erfolgreiche und kindgerechte Umsetzung der Bewegungserziehung gewährleisten.
Welche Konzeptionen der Bewegungserziehung werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Konzeptionen vor, darunter den Einsatz des Klassenraums als Bewegungsraum, Bewegungpausen, themenbezogenes Bewegen im Unterricht und dynamisches Sitzen. Konkrete Beispiele für den Schulalltag veranschaulichen die Anwendung dieser Konzeptionen.
Welche entwicklungspsychologischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Wahrnehmung (taktil, visuell, auditiv, vestibulär, propriozeptiv) und deren Bedeutung für die motorische Entwicklung. Die Rolle von Sprache und Spiel sowie verschiedene Lerntheorien (Konditionierung, Lernen am Modell, kognitives Lernen) werden im Kontext der Bewegungserziehung diskutiert.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse prägnant darstellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewegungserziehung, Grundschule, motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Konzeptionen, empirische Untersuchung, Lehrerbefragung, didaktische Prinzipien, Lernen, Spiel.
- Quote paper
- Katja Brandt (Author), 2005, Die Bedeutung von Bewegungserziehung in der Grundschule: Konzeptionen und Erfahrungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41690