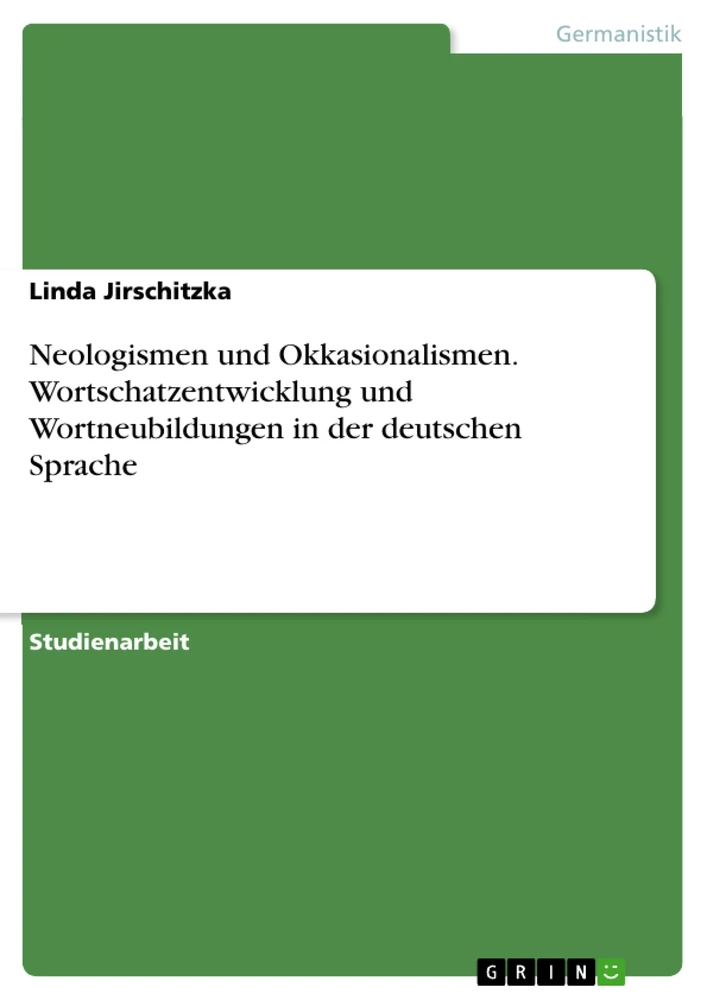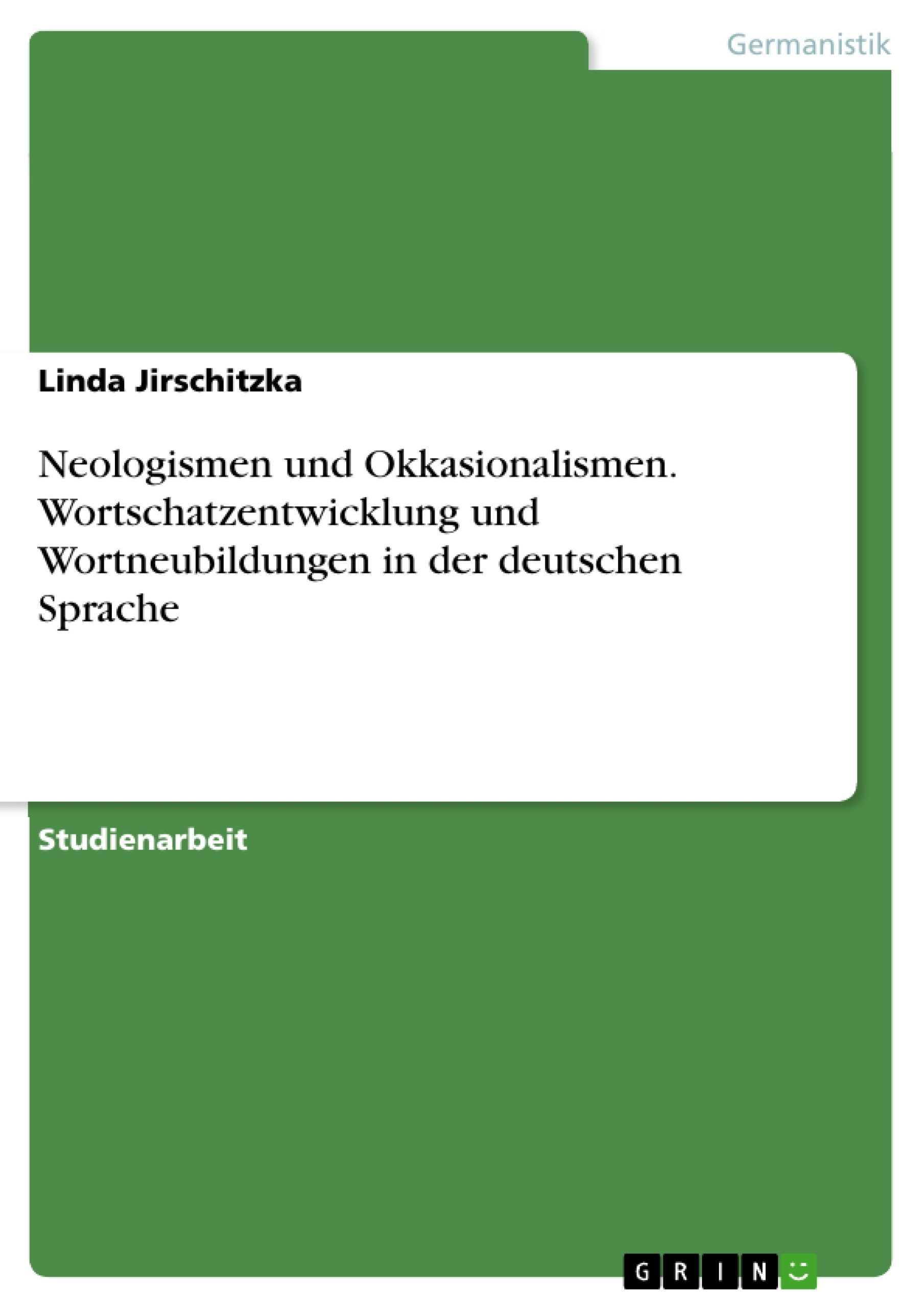Jeden Tag begegnen wir neuen Wörtern, sei es in der Werbung, im Fernsehen oder im Radio, in Zeitungsartikeln oder gar in der Literatur. Aber auch in der alltäglichen Kommunikation kommt es tagtäglich zu Wortneubildungen. Einerseits wird hierbei versucht, kommunikative Bedürfnisse abzudecken und so andererseits sprachliche Lücken auszugleichen, für die es bisher keine, beziehungsweise nur unpassende Ausdrücke gab.
Veggie, whatsappen oder Hipsterbart sind nur wenige Beispiele für solch neu entstandene Wörter. Derartige Begriffe weisen darauf hin, dass Sprache keineswegs eine statische Größe ist. Vielmehr unterliegt sie einem ständigen Wandel, wobei sich der Wortschatz mit dem Leben der Menschen verändert. Diese Veränderung ist geprägt durch ein ständiges Aufkommen und Verschwinden von Wörtern. Die deutsche Sprache ist demnach eine lebendige Sprache, bei der es jeden Tag zu Wortschatzerweiterungen beziehungsweise zum Wortschatzwandel kommt.
Wurde diesen neu entstandenen Wörtern früher keine Beachtung geschenkt, so sind sie in der gegenwärtigen Linguistikforschung nun ein fester Bestandteil. In diesem Zusammenhang haben sich zwei wesentliche Termini für diese Phänomene herausgebildet: Neologismen und Okkasionalismen. Die Grenzen dieser beiden Ausdrücke sind dabei verschwommen, weswegen sich für beide oft keine einheitliche und präzise Definition finden lässt.
Diese Arbeit soll einen Überblick über die beiden Begriffe bieten. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Einführung in die Wortbildung des Deutschen, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung des Neologismus und des Okkasionalismus leistet sowie ein abrundendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Neologismus und Okkasionalismus
- 2.1 Neologismen
- 2.1.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Unterteilung von Neologismen
- 2.1.3 Neologismenlexikographie in Deutschland
- 2.2 Sonderstellung: Okkasionalismen
- 2.2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2.2 Funktionen von Okkasionalismen
- 2.3 Abgrenzung der beiden Begriffe
- 3. Ursachen der Entstehung neuer Wörter - die Wortbildung
- 3.1 Komposition
- 3.2 Derivation
- 3.3 Konversion
- 3.4 Kurzwortbildung
- 3.5 Weitere Wortbildungsarten
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die Begriffe Neologismus und Okkasionalismus zu geben. Sie klärt die Entstehung neuer Wörter im Deutschen und deren Funktionen. Die Arbeit beleuchtet die schwierige Abgrenzung der beiden Begriffe und untersucht die Wortbildungsprozesse, die zur Entstehung von Neologismen und Okkasionalismen beitragen.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Neologismen und Okkasionalismen
- Untersuchung der Entstehung neuer Wörter im Deutschen
- Analyse der Funktionen von Neologismen und Okkasionalismen
- Beschreibung der verschiedenen Wortbildungsarten
- Historischer Überblick über die Neologismenlexikographie in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wortneuschöpfungen im Deutschen ein und hebt die Bedeutung von Neologismen und Okkasionalismen in der gegenwärtigen Linguistik hervor. Sie verweist auf die ständige Veränderung der Sprache und den damit verbundenen Wortschatzwandel, wobei die schwammige Abgrenzung zwischen Neologismen und Okkasionalismen als zentrale Herausforderung für die Arbeit benannt wird. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die einzelnen Kapitel, die sich mit der Definition, der Unterteilung, der Funktionen und der Wortbildung im Zusammenhang mit diesen Phänomenen befassen.
2. Neologismus und Okkasionalismus: Dieses Kapitel bietet eine umfassende theoretische Darstellung der beiden Begriffe. Es beginnt mit einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem Begriff "Neologismus," inklusive unterschiedlicher Definitionen aus der Fachliteratur und einem historischen Überblick über die Neologismenlexikographie in Deutschland. Die verschiedenen Kriterien zur Bestimmung eines Neologismus werden diskutiert, unter anderem die Aspekte der Usualisierung, Akzeptierung und Lexikalisierung. Anschließend wird der Begriff "Okkasionalismus" eingehend behandelt, wobei die Funktionsweise und der Unterschied zu Neologismen herausgearbeitet werden. Die Abgrenzung der beiden Begriffe bildet den Abschluss des Kapitels, und verdeutlicht die wesentlichen Unterschiede.
3. Ursachen der Entstehung neuer Wörter - die Wortbildung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Wortbildung im Deutschen und deren Beitrag zur Entstehung von Neologismen und Okkasionalismen. Es untersucht verschiedene Wortbildungsarten wie Komposition, Derivation, Konversion und Kurzwortbildung und erklärt, wie diese Prozesse zur Neubildung von Wörtern führen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der Mechanismen und der Illustration mit Beispielen, wie neue Wörter durch Kombination bestehender Wortteile oder durch semantische Verschiebungen entstehen.
Schlüsselwörter
Neologismen, Okkasionalismen, Wortbildung, Wortneuschöpfung, Sprachwandel, Lexikographie, Deutsches Wörterbuch, Kommunikation, Wortsemantik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Neologismen und Okkasionalismen im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Neologismen und Okkasionalismen im Deutschen. Sie untersucht die Entstehung neuer Wörter, ihre Funktionen und die schwierige Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen. Die Arbeit beleuchtet zudem die verschiedenen Wortbildungsprozesse, die zur Entstehung dieser Wortarten beitragen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Neologismen und Okkasionalismen, die Entstehung neuer Wörter im Deutschen, die Funktionen von Neologismen und Okkasionalismen, verschiedene Wortbildungsarten (Komposition, Derivation, Konversion, Kurzwortbildung etc.) und einen historischen Überblick über die Neologismenlexikographie in Deutschland.
Was sind Neologismen?
Die Arbeit definiert und erläutert den Begriff "Neologismus" detailliert, inklusive verschiedener Definitionen aus der Fachliteratur und Kriterien zur Bestimmung eines Neologismus (Usualisierung, Akzeptierung, Lexikalisierung).
Was sind Okkasionalismen?
Der Begriff "Okkasionalismus" wird eingehend behandelt, mit Fokus auf die Funktionsweise und den Unterschied zu Neologismen. Die Arbeit verdeutlicht die wesentlichen Unterschiede zwischen Neologismen und Okkasionalismen.
Wie werden neue Wörter gebildet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Wortbildungsarten im Deutschen (Komposition, Derivation, Konversion, Kurzwortbildung etc.) und erklärt, wie diese Prozesse zur Neubildung von Wörtern führen. Beispiele illustrieren die Mechanismen der Wortbildung.
Welche Wortbildungsarten werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wortbildungsarten Komposition, Derivation, Konversion und Kurzwortbildung, sowie weitere Arten der Wortbildung.
Gibt es einen historischen Überblick?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen historischen Überblick über die Neologismenlexikographie in Deutschland.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Neologismus und Okkasionalismus (mit Unterkapiteln zu Begriffsbestimmung, Unterteilung, Funktionen und Abgrenzung), den Ursachen der Entstehung neuer Wörter (Wortbildung), einem Fazit und einem Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Neologismen, Okkasionalismen, Wortbildung, Wortneuschöpfung, Sprachwandel, Lexikographie, Deutsches Wörterbuch, Kommunikation, Wortsemantik.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die Arbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen für jedes Kapitel, welche die Inhalte und Schwerpunkte jedes Abschnitts beschreiben.
- Quote paper
- Linda Jirschitzka (Author), 2017, Neologismen und Okkasionalismen. Wortschatzentwicklung und Wortneubildungen in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416903