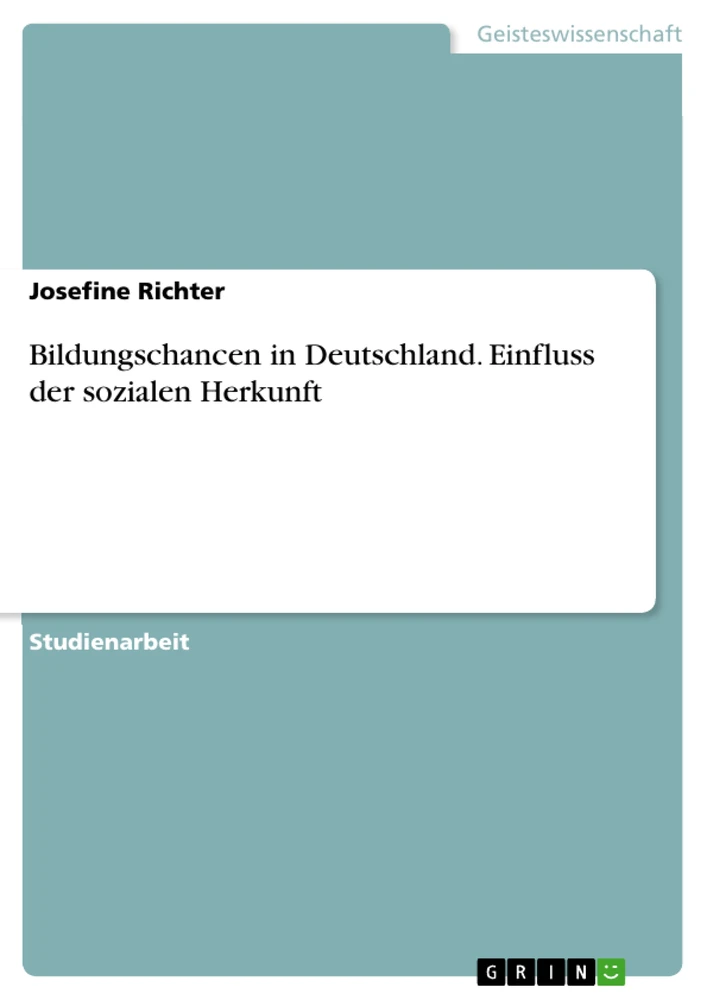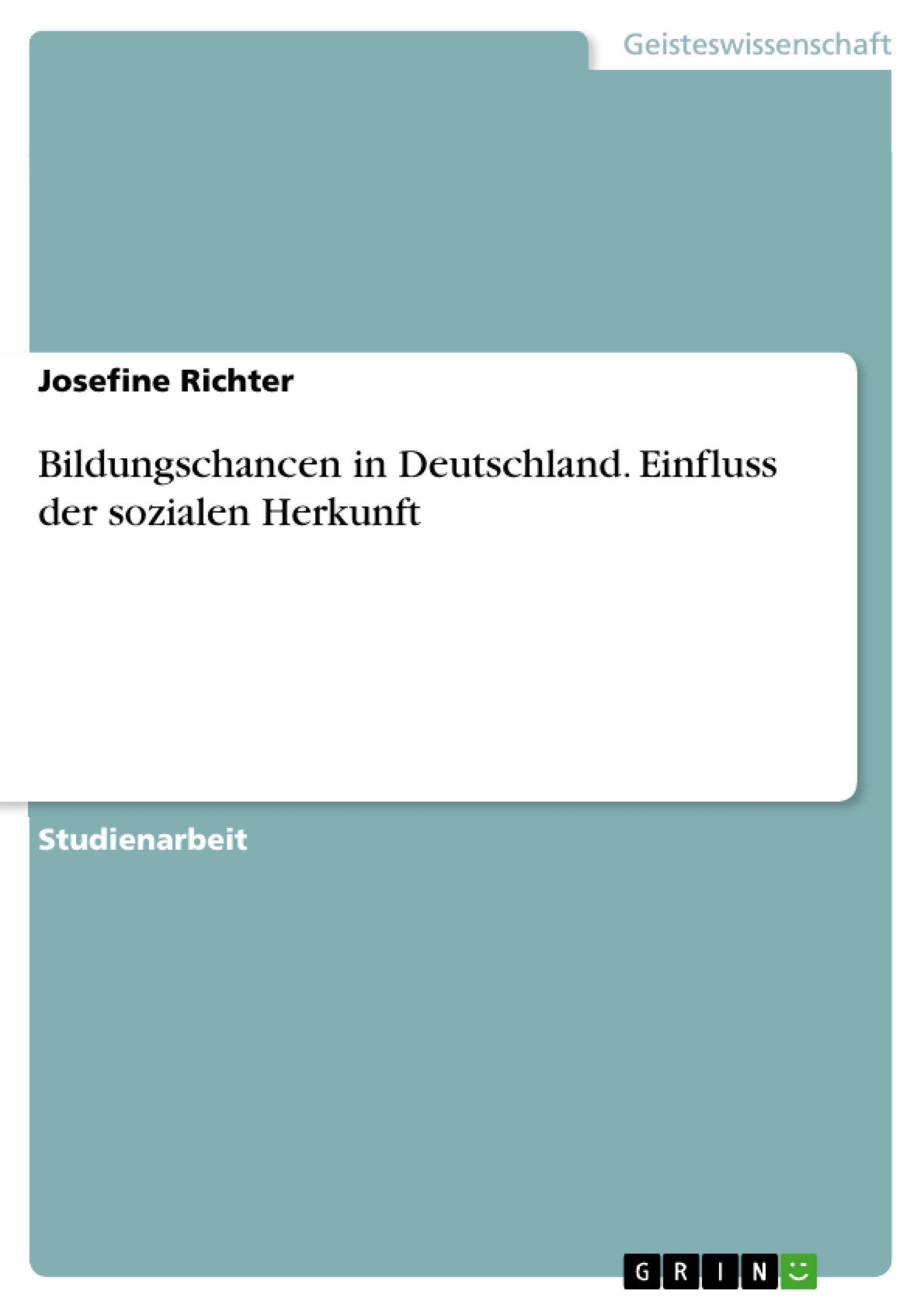Durch den Aufschrei und "Schock" der Bevölkerung nach der Veröffentlichung der PISA-Tests im Jahr 2001, wo ein weltweiter Vergleich von Schülern stattfindet, wurde das Interesse an den Lernleistungen der Schüler im Zusammenhang mit dem familiären und sozialen Umfeld der jungen Menschen geweckt.
Die Bildungsungleichheit begrenzt sich nicht nur auf die bestehende Bildungspolitik und den allgemeinen Bildungsweg, sondern auch auf die Bildungsmöglichkeiten aufgrund der sozialen Herkunft. In Deutschland wurde gegenüber den anderen Ländern der größte Zusammenhang zwischen den Testergebnissen und dem sozialen Kapital festgestellt. Ob die Ergebnisse vielleicht nur von der Tagesform der Kinder abhängig waren oder der Wirklichkeit entsprachen, wird durch die folgenden Ausführungen näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erörterung der relevanten Begriffe
- 2.1 Soziale Ungleichheit
- 2.2 Soziale Herkunft
- 2.3 Bildungsungleichheit
- 2.4 Klassen, Schichten, Stände
- 2.5 Milieus und Lebensstile
- 3 Ursachen sozialer Ungleichheit
- 4 Theorien sozialer Ungleichheit
- 4.1 Herkömmliche Ansätze sozialer Ungleichheit
- 4.1.1 Marxistische Theorie
- 4.1.2 Theorie des Soziologen Max Weber - Klassen, Stände und Parteien
- 4.1.3 Funktionalistische Theorie
- 4.1.4 Theorie nach Theodor Geiger - Das Schichtmodell
- 4.2 Neuere Ansätze sozialer Ungleichheit
- 4.2.1 Neuere marxistische Klassentheorien
- 4.2.2 Klassenschema nach Erikson, Goldthorpe und Portocarero (EGP)
- 4.2.3 Schichtmodell nach Geißler
- 4.1 Herkömmliche Ansätze sozialer Ungleichheit
- 5 Pierre Bourdieu – Die Reproduktion ungleicher Bildungschancen
- 5.1 Die Kapitalarten
- 5.1.1 Kulturelles Kapital
- 5.1.2 Ökonomisches Kapital
- 5.1.3 Soziales Kapital
- 5.1.4 Symbolisches Kapital
- 5.2 Der Habitus und der soziale Raum
- 5.1 Die Kapitalarten
- 6 Raymond Boudon – primäre und sekundäre Disparitäten
- 6.1 Primäre Herkunftseffekte
- 6.2 Sekundäre Herkunftseffekte
- 7 Kurzanalyse der PISA-Studie 2012
- 8 Übergang Schule - Hochschule
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungschancen in Deutschland. Ziel ist es, die komplexen Zusammenhänge zwischen sozioökonomischem Hintergrund und Bildungserfolg zu beleuchten und verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der bestehenden Ungleichheiten zu präsentieren.
- Definition und Erläuterung relevanter Begriffe wie soziale Ungleichheit, soziale Herkunft und Bildungsungleichheit.
- Analyse verschiedener Theorien sozialer Ungleichheit (marxistische, Weber'sche, funktionalistische Ansätze etc.).
- Darlegung des Konzepts des kulturellen Kapitals nach Pierre Bourdieu und dessen Bedeutung für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten.
- Untersuchung der primären und sekundären Herkunftseffekte nach Raymond Boudon.
- Auswertung der PISA-Studie 2012 im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Schülerleistung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und verweist auf den gesellschaftlichen Aufschrei nach den PISA-Schock Ergebnissen von 2001. Sie skizziert die Problematik der Bildungsungleichheit in Deutschland im Zusammenhang mit sozialer Herkunft und benennt den Forschungsfokus der Arbeit.
2 Erörterung der relevanten Begriffe: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie soziale Ungleichheit, soziale Herkunft und Bildungsungleichheit. Es wird der Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Lage des Elternhauses und den Bildungschancen der Kinder erläutert, wobei der Einfluss von Faktoren wie Einkommen, sozialer Anerkennung und Beruf der Eltern hervorgehoben wird. Die Bedeutung des sozialen Kapitals nach Bourdieu wird angerissen.
3 Ursachen sozialer Ungleichheit: Kapitel 3 befasst sich mit den Ursachen sozialer Ungleichheit, indem es verschiedene soziale Positionen von Individuen differenziert. Es wird auf die komplexen Zusammenhänge und Faktoren hingewiesen, die zu ungleicher Verteilung von Ressourcen und Chancen führen.
4 Theorien sozialer Ungleichheit: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Theorien sozialer Ungleichheit, sowohl herkömmliche (marxistische, Weber'sche, funktionalistische, Geigers Schichtmodell) als auch neuere Ansätze. Es werden unterschiedliche Perspektiven und Erklärungsmodelle für die Entstehung und Persistenz sozialer Ungleichheit vorgestellt und verglichen. Die Kapitel 4.1 und 4.2 beschäftigen sich mit klassischen und modernen Ansätzen zur Erklärung sozialer Ungleichheit. Dargestellt werden die marxistische Theorie, Webers Theorie von Klassen, Ständen und Parteien, sowie die funktionalistische und die Theorie nach Theodor Geiger (Schichtmodell). Des Weiteren werden neuere Ansätze wie die neuere marxistische Klassentheorie, das Klassenschema nach Erikson, Goldthorpe und Portocarero (EGP) und das Schichtmodell nach Geißler behandelt.
5 Pierre Bourdieu – Die Reproduktion ungleicher Bildungschancen: Dieses Kapitel erläutert die Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) nach Pierre Bourdieu und deren Einfluss auf die Bildungschancen. Es wird die Bedeutung des Habitus und des sozialen Raums für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten dargestellt. Die Interaktion zwischen den Kapitalarten und ihren Auswirkungen auf den Bildungserfolg steht im Mittelpunkt.
6 Raymond Boudon – primäre und sekundäre Disparitäten: In diesem Kapitel werden die primären und sekundären Herkunftseffekte nach Raymond Boudon erklärt. Es wird der Unterschied zwischen den Effekten, die bereits in der frühen Bildungsphase wirksam sind (primär), und denen, die im Laufe des Bildungsverlaufs entstehen (sekundär), aufgezeigt und analysiert.
7 Kurzanalyse der PISA-Studie 2012: Kapitel 7 analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie 2012, um den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund und der Schülerleistung zu beleuchten. Es werden die Daten im Hinblick auf die bestehenden Bildungsungleichheiten ausgewertet und interpretiert.
8 Übergang Schule - Hochschule: Dieses Kapitel analysiert die Bildungsungleichheiten, die beim Übergang von der Schule zur Hochschule bestehen, unter Berücksichtigung von sozialer Herkunft, den primären und sekundären Herkunftseffekten sowie dem kulturellen Kapital nach Bourdieu.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Sozialer Einfluss auf Bildungschancen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungschancen in Deutschland. Sie beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen sozioökonomischem Hintergrund und Bildungserfolg und präsentiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der bestehenden Ungleichheiten.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert und erläutert?
Die Arbeit definiert und erläutert zentrale Begriffe wie soziale Ungleichheit, soziale Herkunft und Bildungsungleichheit. Der Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Lage des Elternhauses und den Bildungschancen der Kinder wird detailliert dargestellt, inklusive des Einflusses von Faktoren wie Einkommen, sozialer Anerkennung und Beruf der Eltern. Die Bedeutung des sozialen Kapitals nach Bourdieu wird ebenfalls behandelt.
Welche Theorien sozialer Ungleichheit werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Theorien sozialer Ungleichheit, sowohl herkömmliche (marxistische, Weber'sche, funktionalistische, Geigers Schichtmodell) als auch neuere Ansätze. Es werden unterschiedliche Perspektiven und Erklärungsmodelle für die Entstehung und Persistenz sozialer Ungleichheit vorgestellt und verglichen. Konkret werden die marxistische Theorie, Webers Theorie von Klassen, Ständen und Parteien, die funktionalistische Theorie, das Schichtmodell nach Theodor Geiger, neuere marxistische Klassentheorien, das Klassenschema nach Erikson, Goldthorpe und Portocarero (EGP) und das Schichtmodell nach Geißler behandelt.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieu in der Arbeit?
Die Arbeit erläutert die Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) nach Pierre Bourdieu und deren Einfluss auf die Bildungschancen. Die Bedeutung des Habitus und des sozialen Raums für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten wird dargestellt. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen den Kapitalarten und ihren Auswirkungen auf den Bildungserfolg.
Was sind primäre und sekundäre Herkunftseffekte nach Raymond Boudon?
Die Arbeit erklärt die primären und sekundären Herkunftseffekte nach Raymond Boudon. Der Unterschied zwischen den Effekten, die bereits in der frühen Bildungsphase wirksam sind (primär), und denen, die im Laufe des Bildungsverlaufs entstehen (sekundär), wird aufgezeigt und analysiert.
Wie wird die PISA-Studie 2012 in die Arbeit eingebunden?
Die Arbeit analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie 2012, um den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund und der Schülerleistung zu beleuchten. Die Daten werden im Hinblick auf die bestehenden Bildungsungleichheiten ausgewertet und interpretiert.
Wie wird der Übergang Schule-Hochschule behandelt?
Die Arbeit analysiert die Bildungsungleichheiten beim Übergang von der Schule zur Hochschule unter Berücksichtigung sozialer Herkunft, der primären und sekundären Herkunftseffekte sowie des kulturellen Kapitals nach Bourdieu.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst die folgenden Kapitel: Einleitung, Erörterung relevanter Begriffe, Ursachen sozialer Ungleichheit, Theorien sozialer Ungleichheit, Pierre Bourdieu – Die Reproduktion ungleicher Bildungschancen, Raymond Boudon – primäre und sekundäre Disparitäten, Kurzanalyse der PISA-Studie 2012, Übergang Schule - Hochschule und Fazit. Jedes Kapitel behandelt die entsprechenden Themen im Detail, wie in der Zusammenfassung der Kapitel im ursprünglichen Dokument beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, den komplexen Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund und Bildungserfolg zu beleuchten und verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der bestehenden Ungleichheiten zu präsentieren.
- Quote paper
- Josefine Richter (Author), 2016, Bildungschancen in Deutschland. Einfluss der sozialen Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416689