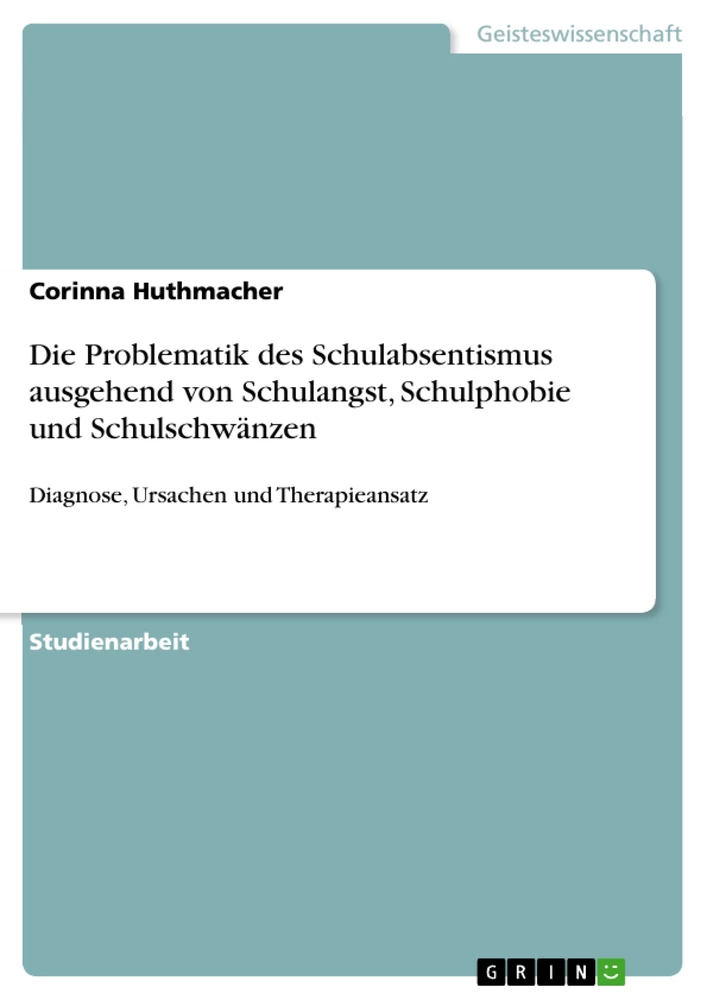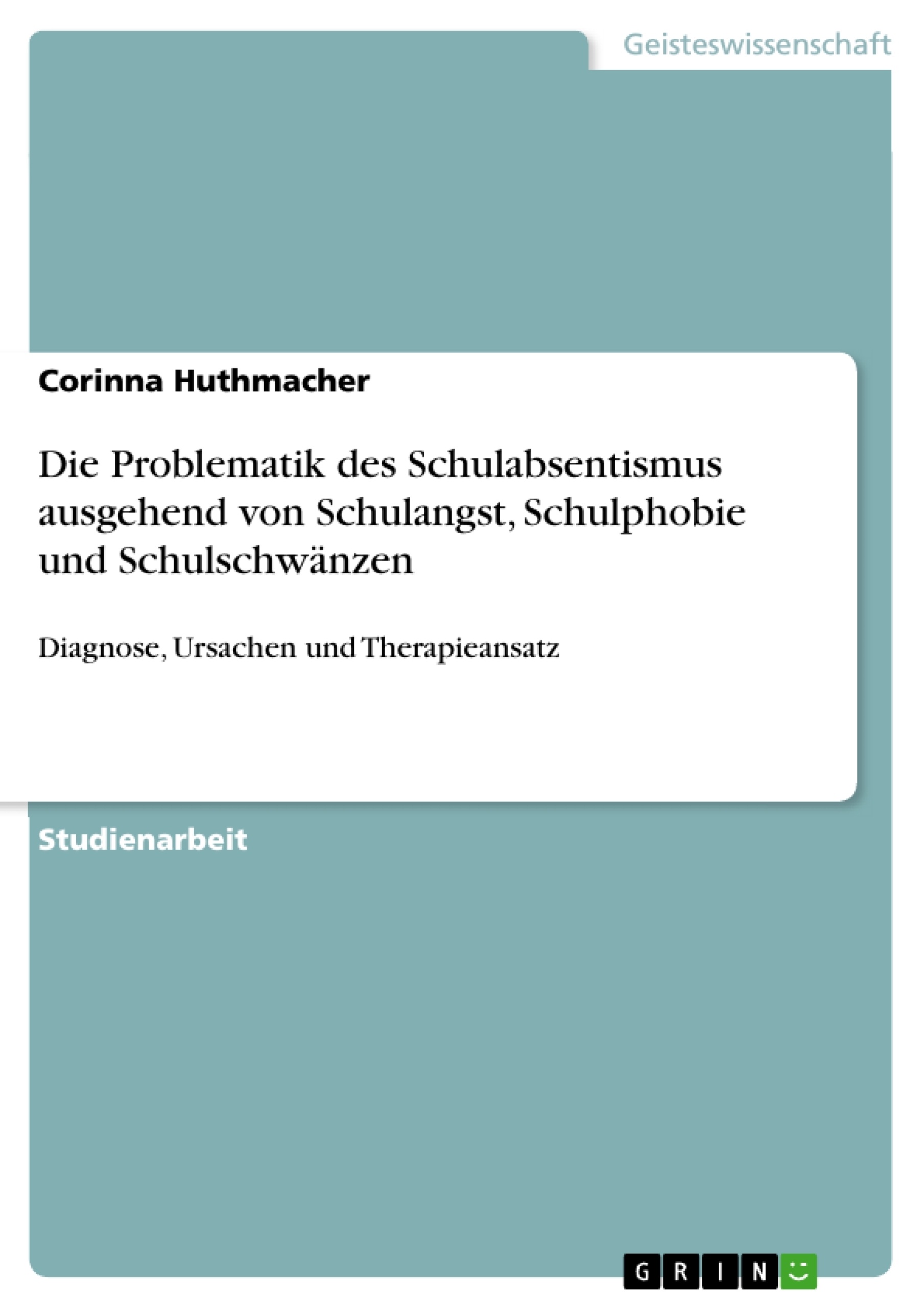In Deutschland gibt es ca. 12 Millionen Schüler und ca. 600.000 bis 1,2 Millionen, die unter Schulabsentismus leiden. Dennoch befasste sich die Wissenschaft erst Ende der Neunziger des 20. Jahrhunderts mit dieser Problematik. Mit Ricking fand die Thematik 1997 Einzug in die deutschsprachige Literatur. Seit 1919 gibt es in Deutschland die Schulpflicht, wird sie verletzt, kann dies als Ordnungswidrigkeit registriert werden. Gerade die Schule hat verschiedene Rollen, sie ist Lehr- und Lerninstitution, Sozialisierungsinstrument und Basis für den
späteren Beruf. Was muss also passieren, damit Schüler die Schule nicht mehr besuchen?
Welche Formen des Schulabsentismus gibt es und was steht Forschern bereit, um Schulabsentismus zu erkennen? Während des Praktikums der Autorin fielen ihr die Häufungen des Schulabsentismus auf, da sehr viele Patienten, mit unterschiedlichen Arbeitsdiagnosen (nach der ICD-10), keine Schule mehr besuchten. Die Meisten mieden diese seit 2 Jahren. Die Autorin ahnte, welche Konsequenzen der Schulabsentismus für die jungen Patienten haben müsste, da die Praxis Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren behandelt, in dessen Zeitraum gewöhnlich die Fundamente für die Berufslaufbahn gelegt werden.
Ziel dieser Arbeit ist die Komplexität des Schulabsentismus zu demonstrieren und deswegen die Schwierigkeit der Diagnosestellung zu skizzieren. Der Schulabsentismus ist Sammelbegriff der Schulangst, der Schulphobie und des Schulschwänzens und ist ein Unterpunkt der Angst, sodass zunächst alterstypische Kinderängste aufgezeigt werden. Es folgen Epidemiologie und Prävalenz von Schulabsentismus. Im Anschluss daran, wird das definitorische Störungsbild und seine Diagnosen erläutert, wobei zwischen angstverknüpften und angstfreien Ursachen unterschieden wird.
Es folgt die Ätiologie der Substörungen: Schulangst, Schulphobie und Schulschwänzen, wobei auf mehrere Einflusskomponenten geachtet wird. Anregungen von Diskussionsteilnehmern werden zusätzlich ausgewiesen. Ferner wird die Diagnostik von Schulabsentismus aufgeführt und weiter auf die Folgen des Schulabsentismus eingegangen. Den Abschluss bildet die Therapie des Schulabsentismus, ambulant und stationär, wie das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Angst
- Epidemiologie
- Schulabsentismus
- Klinische Definition/ Diagnosen
- Schulverweigerung (Schulphobie und Schulangst)
- Schulphobie
- Schulangst
- Zusammenfassung: Schulverweigerung
- Schulschwänzen
- Andere Störungstypen
- Fernhalten
- Psychische Abwesenheit
- Risikofaktoren/ Risikogruppen
- Schutzfaktoren
- Ätiologie
- Schulphobie
- Schulangst
- Schulmeidung
- Schule
- Peerbeziehung
- Familie/sozioökonomische Schicht
- Individuell
- Stimmen von Diskussionsteilnehmern
- Diagnostik
- Beschreibung des Praktikumsbetriebes
- Verfahren
- Folgen
- Therapie Schulabsentismus
- Erstmaßnahmen
- Ambulanz
- Station
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Übersichtsarbeit befasst sich mit dem komplexen Phänomen des Schulabsentismus, der verschiedene Formen wie Schulangst, Schulphobie und Schulschwänzen umfasst. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Facetten des Schulabsentismus zu beleuchten, seine Ursachen zu analysieren und den schwierigen Prozess der Diagnosestellung zu verdeutlichen. Dabei werden die relevanten Forschungsarbeiten, die sich mit den unterschiedlichen Formen des Schulabsentismus und seinen Auswirkungen auf die betroffenen Schüler auseinandersetzen, analysiert und diskutiert.
- Definition und Abgrenzung der verschiedenen Formen von Schulabsentismus
- Analyse der Ursachen und Entstehung von Schulabsentismus
- Herausforderungen der Diagnosestellung von Schulabsentismus
- Beschreibung möglicher Folgen von Schulabsentismus für die Betroffenen
- Vorstellung verschiedener Therapieansätze zur Behandlung von Schulabsentismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Leser in das Thema Schulabsentismus einführt und die Relevanz des Themas hervorhebt. Anschließend werden in Kapitel 2 und 3 grundlegende Begriffe und Konzepte wie "Angst" sowie die Epidemiologie des Schulabsentismus beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich einer detaillierten Beschreibung der verschiedenen Formen des Schulabsentismus, wie Schulangst, Schulphobie und Schulschwänzen. Es werden die jeweiligen Merkmale der verschiedenen Formen des Schulabsentismus erläutert und es wird auf die Bedeutung einer eindeutigen Diagnosestellung eingegangen. Kapitel 5 beschäftigt sich mit den verschiedenen Ursachen und Entstehungsfaktoren des Schulabsentismus. Die Arbeit geht dabei auf verschiedene Einflussfaktoren wie die Familiensituation, Peerbeziehungen und individuelle Faktoren ein. Kapitel 6 widmet sich der Diagnostik von Schulabsentismus, beschreibt die Besonderheiten der Diagnosestellung und geht auf die verschiedenen Verfahren ein. Kapitel 7 beleuchtet die Folgen von Schulabsentismus und untersucht die Auswirkungen auf die betroffenen Schüler. Das abschließende Kapitel 8 behandelt verschiedene Therapieansätze zur Behandlung von Schulabsentismus und erläutert verschiedene Therapieformen, wie ambulante und stationäre Behandlungen.
Schlüsselwörter
Schulabsentismus, Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen, Diagnosestellung, Ursachen, Therapie, Prävalenz, Epidemiologie, Pädagogik, Psychologie, Kinder und Jugendliche, Schule, Familie, Peerbeziehungen, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Folgen, Auswirkungen
- Quote paper
- Corinna Huthmacher (Author), 2018, Die Problematik des Schulabsentismus ausgehend von Schulangst, Schulphobie und Schulschwänzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416306