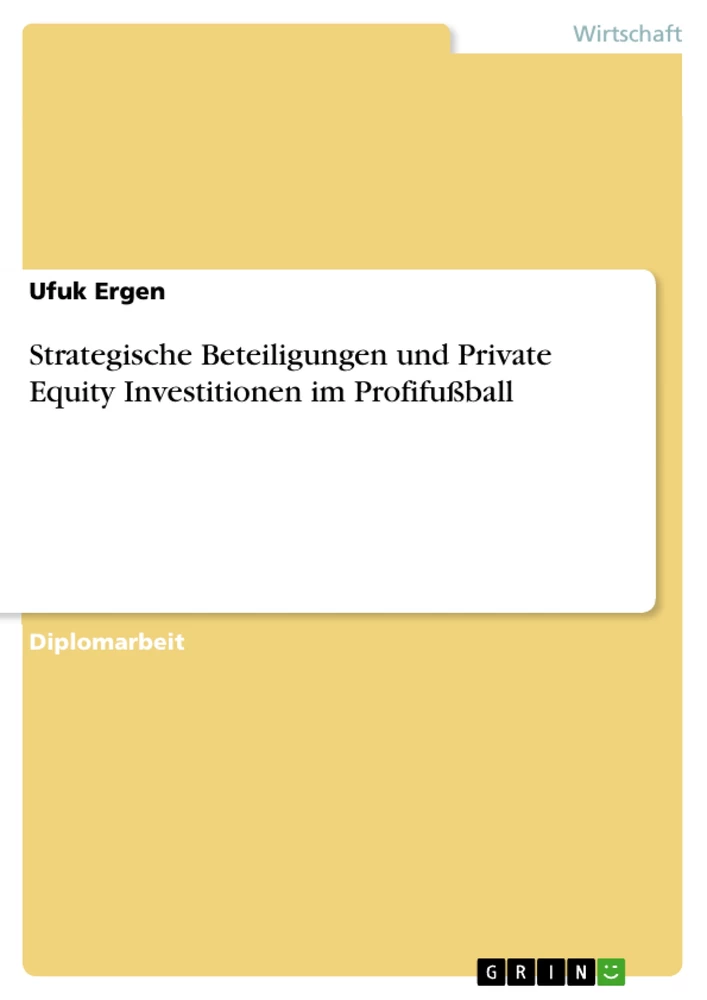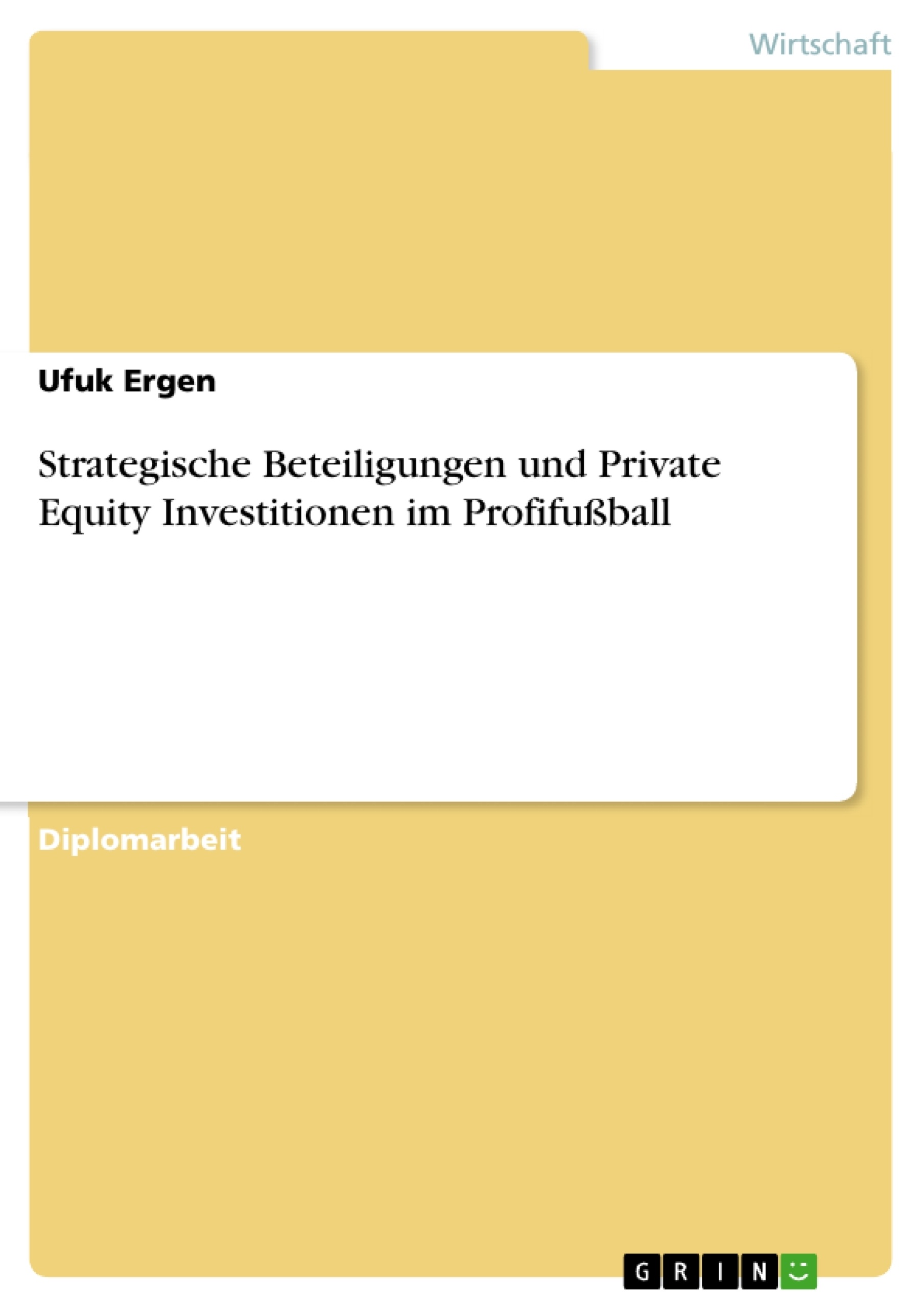Die zugrundeliegende Arbeit beleuchtet den Profifußball in Deutschland und Europa aus Investorensicht. Da Fußballvereine heutzutage wie Wirtschaftsunternehmen geführt werden, wird zu Beginn das Geschäftsmodell von Profifußballclubs am Beispiel der Bundesliga analysiert.
Kapitel 2 gibt in diesem Sinne ein grundlegendes Verständnis darüber, aus welchen Quellen Bundesligisten Umsätze generieren, wie sich die Kostenstruktur zusammensetzt, wie hoch die Profitabilität ist und welche Finanzierungsformen es gibt. Zudem erfolgt ein Vergleich der finanzwirtschaftlichen Situation der Bundesliga mit den vier Top-Ligen Europas.
In Kapitel 3 werden potentielle Investoren über mögliche Restriktionen bei Fußballclubbeteiligungen informiert. Dabei wird sowohl die in Deutschland herrschende 50+1-Regel als auch das neu eingeführte Financial Fair Play Konzept der UEFA veranschaulicht.
Aufbauend auf diesem Basiswissen widmet sich der erste Kernbereich der Arbeit dem Thema der Beteiligungen im Profifußball. Hierzu werden in Kapitel 4 ausgewählte Transaktionsbeispiele aus europäischen Top-Ligen analysiert, um verschiedene Beteiligungsformen an Profifußballclubs aufzuzeigen und das involvierte Investorenfeld zu veranschaulichen. Im Rahmen der Untersuchung werden sowohl direkte Beteiligungen an Fußballclubs (Kapitel 4.1) als auch an kommerziell verwertbaren Club-Rechten (Kapitel 4.2) wie z.B. medialen Übertragungsrechten analysiert. Das Investorenfeld reicht dabei von marketingstrategisch orientierten Wirtschaftsunternehmen über von ihrer Leidenschaft zum Sport getriebenen Mäzenen und einzelnen Private Equity Investoren bis hin zu klassischen renditeorientierten Private Equity Firmen sowie emotionsgetriebenen Faninvestoren. In Kapitel 4.3 erfolgt eine abschließende Bewertung des Rendite-Risiko-Profils aller untersuchten Beteiligungsformen aus der Sicht potentieller Investoren als auch aus Clubperspektive.
Der zweite Kernbereich der Arbeit beinhaltet eine empirische Analyse der Profifußballclubs Deutschlands hinsichtlich ihrer Attraktivität für Investoren. Dabei werden die 18 Bundesligisten der Saison 2010/11 in Kapitel 5 auf Basis des selbst erstellten SWASM-Potentialanalysemodells untersucht und in einem Ranking miteinander verglichen.
Ziel dieser Analyse ist es, jene Profifußballclubs ausfindig zu machen, die das größte sportliche und wirtschaftliche Erfolgspotential besitzen und folglich für oben genannte Investoren besonders geeignet sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorgehensweise und Zielsetzung
- 2. Business Modell eines Profifußballclubs am Beispiel Bundesliga
- 2.1 Umsatzquellen
- 2.2 Kostenstruktur
- 2.3 Gewinn- und Verlustsituation
- 2.4 Finanzierungsstruktur
- 2.5 Finanzwirtschaftliche Situation in den Top-5-Ligen Europas
- 3. Restriktionen bei Beteiligungen an Profifußballclubs
- 3.1 Situation in Deutschland - „50+1“-Regelung der DFL
- 3.2 Situation in Europa – Financial Fair Play Konzept der UEFA
- 4. Beteiligungen im Profifußball
- 4.1 Direkte Beteiligung am Fußballclub
- 4.1.1 Strategische Beteiligung durch Wirtschaftsunternehmen
- 4.1.2 Private Equity Beteiligung
- 4.1.3 Beteiligung durch Fans als Investoren
- 4.2 Beteiligung an verwertbaren Rechten eines Fußballclubs
- 4.2.1 Beteiligung an Transferrechten
- 4.2.2 Beteiligung an medialen Übertragungsechten
- 4.3 Bewertung aller Beteiligungsformen aus Club- und Investorensicht
- 4.1 Direkte Beteiligung am Fußballclub
- 5. Attraktivität der Bundesligisten 2010/11 für Investoren – Potentialanalyse der Clubs auf Basis des SWASM-Modells
- 5.1 Auswahl der Kriterien und Aufbau der SWASM-Potentialanalyse
- 5.2 Analyse der Bundesligisten in den fünf SWASM-Kernbereichen
- 5.2.1 Sportliches Potential
- 5.2.2 Wirtschaftliches Potential
- 5.2.3 Anhängerpotential
- 5.2.4 Stadionpotential
- 5.2.5 Markenpotential
- 5.3 Ergebnisse der SWASM-Potentialanalyse
- 5.3.1 Aggregierte Bundesliga-Rankings für jeden SWASM-Kernbereich
- 5.3.2 Finales Bundesliga-Ranking auf Basis des gewichteten SWASM-Modells
- 6. Thesenförmige Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Attraktivität deutscher Profifußballclubs für Investoren. Sie analysiert das Geschäftsmodell von Bundesligavereinen, betrachtet die rechtlichen Rahmenbedingungen (wie die 50+1-Regel und Financial Fair Play) und beleuchtet verschiedene Beteiligungsformen. Die Arbeit bewertet die Attraktivität von Bundesligisten anhand eines entwickelten Modells.
- Geschäftsmodell von Profifußballclubs
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Investitionen
- Verschiedene Beteiligungsmodelle (strategische, Private Equity, Fan-Beteiligung)
- Potentialanalyse der Bundesligisten
- Bewertung der Attraktivität für Investoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorgehensweise und Zielsetzung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit und die Forschungsfragen. Es legt den Fokus auf die Analyse der Attraktivität von Bundesligisten für Investoren und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel. Die Zielsetzung ist klar definiert, und die Vorgehensweise wird detailliert dargestellt, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Arbeit zu gewährleisten.
2. Business Modell eines Profifußballclubs am Beispiel Bundesliga: Dieses Kapitel analysiert detailliert das Geschäftsmodell eines typischen Bundesligisten. Es beleuchtet die verschiedenen Umsatzquellen (z.B. Medienrechte, Sponsoring, Ticketing), die Kostenstruktur (Spielergehälter, Infrastruktur, etc.) und die daraus resultierende Gewinn- und Verlustsituation. Der Vergleich mit den Top-5-Ligen in Europa bietet eine wichtige internationale Perspektive und ermöglicht die Einordnung der deutschen Liga in einem globalen Kontext. Die Analyse der Finanzierungsstruktur und der finanziellen Situation liefert wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
3. Restriktionen bei Beteiligungen an Profifußballclubs: Hier werden die wichtigsten rechtlichen und regulatorischen Hürden für Investitionen im Profifußball beleuchtet. Im Mittelpunkt steht die deutsche 50+1-Regel und ihre Auswirkungen auf die Investorenlandschaft. Der Vergleich mit dem Financial Fair Play Konzept der UEFA verdeutlicht die Unterschiede in den regulatorischen Ansätzen und deren Einfluss auf die Attraktivität der Ligen. Die Analyse der rechtlichen Restriktionen ist essentiell für das Verständnis der Herausforderungen, vor denen potenzielle Investoren stehen.
4. Beteiligungen im Profifußball: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über verschiedene Beteiligungsformen im Profifußball. Es unterscheidet zwischen direkten Beteiligungen an Fußballclubs (strategische Beteiligungen durch Unternehmen, Private Equity Beteiligungen, Fan-Beteiligungen) und Beteiligungen an verwertbaren Rechten (Transferrechte, Medienrechte). Anhand von konkreten Beispielen aus verschiedenen europäischen Ligen wird die Vielfalt der Beteiligungsmodelle und deren Auswirkungen auf die Clubs und Investoren verdeutlicht. Die Kapitel liefert wichtige Fallstudien, um verschiedene Strategien und deren Erfolg zu beurteilen.
5. Attraktivität der Bundesligisten 2010/11 für Investoren – Potentialanalyse der Clubs auf Basis des SWASM-Modells: In diesem Kapitel wird ein eigenes Modell (SWASM) zur Bewertung des Investitionspotenzials von Bundesligisten vorgestellt und angewendet. Die Analyse umfasst fünf Kernbereiche: Sportliches, Wirtschaftliches, Anhänger-, Stadion- und Markenpotential. Für jeden Bereich werden relevante Kriterien definiert und die Bundesligisten anhand dieser Kriterien bewertet. Das Ergebnis ist ein Ranking der Bundesligisten nach ihrer Attraktivität für Investoren. Die Methodik und die Ergebnisse liefern wertvolle Informationen für potenzielle Investoren.
Schlüsselwörter
Profifußball, Strategische Beteiligungen, Private Equity, Investitionen, Bundesliga, 50+1-Regel, Financial Fair Play, SWASM-Modell, Potentialanalyse, Umsatz, Kosten, Finanzierung, Attraktivität, Risiko, Bewertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Attraktivität deutscher Profifußballclubs für Investoren
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Attraktivität deutscher Profifußballclubs, insbesondere der Bundesligisten, für Investoren. Sie analysiert das Geschäftsmodell dieser Vereine, die rechtlichen Rahmenbedingungen und verschiedene Beteiligungsformen. Ein eigens entwickeltes Modell (SWASM) wird zur Bewertung des Investitionspotenzials eingesetzt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: das Geschäftsmodell von Profifußballclubs (Umsatzquellen, Kostenstruktur, Finanzierung), rechtliche Rahmenbedingungen wie die 50+1-Regel und Financial Fair Play, verschiedene Beteiligungsmodelle (strategische Beteiligungen, Private Equity, Fan-Beteiligungen, Beteiligung an Rechten), eine Potentialanalyse der Bundesligisten (basierend auf dem SWASM-Modell) und die Bewertung der Attraktivität für Investoren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Vorgehensweise und Zielsetzung, 2. Business Modell eines Profifußballclubs (am Beispiel Bundesliga), 3. Restriktionen bei Beteiligungen an Profifußballclubs, 4. Beteiligungen im Profifußball, 5. Attraktivität der Bundesligisten 2010/11 für Investoren (Potentialanalyse mit dem SWASM-Modell), 6. Thesenförmige Zusammenfassung der Ergebnisse. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was ist das SWASM-Modell?
Das SWASM-Modell ist ein von den Autoren entwickeltes Bewertungsinstrument zur Analyse des Investitionspotenzials von Bundesligisten. Es berücksichtigt fünf Kernbereiche: Sportliches Potential, Wirtschaftliches Potential, Anhängerpotential, Stadionpotential und Markenpotential. Die Bundesligisten werden anhand dieser Kriterien bewertet und in einem Ranking dargestellt.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die deutsche 50+1-Regel, die die Einflussnahme von Investoren auf Bundesligisten einschränkt, und das Financial Fair Play Konzept der UEFA, das die finanzielle Stabilität europäischer Fußballclubs sichern soll. Die Unterschiede und Auswirkungen beider Regelungen werden verglichen.
Welche Arten von Beteiligungen werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet zwischen direkten Beteiligungen an Fußballclubs (strategische Beteiligungen durch Unternehmen, Private Equity Beteiligungen, Fan-Beteiligungen) und Beteiligungen an verwertbaren Rechten (Transferrechte, Medienrechte). Die Vor- und Nachteile jeder Beteiligungsform werden aus Club- und Investorensicht betrachtet.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert ein Ranking der Bundesligisten nach ihrer Attraktivität für Investoren basierend auf dem SWASM-Modell. Sie identifiziert Stärken und Schwächen der einzelnen Clubs und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen von Investitionen im deutschen Profifußball. Die Ergebnisse sind thesenförmig zusammengefasst.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Investoren, die am deutschen Profifußball interessiert sind, Fußballclubs, die ihre Attraktivität für Investoren verbessern wollen, Wissenschaftler und Studenten, die sich mit dem Thema Fußballökonomie und -finanzierung beschäftigen, sowie alle Interessierten an den wirtschaftlichen Aspekten des Profifußballs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Profifußball, Strategische Beteiligungen, Private Equity, Investitionen, Bundesliga, 50+1-Regel, Financial Fair Play, SWASM-Modell, Potentialanalyse, Umsatz, Kosten, Finanzierung, Attraktivität, Risiko, Bewertung.
- Quote paper
- Ufuk Ergen (Author), 2011, Strategische Beteiligungen und Private Equity Investitionen im Profifußball, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416299