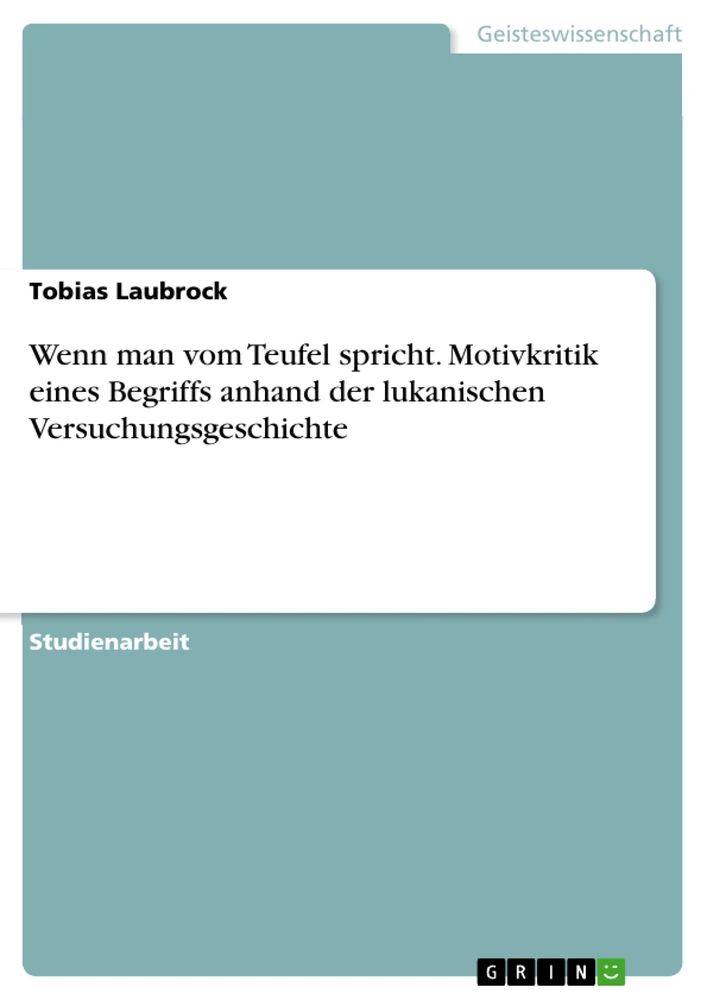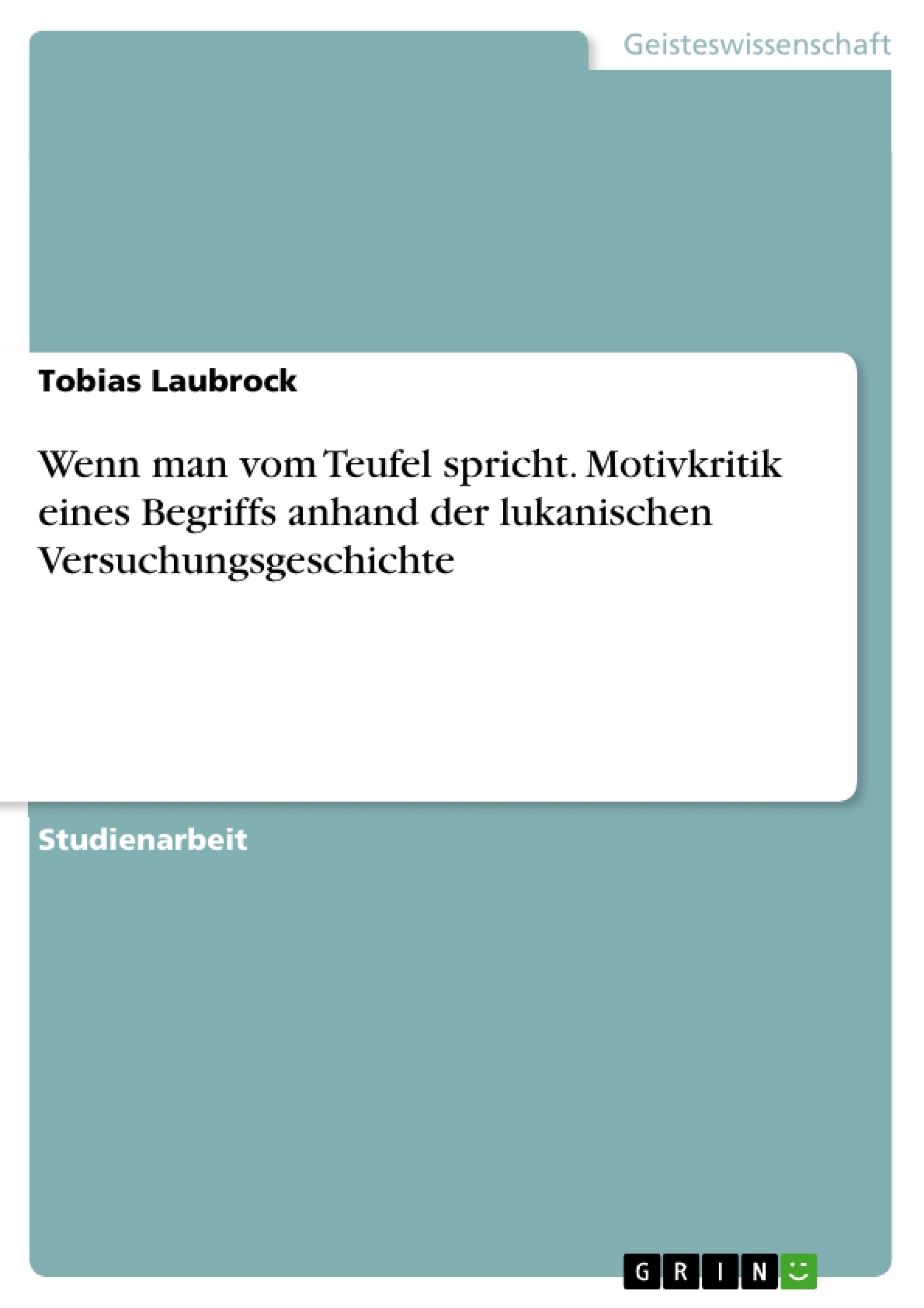Der Teufel steckt im Detail. - Nicht selten hört man diese Formulierung, wenn es um das detaillierte Suchen von Fachtermini in wissenschaftlicher Literatur geht.
Doch der Teufel versteckt sich keineswegs nur in den Untiefen so mancher wissenschaftlicher Literatur. Auch in der Bibel findet er Erwähnung.
Als eine der berühmtesten - und am häufigsten rezipierten - Geschichten der Bibel, in denen der Teufel eine Rolle spielt, darf wohl die Versuchungsgeschichte aus dem Lukasevangelium gelten (Lk 4,1-13). Anhand der Methoden der historisch-kritischen Exegese lege ich in dieser Arbeit dar, welche Rolle der "Durcheinanderwerfer" in dieser lukanischen Geschichte einnimmt. Dabei beschränke ich mich jedoch nicht allein auf die vorliegende Erzählung, sondern werde motivkritisch zeigen, aus welchen historischen Quellen der Autor des Lukasevangeliums bei dieser Figur schöpfte. Somit fließen auch einige Bücher der Hebräischen Bibel sowie die Thesen der wissenschaftlichen Zweiquellentheorie mit in die Ausarbeitung ein.
Selbstverständlich sind die entscheidenden biblischen Zeugnisse an den wichtigen Stellen auch in griechischer und hebräischer Sprache zitiert.
Viel Freude beim Lesen! :)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textpräsentation und sprachliche Analyse
- Gliederung einzelner Sinnabschnitte
- Lk 4,1-2: Jesu Aufenthalt in der Wüste
- Lk 4,3-4: Erste Versuchung – Verwandlung eines Steins zu Brot
- Lk 4,5-8: Zweite Versuchung – Übergabe der Vollmacht an Jesus
- Lk 4,9-12: Dritte Versuchung – Der Sturz vom Jerusalemer Tempel
- Lk 4,13: Das Ende der Versuchungen
- Textanalytische Beobachtungen
- Grundlegende textmorphologische Beobachtungen
- Komplementäre Begriffspaare
- Blick auf die Subjekte - Syntaktische Beobachtungen
- Gesamtergebnis der Textanalyse
- Gliederung einzelner Sinnabschnitte
- Kontextanalyse
- Was geht der Versuchungsgeschichte voraus?
- Die Abstammung Jesu
- Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist
- Was folgt der Versuchungsgeschichte?
- Was geht der Versuchungsgeschichte voraus?
- Form- und Gattungskritik
- Motivkritik und Traditionsgeschichte
- Der Auctor ad Theophilum
- Erkenntnisse der Einleitungswissenschaft
- Lukas – Heidenchrist oder Judenchrist?
- Motivkritik am Alten Testament
- py in der Hebräischen Bibel
- Verbindung zum Lukasevangelium
- Neutestamentliche Parallelen
- Der synoptische Vergleich
- Die Zweiquellentheorie
- Synoptischer Vergleich zwischen Lukas und Matthäus
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Schlussfolgerung des synoptischen Vergleichs
- „Q“ – oder: die Logienquelle
- Schlussfolgerung aus der Quellensichtung
- Der Auctor ad Theophilum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Versuchungsgeschichte Jesu im Lukasevangelium (Lk 4,1-13) aus exegetischer Perspektive zu analysieren und die Figur des Teufels in ihrer biblischen und traditionsgeschichtlichen Bedeutung zu beleuchten. Hierbei stehen die sprachlichen Eigenheiten der lukanischen Versuchungsgeschichte sowie die Einbettung dieser Geschichte in den Gesamtkontext des Lukasevangeliums im Mittelpunkt. Des Weiteren werden die Quellen und Traditionen, auf die der dritte Evangelist zurückgreift, untersucht.
- Die sprachliche Analyse der Versuchungsgeschichte
- Der traditionsgeschichtliche Kontext der Figur des Teufels
- Die Verwendung alttestamentlicher Motive im Lukasevangelium
- Die Quellenkritik und die Bestimmung der literarischen Abhängigkeiten
- Die Bedeutung der Versuchungsgeschichte im Kontext des Lukasevangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema ein, stellt die zentrale Forschungsfrage nach der traditionsgeschichtlichen Verwurzelung des Teufelsbegriffs in der lukanischen Versuchungsgeschichte und skizziert die methodischen Schritte der Untersuchung.
- Textpräsentation und sprachliche Analyse: Die Versuchungsgeschichte wird in fünf Sinnabschnitte untergliedert und sprachlich analysiert. Es werden grundlegende textmorphologische Beobachtungen, komplementäre Begriffspaare und syntaktische Besonderheiten des Textes herausgearbeitet.
- Kontextanalyse: Die Versuchungsgeschichte wird in den Gesamtkontext des Lukasevangeliums eingebettet. Es werden die Abstammung Jesu und seine Taufe sowie die darauffolgenden Ereignisse in ihrer Bedeutung für die Erzählung untersucht.
- Form- und Gattungskritik: Die Versuchungsgeschichte wird aus gattungskritischer Perspektive betrachtet und in die Gattung der Versuchungsgeschichte eingeordnet. Die Formmerkmale und inhaltlichen Elemente dieser Gattung werden analysiert.
- Motivkritik und Traditionsgeschichte: Die Figur des Teufels wird in ihrer traditionsgeschichtlichen Bedeutung beleuchtet. Es werden alttestamentliche Parallelen und die Einbettung des Motivs in das neutestamentliche Gesamtbild untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der lukanischen Versuchungsgeschichte, insbesondere mit dem Motiv des Teufels. Weitere relevante Schlüsselwörter sind: Exegese, Textanalyse, Kontextanalyse, traditionsgeschichtliche Forschung, alttestamentliche Parallelen, neutestamentliche Literatur, Quellenkritik, Synoptische Evangelien.
- Quote paper
- Tobias Laubrock (Author), 2017, Wenn man vom Teufel spricht. Motivkritik eines Begriffs anhand der lukanischen Versuchungsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416081