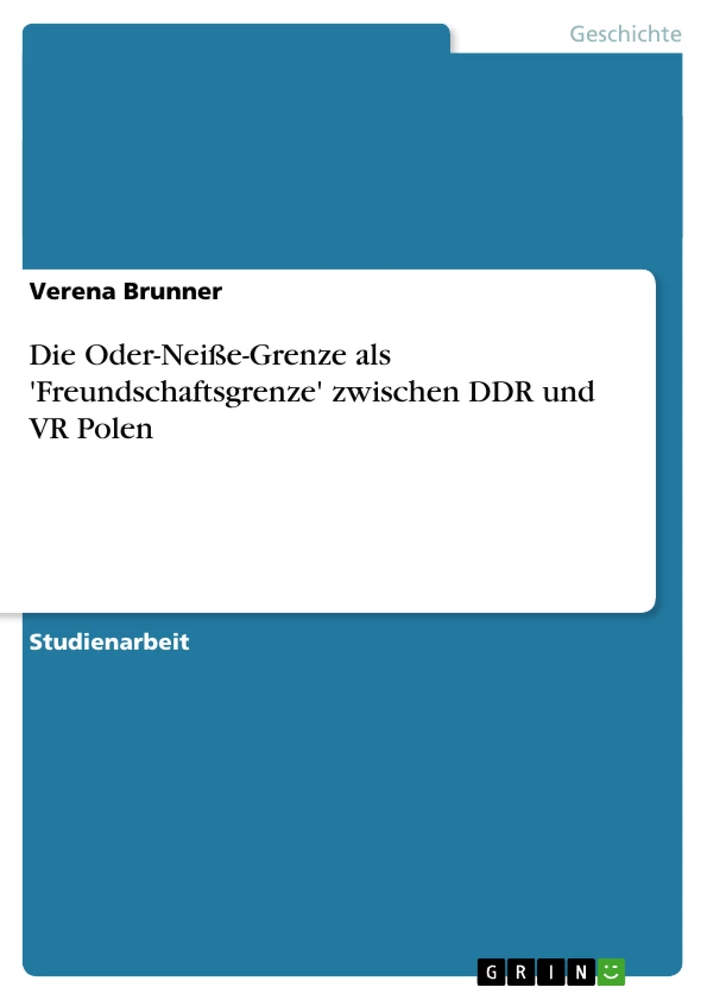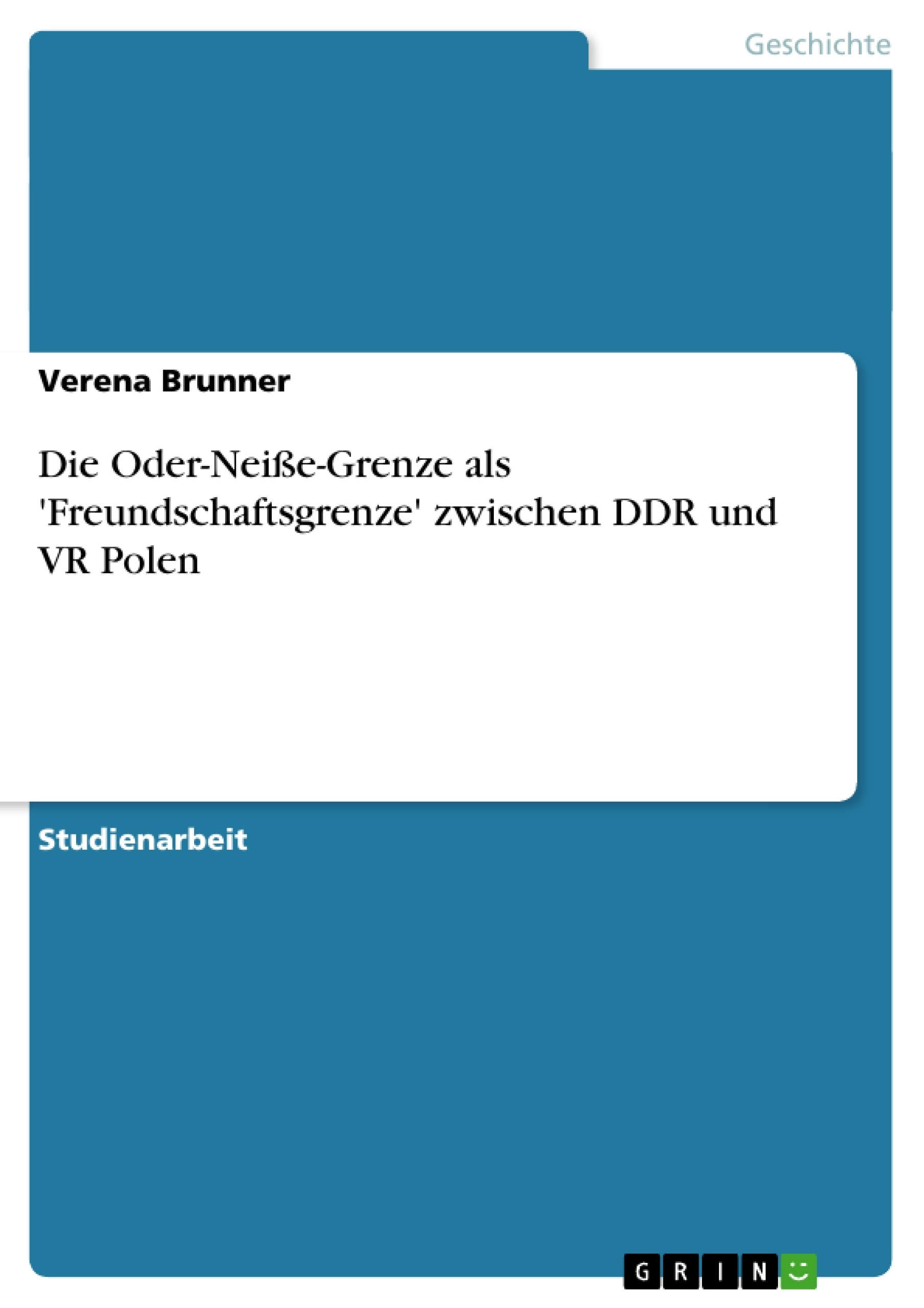Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Grenzgebiet Oder-Neiße zwischen dem Staat der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen. Es soll die Frage geklärt werden, wie sich die trennenden und integrierenden Faktoren der Oder-Neiße-Linie im Laufe der Zeit darstellten, vor allem in Hinblick auf politische Umstände der Zeit. War diese Grenze innerhalb des sozialistischen Staatenblockes eine „Friedensgrenze“ zwischen zwei Bruderstaaten und wie sah diese Politik im regionalen Rahmen aus? Die Schlussbetrachtungen liefern ein Bild der gegenwärtigen Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Polen in der Grenzregion.
Inhaltsverzeichnis
- I. Umsiedlungen und Wiederaufbau nach Kriegsende
- I.1. Die Politik zur Grenzziehung
- I.2. Bevölkerungstransfer und Wiederaufbau im Grenzgebiet
- II. Die „Friedensgrenze“ zwischen den sozialistischen Bruderstaaten
- II.1. Der militärische Charakter der Grenze
- II.2. Die Grenze im Visier der Propaganda
- II.3. Grenzkooperation und Zusammenarbeit
- III. Die Offene Grenze von 1972 - 1980
- III.1. Das Abkommen vom visa- und paßfreien Grenzverkehr
- III.2. Soziale Kontakte und Vorbehalte
- IV. Grenzschliessung in den 80er Jahren - Durchlässigkeiten
- IV.1. Die Geschlossene Grenze 1980 bis 1991
- IV.2. Die Durchlässigkeit der geschlossenen Grenze
- V. Neue Konstellationen seit der Wende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Oder-Neiße-Grenze zwischen der DDR und der VR Polen, analysiert deren Entwicklung im Laufe der Zeit und beleuchtet die ambivalenten Aspekte dieser Grenze als sowohl trennendes als auch verbindendes Element zwischen den beiden sozialistischen Bruderstaaten. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die Bezeichnung „Friedensgrenze“ die Realität widerspiegelt und wie die politische Situation die regionale Entwicklung beeinflusste.
- Die Politik der Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg
- Der Bevölkerungstransfer und der Wiederaufbau im Grenzgebiet
- Die Rolle der Propaganda und der Grenzkooperation
- Die Phasen der offenen und geschlossenen Grenze
- Die Veränderungen nach der Wende
Zusammenfassung der Kapitel
I. Umsiedlungen und Wiederaufbau nach Kriegsende: Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen der Oder-Neiße-Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt die politische Festlegung der Grenze, die von Stalin angestrebt und mit der Londoner Exilregierung abgestimmt wurde, und den folgenden Gebietsverlust für Deutschland. Der Fokus liegt auf den gewaltsamen Umsiedlungen der deutschen Bevölkerung und dem schwierigen Wiederaufbau im Grenzgebiet. Die Teilung von Städten wie Frankfurt (Oder), Guben/Gubin und Görlitz/Zgorzelec wird als Beispiel für die tiefgreifenden Auswirkungen der Grenzziehung auf die Infrastruktur und die Wirtschaft der Region dargestellt. Die unterschiedlichen Herausforderungen auf beiden Seiten der Grenze, wie Wohnungsnot, Versorgungsschwierigkeiten und der langsame Wiederaufbau aufgrund von Demontagen durch die sowjetische Armee, werden detailliert erläutert. Die anfängliche Fehlanzeige einer dauerhaften Anerkennung der Grenze von deutscher Seite und die damit verbundenen Unsicherheiten werden ebenfalls thematisiert.
II. Die „Friedensgrenze“ zwischen den sozialistischen Bruderstaaten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Oder-Neiße-Grenze als „Friedensgrenze“ zwischen zwei sozialistischen Bruderstaaten. Es analysiert den Widerspruch zwischen der offiziellen Ideologie der Freundschaft und der Realität einer stark militarisierten Grenze, die durch Propaganda und Kontrolle geprägt war. Das Kapitel betont die Bedeutung der unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen und der Einstellung der Bevölkerung zur Grenze, die die Bemühungen um eine Konsolidierung der Grenzfrage beeinflussten. Der Görlitzer Vertrag wird als Beispiel für die offiziellen politischen Bemühungen zur Stabilisierung der Situation genannt. Die Rolle der Propaganda in der Gestaltung des „brüderlichen Zusammenlebens“ wird kritisch untersucht. Trotz der ideologischen Nähe der beiden Staaten bleibt der trennende Charakter der Grenze unübersehbar.
Schlüsselwörter
Oder-Neiße-Grenze, DDR, VR Polen, Bevölkerungstransfer, Wiederaufbau, Friedensgrenze, Propaganda, Grenzkooperation, sozialistischer Staatenblock, geteilte Städte, Görlitzer Vertrag, militärische Grenze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Oder-Neiße-Grenze
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Geschichte der Oder-Neiße-Grenze zwischen der DDR und der VR Polen. Er analysiert die Entwicklung der Grenze von ihrer Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur deutschen Wiedervereinigung, beleuchtet deren ambivalente Rolle als trennendes und verbindendes Element und hinterfragt den Begriff "Friedensgrenze".
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Politik der Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg, den damit verbundenen Bevölkerungstransfer und Wiederaufbau im Grenzgebiet, die Rolle der Propaganda und Grenzkooperation, die Phasen der offenen und geschlossenen Grenze sowie die Veränderungen nach der Wende 1989/90. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich zwischen der offiziellen Darstellung als "Friedensgrenze" und der tatsächlichen Situation.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I behandelt die Umsiedlungen und den Wiederaufbau nach Kriegsende, fokussiert auf die Folgen der Grenzziehung und den gewaltsamen Bevölkerungstransfer. Kapitel II analysiert die "Friedensgrenze" zwischen den sozialistischen Bruderstaaten, den Widerspruch zwischen offizieller Ideologie und militärischer Realität. Kapitel III beschreibt die Phase der offenen Grenze von 1972 bis 1980, inklusive des Abkommens zum visa- und paßfreien Grenzverkehr. Kapitel IV untersucht die Grenzschließung in den 1980er Jahren und die Durchlässigkeiten trotz der geschlossenen Grenze. Kapitel V befasst sich schließlich mit den neuen Konstellationen nach der Wende.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Oder-Neiße-Grenze, DDR, VR Polen, Bevölkerungstransfer, Wiederaufbau, Friedensgrenze, Propaganda, Grenzkooperation, sozialistischer Staatenblock, geteilte Städte, Görlitzer Vertrag, militärische Grenze.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Oder-Neiße-Grenze in ihrer Entwicklung und beleuchtet die ambivalenten Aspekte dieser Grenze als trennendes und verbindendes Element zwischen der DDR und der VR Polen. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die Bezeichnung „Friedensgrenze“ die Realität widerspiegelt und wie die politische Situation die regionale Entwicklung beeinflusste.
Welche konkreten Beispiele werden im Text genannt?
Der Text nennt als Beispiele für die Auswirkungen der Grenzziehung die Teilung von Städten wie Frankfurt (Oder), Guben/Gubin und Görlitz/Zgorzelec und den Görlitzer Vertrag als Beispiel für politische Bemühungen zur Stabilisierung der Situation.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für alle gedacht, die sich wissenschaftlich mit der Geschichte der Oder-Neiße-Grenze, den Beziehungen zwischen der DDR und Polen und den Auswirkungen des Kalten Krieges auf die Region befassen möchten.
- Quote paper
- Mag.phil. Verena Brunner (Author), 2003, Die Oder-Neiße-Grenze als 'Freundschaftsgrenze' zwischen DDR und VR Polen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41574