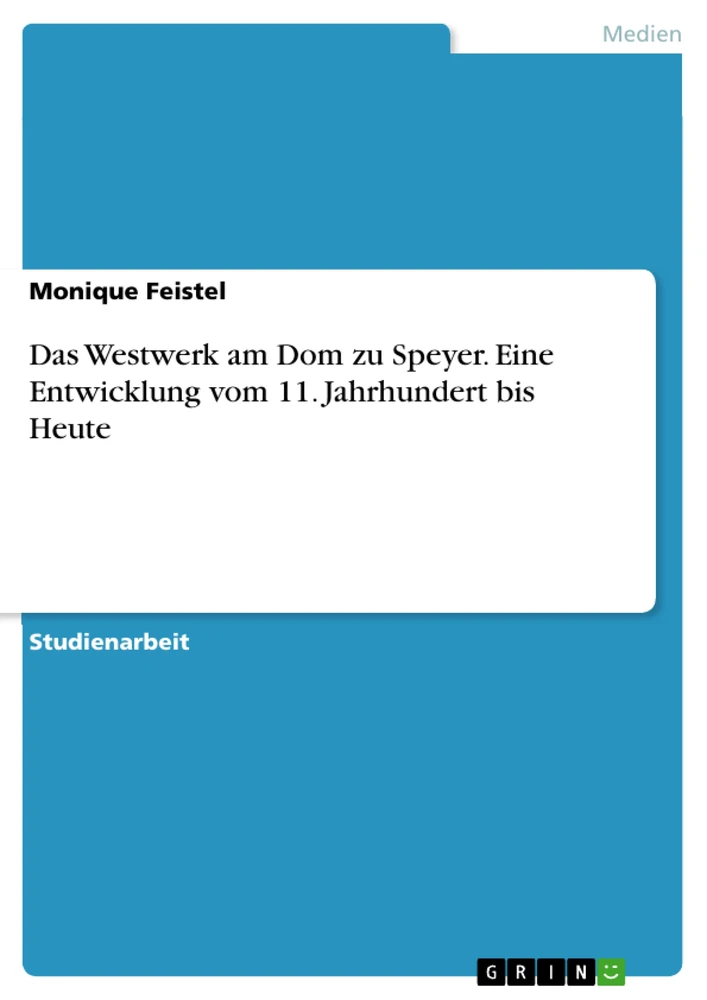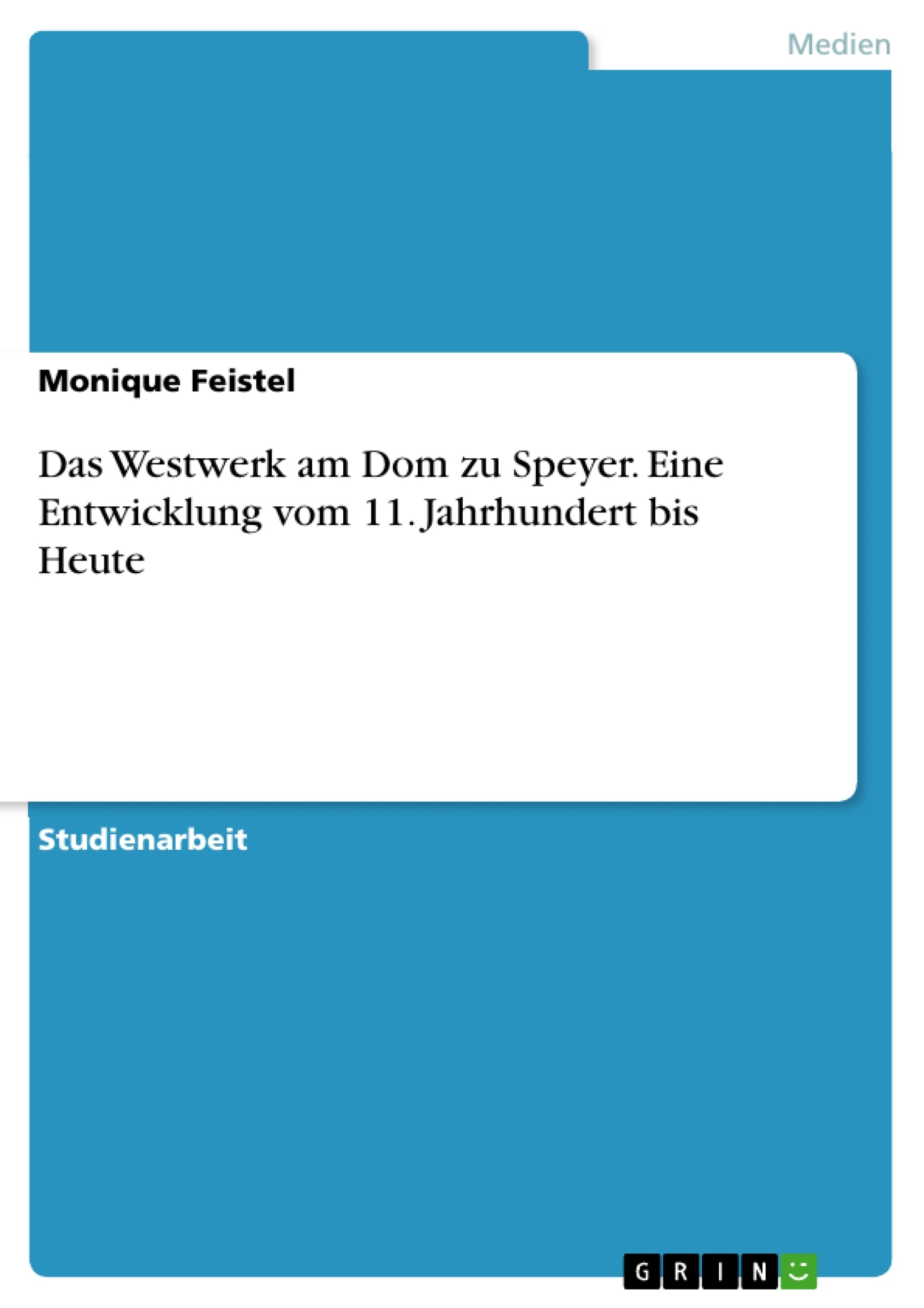Der Dom bildet den Blickpunkt der kleinen Stadt Speyer, westlich des Rheines. Seit Mitte des elften Jahrhunderts präsentiert sich der Bau als bedeutendstes Bauwerk der Romanik. Begonnen bei den Karolingern und Ottonen, über den Stil des Barocks bis heute, haben sich verschiedene Bauherren, Sponsoren und Stifter bemüht, diese Bedeutung zur Geltung zu bringen. Im Laufe der Jahre durchlief der Dom einige Neuerungen, sowie An- und Abbauten. Auch nach der großteiligen Zerstörung im Erbfolgekrieg 1689 gab man ihn nicht auf, sondern gestaltete ihn im Sinne des Barock neu. Erst durch die neuzeitliche Restaurierung erstrahlt der Dom wieder im Stil der Romanik.
Trotz mehrfacher Studien zur Baugeschichte, Stil und Aufbau des Domes, zum Beispiel durch Professor Doktor Kubach, sind noch nicht alle Fragen zum Dom in Speyer geklärt. Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich mich besonders auf den Westbau konzentrieren. Hierbei soll vor allem auf den Bau von Herrn Hübsch eingegangen werden, aber auch die Entwicklung von Beginn Speyer I aufgezeigt werden. Zuvor wird eine kleine Zusammenfassung zur Geschichte des Domes einen ersten Überblick in das Thema verschaffen. Nachdem die vier Westbauten in chronologischer Reihenfolge beschrieben sind, wird auch auf die Beziehung zum gesellschaftlichen Kontext eingegangen. Warum gleicht der Bau Neumanns in seiner Form eher orientalischen Bauten? Und warum war es wichtig den Bau wieder den romanischen Grundzügen anzupassen? Es soll also nicht nur ein Überblick über die Westbauten aufgestellt werden, sondern auch dessen Bedeutung zur Zeitgeschichte und den Werten der Gesellschaft und des Umfeldes beschrieben werden.
Des Weiteren werden die romanischen Dome Mainz und Worms beschrieben. Das Hauptaugenmerk soll dabei auf den Ost- und Westteil gelegt werden und mit Speyer verglichen werden. Die Ausführungen werden sich vor allem auf die heute bestehenden Bauten richten. Es ist beabsichtigt auf Architekturbeschreibungen der Teile des Domes von Speyer, ausgenommen des Westbaus, zu verzichten. Lediglich die Beziehungen zwischen Westwerk und dem Rest des Domes sind hier von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte zum Dom
- Entwicklung des Westwerks von der ersten Bauzeit Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum 19. Jahrhundert
- Der Westbau von Speyer I, 1030‐1061
- Der Westbau von Speyer II, 1082‐1106
- Der Neumann`sche Westbau um 1772‐1780
- Westfassade nach Heinrich Hübsch 1854‐57
- Der Westbau von Heinrich Hübsch im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse
- Vergleich der Westwerke Mainz und Worms mit Speyer
- Mainzer Dom
- Der Wormser Dom
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Westwerks am Speyrer Dom vom 11. Jahrhundert bis heute. Hauptfokus liegt auf dem Westbau von Heinrich Hübsch, eingebettet in den gesellschaftlichen Kontext seiner Entstehung. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Bauphasen und deren architektonische Besonderheiten, sowie den Vergleich mit den Westwerken der Dome in Mainz und Worms.
- Architekturgeschichte des Speyrer Dom Westwerks
- Einfluss gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse auf die Baugestaltung
- Vergleichende Analyse der Westwerke von Speyer, Mainz und Worms
- Die Rolle von bedeutenden Architekten und Baumeistern
- Entwicklung des romanischen Baustils im Kontext der Restaurierungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Speyrer Dom als bedeutendes Bauwerk der Romanik. Sie benennt die Forschungslücke und die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Entwicklung des Westbaus konzentriert, insbesondere auf den Bau von H. Hübsch. Die Arbeit verspricht eine chronologische Beschreibung der vier Westbauten und deren Einbettung in den gesellschaftlichen Kontext.
2. Geschichte zum Dom: Dieses Kapitel skizziert die Baugeschichte des Speyrer Domes, beginnend mit Konrad II. Es beschreibt die einzelnen Bauphasen, die beteiligten Akteure (Kaiser, Architekten, Bischöfe) und die wichtigsten Veränderungen am Bauwerk. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Epochen (Ottonen, Salier) und ihren Einfluss auf den Stil und die Bauweise. Es wird auf die Zerstörungen im Erbfolgekrieg und die anschließenden Restaurierungsarbeiten eingegangen, unterstreicht die Herausforderungen der Baugeschichte und den andauernden Prozess des Umbaus und der Erneuerung.
3. Entwicklung des Westwerks von der ersten Bauzeit Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die vier Hauptbauphasen des Speyrer Dom Westwerks. Es beschreibt detailliert die architektonischen Merkmale jeder Phase (Speyer I, Speyer II, Neumann'scher Westbau, Hübsch'scher Westbau) und hebt die Veränderungen im Stil und der Gestaltung hervor. Die Analyse berücksichtigt sowohl erhaltene Strukturen als auch Rekonstruktionen, wobei die jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexte beleuchtet werden. Die Kapitel unterstreichen die Kontinuität und die Brüche in der architektonischen Entwicklung des Westwerks über die Jahrhunderte.
4. Der Westbau von Heinrich Hübsch im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse: Dieses Kapitel untersucht den Westbau von Heinrich Hübsch im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts. Es analysiert die Rolle des Historismus und des neuromantischen Stils in der Gestaltung des Westwerks. Die Arbeit analysiert die Symbolik und die Ikonografie im Skulpturenprogramm sowie den Einfluss der Herrscher (König Ludwig I) und der Gesellschaft auf den Bauprozess. Die Bedeutung des Westbaus als Ausdruck von Macht und Repräsentation wird thematisiert.
5. Vergleich der Westwerke Mainz und Worms mit Speyer: Dieses Kapitel vergleicht das Westwerk des Speyrer Domes mit den Westwerken der Dome in Mainz und Worms. Es analysiert die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Architektur, der Baugeschichte und der Symbolik der drei Bauwerke. Die vergleichende Betrachtung bietet eine breitere Perspektive auf die Entwicklung des romanischen Baustils im Oberrheingebiet und verdeutlicht die individuellen Gestaltungsmerkmale der drei Dome im Kontext ihrer jeweiligen geschichtlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Der Fokus liegt auf Ost- und Westfassaden und der unterschiedlichen Repräsentationsformen.
Schlüsselwörter
Speyrer Dom, Westwerk, Romanik, Heinrich Hübsch, Baugeschichte, Restaurierung, Neumannscher Westbau, Mainz, Worms, Vergleichende Architekturgeschichte, Gesellschaftlicher Kontext, Historismus, Neuromanik, Kaiser, Könige, Bischöfe.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Entwicklung des Westwerks am Speyrer Dom
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Westwerks am Speyrer Dom vom 11. Jahrhundert bis heute. Der Schwerpunkt liegt auf dem Westbau von Heinrich Hübsch und seinem gesellschaftlichen Kontext.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die verschiedenen Bauphasen des Speyrer Dom Westwerks, deren architektonische Besonderheiten, den Vergleich mit den Westwerken der Dome in Mainz und Worms, den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse auf die Baugestaltung, die Rolle bedeutender Architekten und Baumeister sowie die Entwicklung des romanischen Baustils im Kontext der Restaurierungen.
Welche Bauphasen des Speyrer Dom Westwerks werden detailliert beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert vier Hauptbauphasen: den Westbau von Speyer I (1030-1061), den Westbau von Speyer II (1082-1106), den Neumann'schen Westbau (um 1772-1780) und den Westbau von Heinrich Hübsch (1854-57).
Welche Rolle spielt der gesellschaftliche Kontext in der Arbeit?
Der gesellschaftliche und politische Kontext spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht den Einfluss von Kaisern, Königen, Bischöfen und der Gesellschaft auf die Gestaltung und den Bauprozess, insbesondere im Hinblick auf den Westbau von Heinrich Hübsch und den Historismus des 19. Jahrhunderts.
Wie werden die Westwerke von Speyer, Mainz und Worms verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Westwerke der drei Dome hinsichtlich ihrer Architektur, Baugeschichte und Symbolik. Der Vergleich bietet eine breitere Perspektive auf die Entwicklung des romanischen Baustils im Oberrheingebiet und verdeutlicht die individuellen Gestaltungsmerkmale der drei Dome.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Einleitung benennt eine Forschungslücke und die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Entwicklung des Westbaus konzentriert, insbesondere auf den Bau von H. Hübsch und dessen Einbettung in den gesellschaftlichen Kontext.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Speyrer Dom, Westwerk, Romanik, Heinrich Hübsch, Baugeschichte, Restaurierung, Neumannscher Westbau, Mainz, Worms, Vergleichende Architekturgeschichte, Gesellschaftlicher Kontext, Historismus, Neuromanik, Kaiser, Könige, Bischöfe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist deren jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Geschichte des Speyrer Doms, Entwicklung des Westwerks (inkl. detaillierter Beschreibung der vier Bauphasen), dem Westbau von Heinrich Hübsch im gesellschaftlichen Kontext und einem Vergleich der Westwerke von Speyer, Mainz und Worms.
- Quote paper
- Monique Feistel (Author), 2017, Das Westwerk am Dom zu Speyer. Eine Entwicklung vom 11. Jahrhundert bis Heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415679