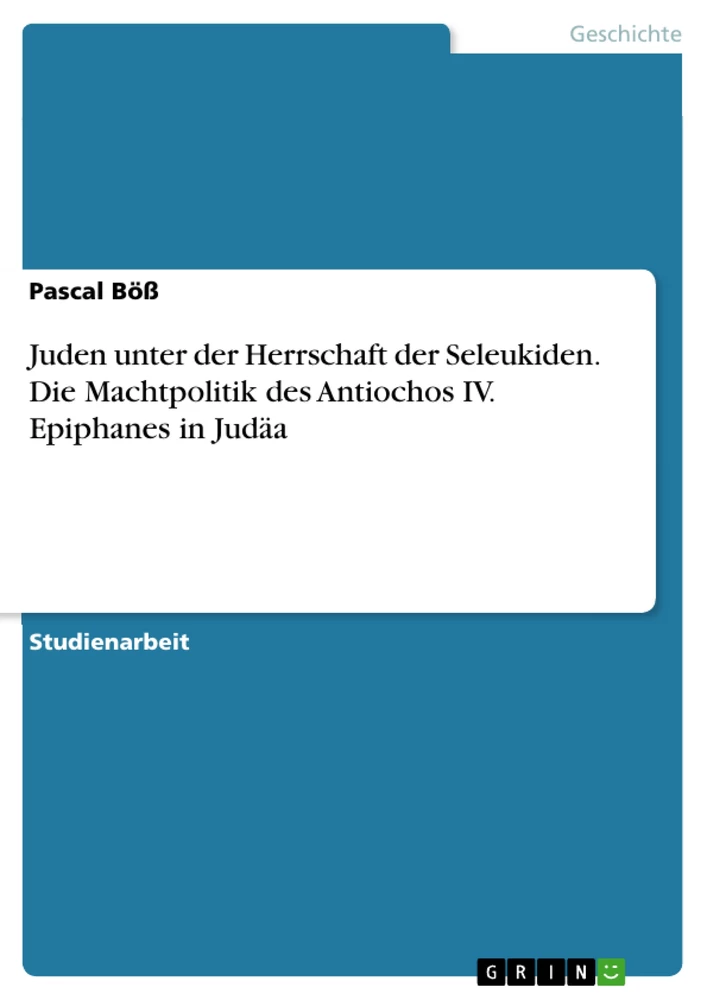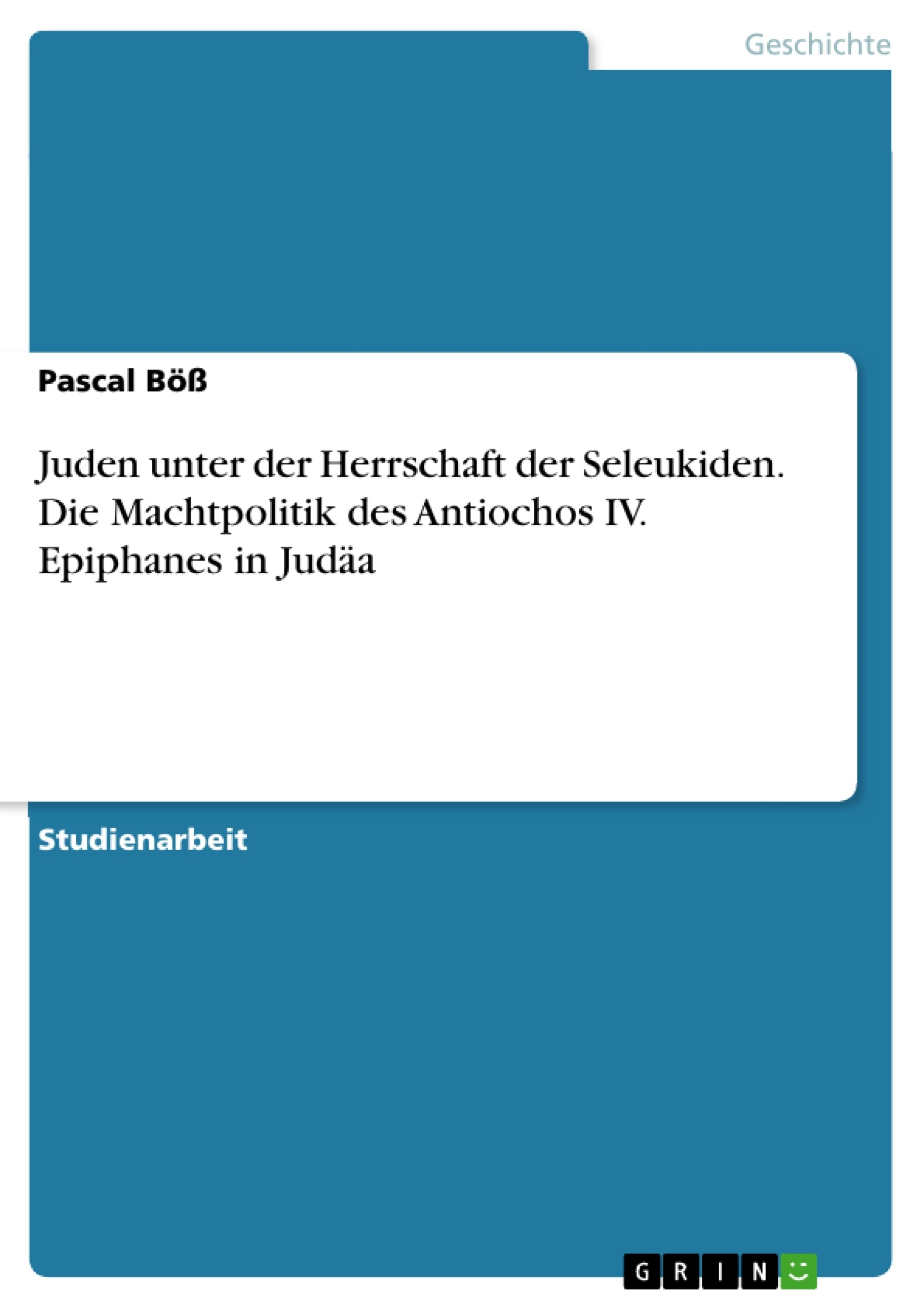„Der einzige jemals unternommene Versuch, den Glauben des Judentums abzuschaffen, [muss] für alle Zeiten denkwürdig bleiben. Denn der Erfolg der Maßnahmen des Epiphanes hätte das Ende des Judentums bedeutet und damit auch die Entstehung von Christentum und Islam unmöglich gemacht“ (Bickermann, 1937).
Die hier von Bickermann aufgeführte These stellt den historischen Sachverhalt des jüdischen Religionsverbots dar, erlassen durch den Seleukidenkönig Antiochos IV. Epiphanes 168 v. Chr. Die Konsequenzen, die dadurch entstanden wären, sind nur allzu gut nachvollziehbar. Vielmehr drängt sich die Intention des Religionsverbotes in den Vordergrund, das der hier ausdrücklich genannte „Epiphanes“ erließ, entgegen der üblichen Herrschaftspraxis der Seleukiden, die auf Fortführung der gegebenen Strukturen, Akzeptanz der lokalen Traditionen zur Zufriedenheit der Bevölkerung und somit zur Stabilität in den Provinzen ausgelegt war. Sein Vater Antiochos III. stärkte nach der Übernahme Judäas noch die jüdische Religion. Jedoch trug dieser maßgeblich zu der Verschärfung zu innerjüdischen Machtkämpfen bei, indem er im römisch-syrischen Krieg geschlagen wurde und im Friedensschluss 188 v. Chr. immense Reparationszahlungen auferlegt bekam, die ihn in den finanziellen Ruin trieben und sich durch die folgenden Generation zogen. Die ständige Geldnot der Seleukiden wirkte sich geradewegs auf Judäa aus, indem die seit dem 3. Jahrhundert intensivierte Rivalität zwischen dem Priestergeschlecht der Oniaden und des Tobiadengeschlechts, dadurch genährt wurde. Während der Herrschaft Antiochos IV. erfolgte ein wahres finanzielles Wettbieten um die Würde des Hohenpriesters, des höchsten Amtes im theokratischen Tempelstaat.
Die Kumulation der Ereignisse führte letztendlich zum Religionsedikt, das nach aktuellem Forschungsstand definitiv nicht als Hellenisierungspolitik angesehen werden kann. In der vorliegenden Arbeit wird der komplexen Problemstellung nachgegangen, inwiefern das Religionsedikt aus der Per- spektive des Seleukidenherrschers ein Missverständnis durch unglückliche Entscheidungen und Ratschläge oder eine kalkulierte, skrupellose Machtpolitik aus rein finanziellem Ansinnen war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hellenisierungseinflüsse in Koilesyrien vor den Seleukiden
- Koilesyrien unter den Seleukiden
- Machtausübung in Judäa unter Antiochos III.
- Innerjüdischer Machtkampf
- Ausgangssituation für Antiochos IV. Epiphanes
- Jason als Hohenpriester
- Verschärfung des innerjüdischen Konfliktes unter Menelaos
- Religionsedikt
- Missverständnis oder skrupellose Machtpolitik?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Religionsverbot, das der Seleukidenkönig Antiochos IV. Epiphanes im Jahr 168 v. Chr. in Judäa erließ. Sie untersucht, ob dieses Verbot eine kalkulierte Machtpolitik oder ein Missverständnis durch unglückliche Entscheidungen und Ratschläge war. Die Arbeit analysiert die hellenistischen Einflüsse in Koilesyrien vor und während der Herrschaft der Seleukiden, den innerjüdischen Machtkampf und die Auswirkungen des Religionsverbots.
- Hellenistische Einflüsse in Koilesyrien vor und während der Seleukidenherrschaft
- Der innerjüdische Machtkampf und die Rolle des Hohepriesters
- Das Religionsverbot von Antiochos IV. Epiphanes und seine Folgen
- Die Intention des Religionsedikts: Machtpolitik oder Missverständnis?
- Die Auswirkungen des Religionsverbots auf die jüdische Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Religionsverbot von Antiochos IV. Epiphanes als historisches Ereignis dar, dessen Folgen tiefgreifend waren. Es werden die möglichen Konsequenzen des Verbots und die Intention des Seleukidenherrschers beleuchtet. Die Einleitung führt außerdem in die komplexe Problemstellung der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage: War das Religionsverbot eine gezielte Machtpolitik oder ein Missverständnis?
Hellenisierungseinflüsse in Koilesyrien vor den Seleukiden
Dieses Kapitel befasst sich mit den hellenistischen Einflüssen in Koilesyrien vor der Herrschaft der Seleukiden. Es wird der Austausch zwischen der griechischen Kultur und den Kulturen der Levanteküste untersucht, der bereits vor dem Alexanderzug bestand und nach der Eroberung Alexanders stark zunahm.
Koilesyrien unter den Seleukiden
Dieses Kapitel beschreibt die Machtpolitik der Seleukiden in Koilesyrien, insbesondere in Judäa. Es werden die Machtausübung unter Antiochos III. und die inneren Machtkämpfe innerhalb des jüdischen Volkes beleuchtet, die durch die finanzielle Notlage der Seleukiden verschärft wurden.
Missverständnis oder skrupellose Machtpolitik?
Dieses Kapitel geht detailliert auf die Intention des Religionsedikts von Antiochos IV. Epiphanes ein. Es werden Argumente für und gegen die These einer kalkulierten Machtpolitik sowie eines Missverständnisses durch unglückliche Entscheidungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Hellenisierung, Judentum, Seleukiden, Antiochos IV. Epiphanes, Religionsverbot, innerjüdischer Machtkampf, Machtpolitik, Missverständnis, Koilesyrien, Judäa, Hohenpriester, Finanzielle Notlage, und die Makkabäerbücher.
- Quote paper
- Pascal Böß (Author), 2017, Juden unter der Herrschaft der Seleukiden. Die Machtpolitik des Antiochos IV. Epiphanes in Judäa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415660