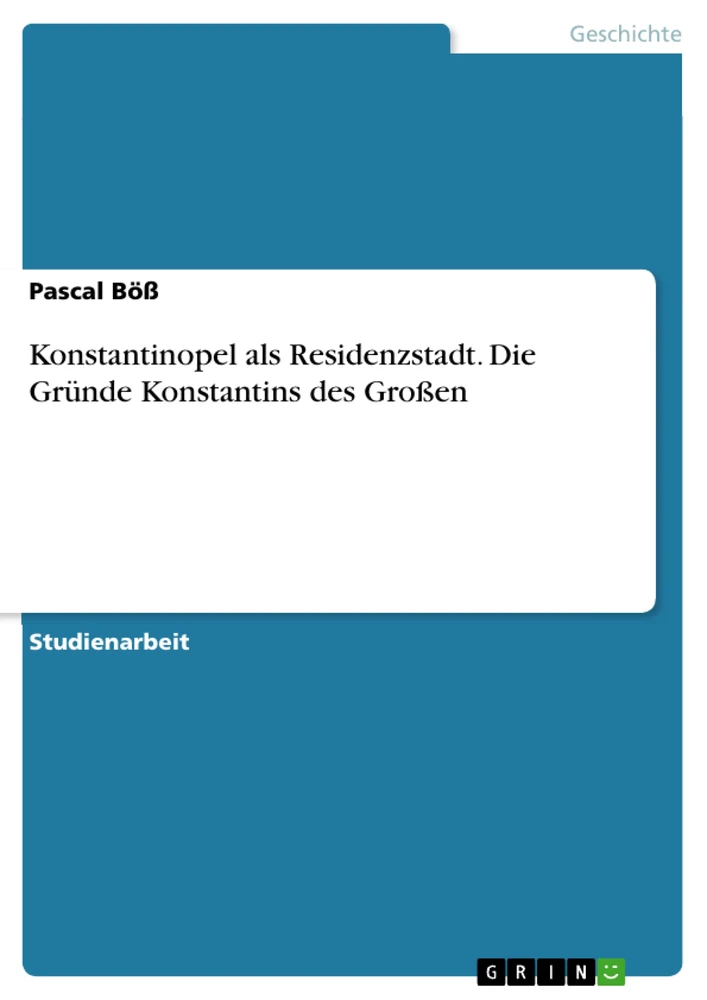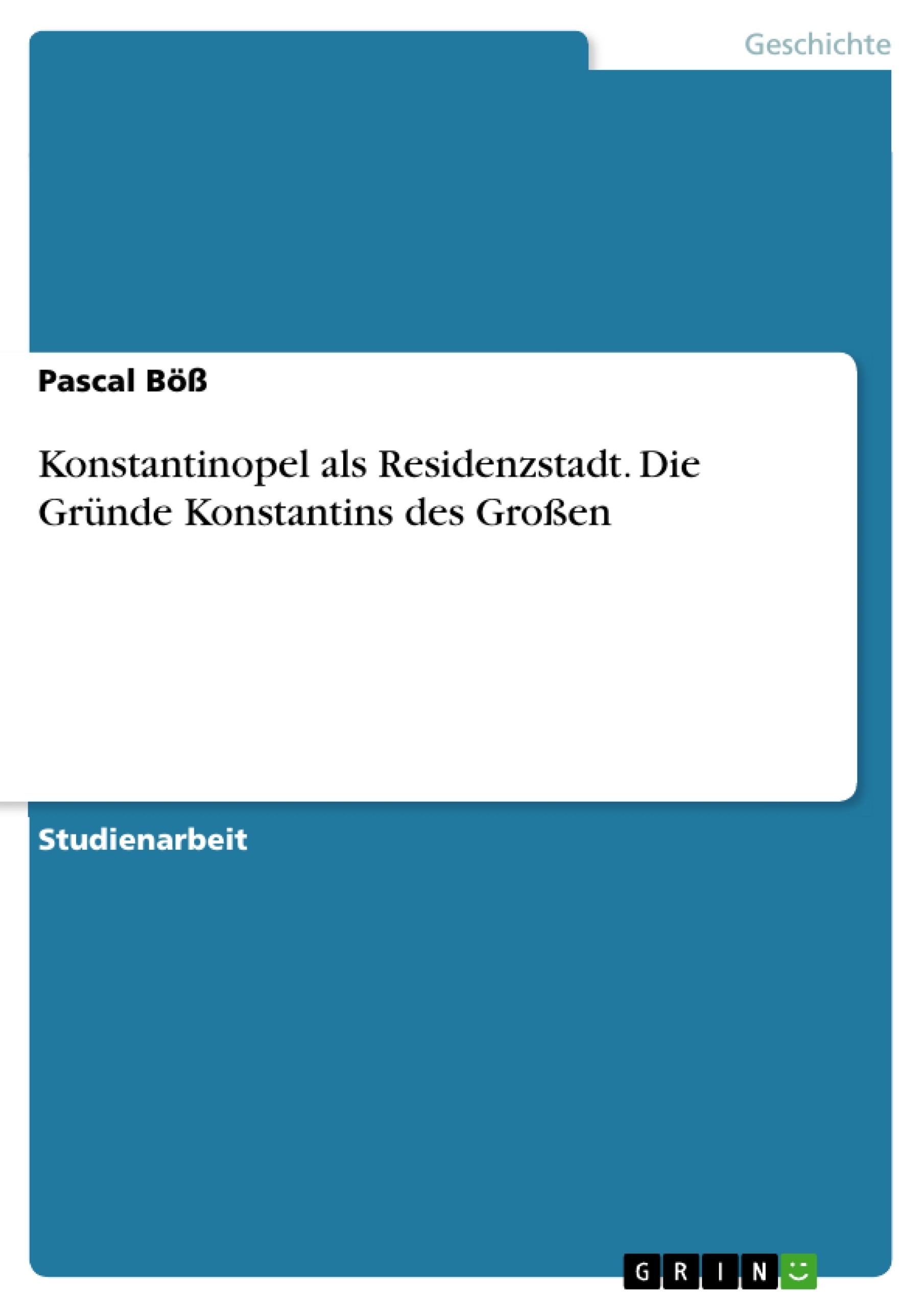Der erste christliche Kaiser der Geschichte, Konstantin der Große, gründete 324 n. Chr. Konstantinopel auf dem Boden des ehemaligen Byzantion. In der aktuellen Forschung wird diese Jahreszahl vorwiegend angegeben, wobei es nicht eindeutig zu belegen ist. Sicher ist, dass Konstantin in dem genannten Jahr Licinius, seinen letzten Konkurrenten um die Alleinherrschaft im Römischen Reich, besiegt hatte. In der Forschung existieren zu der entscheidenden Schlacht zwei unterschiedliche Ansichten. Zum einen soll, nach Alföldi, Licinius in einer Seeschlacht vor Chrysopolis im Bosporus, in Sichtweite zu Byzantion besiegt worden sein. Piepenbruck schreibt dagegen in ihrem Aufsatz, dass Licinius sich in der Stadt verschanzt haben soll. Wesentlich ist, dass dagegen Einigkeit darin herrscht, dass er im Anschluss an der Stelle seines entscheidenden Sieges der Stadt seinen eigenen Namen gab, ganz nach der Tradition griechisch-römischer Herrscher. In unterschiedlichen Quellen wird aufgeführt, dass Konstantinopel nicht die allererste Wahl Konstantins war. Vielmehr zog er mehrere Stellen im oströmischen Teil des Reiches in Erwägung, beispielsweise Thessalonike, Chalkedon oder auch die Gegend in der Nähe vonTroja. Seine erste Entscheidung fiel auf die letztgenannte Möglichkeit, die er vermutlich auch aufgrund der ideologischen Bedeutung auserwählte. Denn Aeneas, der mythische Urahne aller Römer, stammte aus Troja. Sowohl in christlichen als auch in heidnischen Quellen wird geschrieben, dass er dort schon begonnen hatte zu bauen, bis er seine Meinung änderte und sich gen Byzantion, der Stadt am Goldenen Horn, wandte. Die Gründe für diesen Entschluss gehen in den christlichen und heidnischen Quellen auseinander. In manchen christlichen Quellen soll Konstantin durch Gott geführt worden sein. Während beispielsweise der heidnische Autor Zosimus in seinem Werk einen geo-strategischen Grund anführt, der die Lage des ehemaligen Byzantion hervorhob. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Gründen auseinander, die zu Konstantins Entscheidung beigetragen haben und ob diese tatsächlich so einfältig dargestellt werden
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zosimus
- III. Gründe für Konstantin
- III.1 Mögliche religiöse Gründe
- III.2 Repräsentation Konstantins
- III.3 Geographische Gegebenheiten
- III.4 Politisch-Strategische Vorteile
- III.5 Wirtschaftliche Interessen
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für die Gründung Konstantinopels durch Kaiser Konstantin den Großen im Jahr 324 n. Chr. Sie analysiert verschiedene antike Quellen, insbesondere das Werk des spätantiken Historikers Zosimus, und setzt diese in den Kontext der aktuellen Forschung. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der verschiedenen Faktoren zu liefern, die zu Konstantins Entscheidung beigetragen haben.
- Die Rolle religiöser Überzeugungen bei der Standortwahl
- Die Bedeutung der geographischen Lage und strategischen Vorteile
- Die Darstellung Konstantins als Herrscher und seine Repräsentation
- Die wirtschaftlichen Interessen und Überlegungen
- Die Analyse der Quellenlage und die Bewertung der Glaubwürdigkeit antiker Berichte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gründung Konstantinopels ein und stellt die Forschungsfrage nach den Motiven Konstantins vor. Sie beleuchtet die divergierenden Ansichten zur entscheidenden Schlacht gegen Licinius und erwähnt Konstantins anfängliche Erwägungen anderer Standorte, bevor er sich für Byzantion entschied. Die Einleitung hebt die unterschiedlichen Interpretationen in christlichen und heidnischen Quellen hervor und skizziert den Ansatz der Arbeit, welcher auf Zosimus' Bericht aufbaut und diesen mit anderen Quellen und der modernen Forschung konfrontiert.
II. Zosimus: Dieses Kapitel charakterisiert den spätantiken Historiker Zosimus, einen gebildeten Nichtchristen. Es beleuchtet die spärlichen Informationen über sein Leben und die Herausforderungen bei der Datierung seines Werkes, der „Historia Nea“. Das Kapitel analysiert Zosimus' Methode, seine chronologischen Ungenauigkeiten und den Fokus seines Werkes auf den Untergang Roms, welcher aus seiner Sicht mit dem Aufstieg des Christentums verbunden ist. Zosimus’ ambivalente Haltung zum Christentum und seine Zugehörigkeit zum Neoplatonismus werden ebenfalls diskutiert, um seine Perspektive und mögliche Beeinflussung seiner Geschichtsschreibung zu verstehen. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, Zosimus' Bericht kritisch im Licht der modernen Forschung zu prüfen.
III. Gründe für Konstantin: Dieses Kapitel erörtert die vielfältigen Gründe für Konstantins Entscheidung, Byzantion zum neuen Rom zu machen. Es präsentiert verschiedene antike Deutungen, sowohl christliche als auch heidnische, und diskutiert diese im Kontext der heutigen Forschung. Das Kapitel differenziert zwischen möglichen religiösen Motiven, der Bedeutung der Repräsentation Konstantins als Herrscher, den geographischen Gegebenheiten, den politisch-strategischen Vorteilen des Standortes und den wirtschaftlichen Interessen. Es analysiert die verschiedenen Aspekte und versucht, ein umfassendes Bild der komplexen Entscheidungsfindung Konstantins zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Konstantinopel, Konstantin der Große, Byzantion, Stadtgründung, Spätantike, Zosimus, religiöse Motive, geographische Lage, strategische Vorteile, wirtschaftliche Interessen, hellenistische Tradition, römisches Reich, christliches Reich, Heidentum, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Gründung Konstantinopels
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gründe für die Gründung Konstantinopels durch Kaiser Konstantin den Großen im Jahr 324 n. Chr. Sie analysiert verschiedene antike Quellen, insbesondere das Werk des spätantiken Historikers Zosimus, und setzt diese in den Kontext der aktuellen Forschung. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der verschiedenen Faktoren zu liefern, die zu Konstantins Entscheidung beigetragen haben.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf antike Quellen, insbesondere auf die „Historia Nea“ des spätantiken Historikers Zosimus. Sie berücksichtigt aber auch andere christliche und heidnische Quellen und setzt diese in den Kontext der modernen Forschung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Rolle religiöser Überzeugungen bei der Standortwahl, die Bedeutung der geographischen Lage und strategischen Vorteile, die Darstellung Konstantins als Herrscher und seine Repräsentation, die wirtschaftlichen Interessen und Überlegungen, sowie die Analyse der Quellenlage und die Bewertung der Glaubwürdigkeit antiker Berichte.
Wer war Zosimus und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Zosimus war ein spätantiker, gebildeter nicht-christlicher Historiker. Die Arbeit analysiert seine Methode, seine chronologischen Ungenauigkeiten und den Fokus seines Werkes auf den Untergang Roms, den er mit dem Aufstieg des Christentums verbindet. Seine ambivalente Haltung zum Christentum und seine Zugehörigkeit zum Neoplatonismus werden diskutiert, um seine Perspektive und mögliche Beeinflussung seiner Geschichtsschreibung zu verstehen. Seine Darstellung wird kritisch im Licht der modernen Forschung geprüft.
Welche Gründe für die Gründung Konstantinopels werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene mögliche Gründe, darunter religiöse Motive, die Bedeutung der Repräsentation Konstantins, die geographischen Gegebenheiten, politisch-strategische Vorteile und wirtschaftliche Interessen. Sie versucht, ein umfassendes Bild der komplexen Entscheidungsfindung Konstantins zu zeichnen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Zosimus, Gründe für Konstantin und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Ansatz der Arbeit vor. Das Kapitel über Zosimus analysiert den Historiker und seine Quellen. Das Kapitel „Gründe für Konstantin“ erörtert die verschiedenen Motive für die Stadtgründung. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konstantinopel, Konstantin der Große, Byzantion, Stadtgründung, Spätantike, Zosimus, religiöse Motive, geographische Lage, strategische Vorteile, wirtschaftliche Interessen, hellenistische Tradition, römisches Reich, christliches Reich, Heidentum, Quellenkritik.
- Quote paper
- Pascal Böß (Author), 2014, Konstantinopel als Residenzstadt. Die Gründe Konstantins des Großen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415647