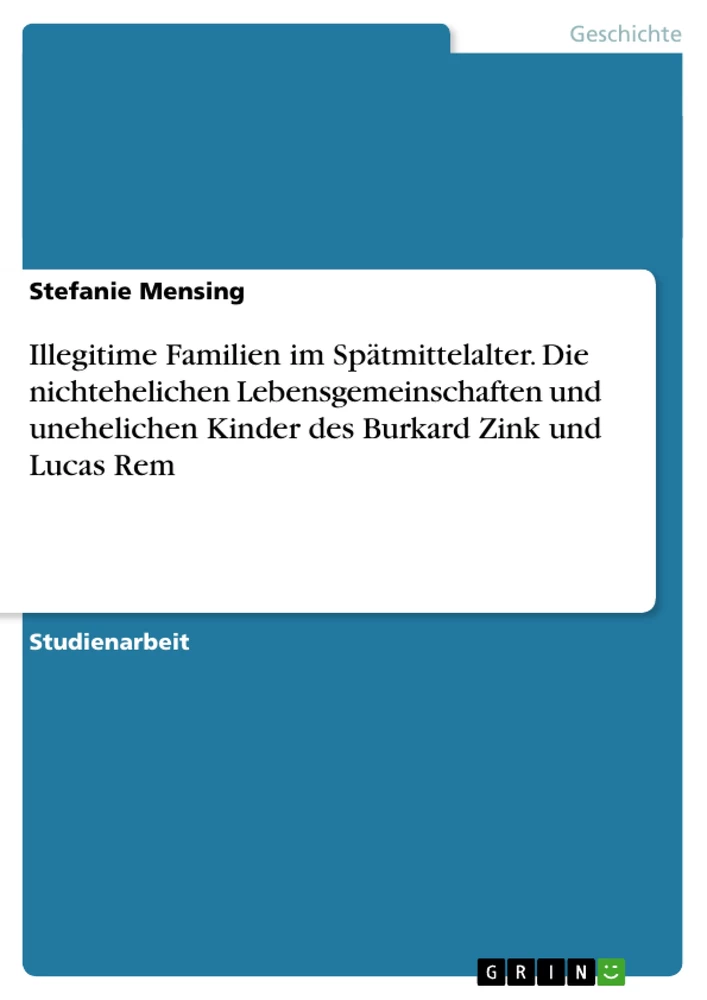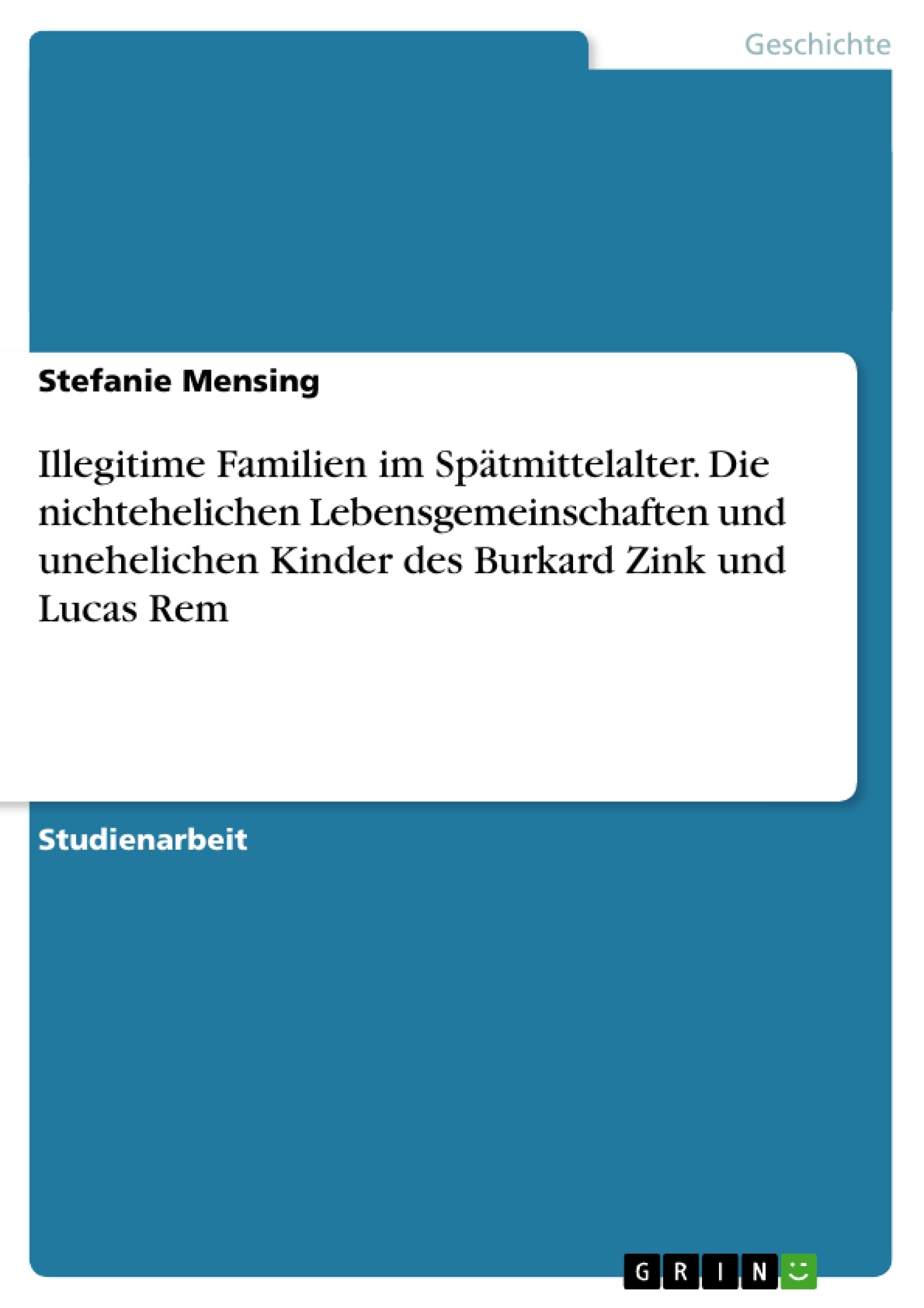„also bedacht ich mich, daß ich so ellendclich lebent und in sünden (...); das verdroß mich und wolt sein nit mer.“
Was den Augsburger Kaufmann Burkard Zink im Jahre 1454 so verdross, war eine damals wie heute bestehende partnerschaftliche Lebensform: das Konkubinat, also die „nichteheliche Lebensgemeinschaft“. Aus dieser gingen, damals wie heute, ebenso Kinder hervor wie aus rechtsgültigen Ehen. Während die sogenannte „wilde Ehe“ heute kaum mehr Anstoß erregt und die unehelich geborenen Kinder den ehelichen (erst!) seit 1997 rechtlich vollständig gleichgestellt sind, spielte der illegitime Status der elterlichen Beziehung im Mittelalter eine entscheidende Rolle nicht nur für das Leben der Kinder, sondern auch für das der Väter: von diesen zwar anerkannt, aber doch ausgegrenzt aus der „legitimen“ Gesellschaft, lebten die Kinder in einem Spannungsverhältnis zwischen sittlicher Norm und gesellschaftlicher Praxis, das sich zu betrachten lohnt. Um diese „illegitimen“, auch „natürliche“ oder „ledige“ Kinder genannt, soll es in der vorliegenden Arbeit unter folgender Leitfrage gehen:
Welche Bedeutung hatten die unehelichen Kinder und deren Mütter für den Mann im späten Mittelalter?
Im Rahmen dieser Fragestellung tauchen folgende Unterfragen auf:
Waren die Kinder nur notwendig in Kauf genommenes Übel der fehlenden (sicheren) Verhütungsmethoden oder hatten sie einen Platz im Leben des Vaters? Wie kam es überhaupt zum Konkubinat? Warum ist die eine Frau es wert, geheiratet zu werden, während der anderen, wenn sie nicht alleine leben will, nur die Lebensform der Konkubine bleibt?
Ich werde mich bei der Behandlung des Themas, analog zu den gewählten Quellen, ausschließlich mit den Gegebenheiten in der deutschen Stadt des Spätmittelalters beschäftigen, wobei das Konkubinat lediglich als voreheliches, so wie es die beiden zu betrachtenden Männer lebten, behandelt wird. Den Bereich des Ehebruchs lasse ich bewusst außen vor, da er im Zusammenhang mit den ausgewählten Quellen, die ich im Folgenden beschreiben und begründen werde, keine Rolle spielt.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Einleitung: Gegenstand und Fragestellung der schriftlichen Hausarbeit sowie die methodischen Schritte ihrer Anfertigung
- 1.1. Fragestellung und Eingrenzung des Themas
- 1.2. Quellen und Literaturauswahl
- 1.3. Methodisches Vorgehen
- 2.0. Hauptteil: Nichteheliche Lebensgemeinschaften und uneheliche Kinder im späten Mittelalter
- 2.1. Das Konkubinat im Spätmittelalter:
- 2.1.1. Rechtliche Verhältnisse und sittliche Norm vs. gesellschaftliche Praxis
- 2.1.2. Quantitative Aspekte der Illegitimität
- 2.2. Die betroffenen Personen:
- 2.2.1. Die „natürlichen“ Kinder - Das Los der ständischen Geburt
- 2.2.2. Die Eltern
- 2.2.2.1. Heirat vs. Konkubinat - Mögliche Gründe für den Verzicht auf Ehe
- 2.2.2.2. Die Mütter - Alleinstehende Frauen und ihre Stellung in der spätmittelalterlichen Stadt
- 2.2.2.3. Die Väter - Verantwortlichkeiten und emotionale Aspekte
- 3.0. Schluss: Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung unehelicher Kinder und ihrer Mütter für Männer im späten Mittelalter, anhand der Lebensbeschreibungen der Augsburger Kaufleute Burkard Zink und Lucas Rem. Die Arbeit konzentriert sich auf die gesellschaftliche Praxis des Konkubinats und dessen Auswirkungen auf die Beteiligten.
- Das Konkubinat im späten Mittelalter: Rechtliche und gesellschaftliche Aspekte
- Quantitative Betrachtung der Illegitimität im untersuchten Zeitraum und Kontext
- Die soziale Stellung unehelicher Kinder und deren Umgang mit der gesellschaftlichen Norm
- Die Rolle der Mütter unehelicher Kinder in der spätmittelalterlichen Stadt
- Verantwortung und emotionale Bindung der Väter zu ihren unehelichen Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
1.0. Einleitung: Gegenstand und Fragestellung der schriftlichen Hausarbeit sowie die methodischen Schritte ihrer Anfertigung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und definiert die Forschungsfrage: Welche Bedeutung hatten uneheliche Kinder und deren Mütter für den Mann im späten Mittelalter? Sie grenzt das Thema ein, indem sie sich auf die deutsche Stadt des Spätmittelalters und das Konkubinat als voreheliche Lebensform konzentriert. Die Auswahl der Quellen (die Lebensbeschreibungen von Burkard Zink und Lucas Rem) und die methodische Vorgehensweise werden ebenfalls erläutert, wobei die Konzentration auf die Analyse der Quellen im Kapitel 2.2.2 hervorgehoben wird.
2.0. Hauptteil: Nichteheliche Lebensgemeinschaften und uneheliche Kinder im späten Mittelalter: Dieser Hauptteil bildet den Kern der Arbeit und untersucht nichteheliche Lebensgemeinschaften und uneheliche Kinder im Spätmittelalter. Er beleuchtet das Konkubinat, seine rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte sowie quantitative Daten zur Illegitimität. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung der Betroffenen: der unehelichen Kinder und ihrer Eltern. Hierbei wird die soziale Stellung der Kinder, die Situation alleinstehender Mütter in der Stadt und die Verantwortung sowie die emotionalen Bindungen der Väter analysiert.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Nichteheliche Lebensgemeinschaften und uneheliche Kinder im späten Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung unehelicher Kinder und ihrer Mütter für Männer im späten Mittelalter, anhand der Lebensbeschreibungen der Augsburger Kaufleute Burkard Zink und Lucas Rem. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Praxis des Konkubinats und dessen Auswirkungen auf die Beteiligten.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Bedeutung hatten uneheliche Kinder und deren Mütter für den Mann im späten Mittelalter?
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Lebensbeschreibungen der Augsburger Kaufleute Burkard Zink und Lucas Rem.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung definiert die Forschungsfrage, grenzt das Thema ein und beschreibt die methodische Vorgehensweise. Der Hauptteil untersucht das Konkubinat im Spätmittelalter, beleuchtet rechtliche und gesellschaftliche Aspekte, betrachtet quantitative Daten zur Illegitimität und analysiert die soziale Stellung unehelicher Kinder sowie die Situation ihrer Eltern (Mütter und Väter).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schwerpunkten: Konkubinat im Spätmittelalter (rechtliche und gesellschaftliche Aspekte), quantitative Betrachtung der Illegitimität, soziale Stellung unehelicher Kinder, Rolle der Mütter unehelicher Kinder in der spätmittelalterlichen Stadt, Verantwortung und emotionale Bindung der Väter zu ihren unehelichen Kindern.
Welche Aspekte des Konkubinats werden untersucht?
Die Untersuchung des Konkubinats umfasst rechtliche Verhältnisse und sittliche Normen im Vergleich zur gesellschaftlichen Praxis, sowie quantitative Aspekte der Illegitimität.
Wie wird die soziale Stellung unehelicher Kinder betrachtet?
Die Arbeit analysiert die soziale Stellung unehelicher Kinder im Kontext ihrer ständischen Geburt und ihres Umgangs mit gesellschaftlichen Normen.
Welche Rolle spielen die Mütter unehelicher Kinder?
Die Arbeit untersucht die Situation alleinstehender Mütter in der spätmittelalterlichen Stadt und deren Stellung in der Gesellschaft.
Wie wird die Rolle der Väter beleuchtet?
Die Untersuchung analysiert die Verantwortlichkeiten und emotionalen Aspekte der Väter gegenüber ihren unehelichen Kindern.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein abschließendes Urteil.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Der methodische Ansatz konzentriert sich auf die detaillierte Analyse der ausgewählten Quellen (Lebensbeschreibungen von Burkard Zink und Lucas Rem), insbesondere im Kapitel 2.2.2.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Mensing (Autor:in), 2004, Illegitime Familien im Spätmittelalter. Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften und unehelichen Kinder des Burkard Zink und Lucas Rem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41550