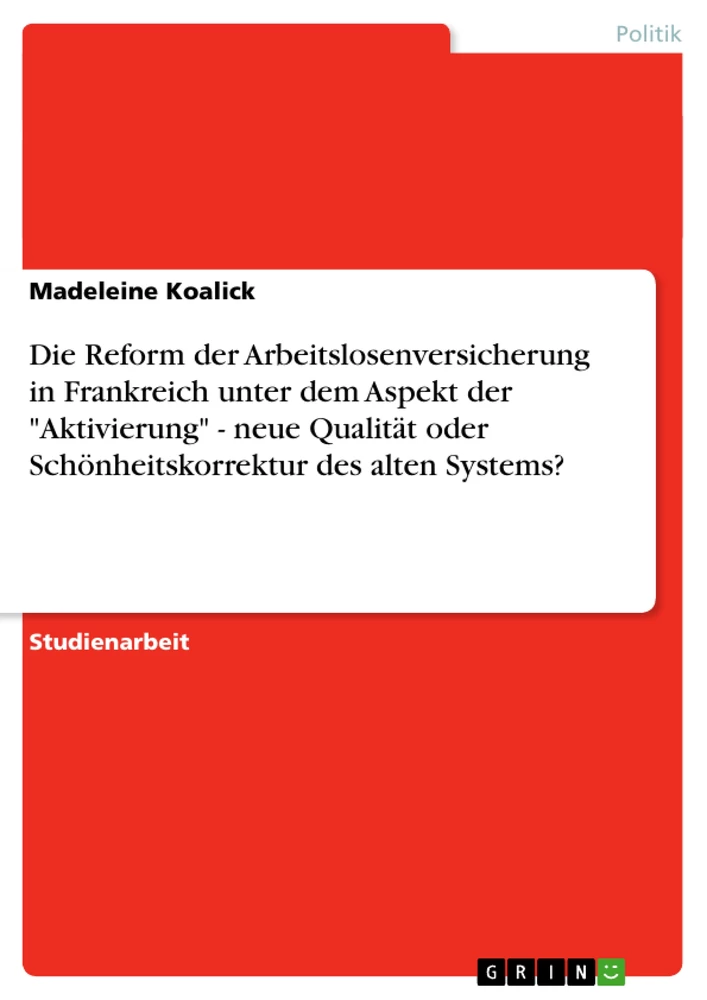Im Zuge der Globalisierung und des zunehmenden Anpassungsdrucks, dem die Systeme der Sozialen Sicherung im Prozess der Europäischen Integration ausgesetzt sind, wendet sich die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung verstärkt Fragen der Konvergenz und Divergenz innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft zu. In diesem Zusammenhang wird zunehmend eine „Aktivierung“ der Systeme der sozialen Sicherung bemerkt. Besonders im Bereich der Arbeitslosenversicherung dominieren normativ aufgeladene Schlagwörter, wie Eigenverantwortung, „Employability“, „workfare“ oder Slogans wie „make work pay“ den internationalen Diskurs. Im Mittelpunkt dieser Aktivierungsdiskussion steht oft die Suche nach einer neuen Balance zwischen Rechten und Pflichten der arbeitslosen Leistungsempfänger. In vielen Ländern fanden oder finden Reformen statt, bei denen die Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln und Sanktionen, die Absenkung der Leistungen, verstärkte Fördermaßnahmen oder eine verstärkte Konditionalität zwischen Leistungsempfang und Eingliederung in den Arbeitsmarkt im Vordergrund stehen. Zunehmend schwinden die Grenzen zwischen Beschäftigungs-, Sozial- und Steuerpolitik. Vielfach werden Wege fern der traditionellen Systemlogik betreten. So sind Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik oft zu einem Substitut oder wenigstens einer Bedingung für passive Leistungen geworden.
Diese Reformprozesse unterliegen einer im internationalen Vergleich gemeinsamen Dynamik, aber einer von Land zu Land variierenden Logik (Barbier 2002, 308). Dänemark und Großbritannien werden immer wieder als erfolgreiche Vorbilder divergierender Strategien im Bereich der Aktivierung präsentiert (Vgl. Tietz 2005, 32). Doch auch in unserem Nachbarland Frankreich fanden in den letzten Jahren Reformprozesse in der Arbeitslosenversicherung statt, die sich unter dem Gesichtspunkt der „Aktivierung“ betrachten lassen. Frankreich, welches vielfach als reformunfähig und als der unbeweglichste unter den Wohlfahrtsstaaten eingestuft wird (Palier 2001, 52), wird von der vergleichenden Forschung aufgrund der Komplexität seines Systems als schwerzugänglicher Sonderfall oft vernachlässigt. Daher ist es besonders interessant, die dortigen Reformprozesse anhand analytischer Konzepte vergleichend einzuordnen. Hierbei stellt sich die Frage, wie einschneidend die Veränderungen der letzten Jahre sind und in welchem Ausmaß, im europäischen Vergleich, „Aktivierung“ eine Rolle spielte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept des Paradigmenwechsels nach Peter Hall
- Zwischen Liberalismus und Universalismus – Dänemark und Großbritannien als Modelle divergierender Aktivierungsstrategien
- Die Reformprozesse der Arbeitslosenversicherung in Frankreich – Schönheitskorrektur oder Paradigmenwechsel?
- Kontinuität und Wandel – die Arbeitslosenversicherung bis 1997
- Neue Wege in der Aktivierung – Reformprozesse unter der Regierung Jospin
- Intensivierung der neuen Logik – aktuelle Maßnahmen unter der Regierung Raffarin
- Frankreich Arbeitslosensicherung zwischen Kontinuität und Wandel – Paradigmenwechsel durch verstärkte Aktivierung?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reformprozesse der französischen Arbeitslosenversicherung im Kontext der europäischen Aktivierungsdebatte. Sie analysiert, ob diese Reformen einen Paradigmenwechsel darstellen oder lediglich Schönheitskorrekturen sind. Hierzu werden das Konzept des Paradigmenwechsels nach Hall und das Aktivierungsmodell nach Barbier herangezogen, wobei Dänemark und Großbritannien als Vergleichsmodelle dienen.
- Analyse der Reformen der französischen Arbeitslosenversicherung
- Anwendung des Paradigmenwechsel-Konzepts nach Hall auf die französischen Reformen
- Vergleich der französischen Aktivierungsstrategie mit den Modellen Dänemarks und Großbritanniens
- Untersuchung der Rolle von Kontinuität und Wandel in den Reformen
- Bewertung des Ausmaßes des Paradigmenwechsels in der französischen Arbeitslosenversicherung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Aktivierung im Kontext der europäischen Integration und der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung ein. Sie beschreibt den wachsenden Fokus auf Eigenverantwortung und die Verschärfung von Zumutbarkeitsregeln in vielen Ländern. Die Arbeit konzentriert sich auf Frankreich als einen oft vernachlässigten Fall, um die dortigen Reformen im Kontext eines möglichen Paradigmenwechsels zu analysieren. Die methodische Vorgehensweise wird skizziert, wobei die Konzepte von Hall und Barbier zentrale Rollen spielen.
2. Das Konzept des Paradigmenwechsels nach Peter Hall: Dieses Kapitel präsentiert Halls Konzept des Policy Change, das drei Intensitätsgrade des Politikwandels unterscheidet. Es wird detailliert erläutert, wie Hall anhand von Zielen, Instrumenten und deren Ausgestaltung zwischen einfachem Lernprozess und tiefgreifenden Transformationen (Paradigmenwechseln) unterscheidet. Der Fokus liegt auf den Kriterien, die für die Identifizierung eines Paradigmenwechsels relevant sind, inklusive der Rolle von Anomalien, alternativen Paradigmen und der Machtverteilung.
3. Zwischen Liberalismus und Universalismus – Dänemark und Großbritannien als Modelle divergierender Aktivierungsstrategien: Dieses Kapitel stellt Barbiers Konzept der Aktivierung vor, das die sich verändernde Beziehung zwischen sozialen Schutzmechanismen, Leistungsbezug und Erwerbsarbeit beschreibt. Es identifiziert zwei polare Aktivierungsregime – das liberale und das universalistisch-sozialdemokratische – und präsentiert Dänemark und Großbritannien als exemplarische Fälle dieser Regime. Die Kapitel erläutert, wie Barbier anhand des Zusammenspiels von passiven Leistungen, aktiver Arbeitsmarktpolitik und der Interaktion zwischen Steuer- und Sozialpolitik die verschiedenen Aktivierungsmodelle unterscheidet.
Schlüsselwörter
Aktivierung, Arbeitslosenversicherung, Frankreich, Paradigmenwechsel, Policy Change, Hall, Barbier, Dänemark, Großbritannien, Liberalismus, Universalismus, Wohlfahrtsstaat, Europäische Integration, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Kontinuität, Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Reformprozesse der französischen Arbeitslosenversicherung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Reformprozesse der französischen Arbeitslosenversicherung im Kontext der europäischen Aktivierungsdebatte. Sie untersucht, ob diese Reformen einen Paradigmenwechsel darstellen oder lediglich oberflächliche Änderungen sind.
Welche Konzepte werden angewendet?
Die Arbeit verwendet das Konzept des Paradigmenwechsels nach Peter Hall und das Aktivierungsmodell nach Barbier. Dänemark und Großbritannien dienen als Vergleichsmodelle für divergierende Aktivierungsstrategien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Paradigmenwechsel nach Hall, ein Kapitel zum Vergleich der Aktivierungsstrategien in Dänemark und Großbritannien, ein Kapitel zur Analyse der französischen Arbeitslosenversicherungsreformen und ein Fazit.
Wie werden die französischen Reformen analysiert?
Die Analyse der französischen Reformen umfasst eine Betrachtung der Kontinuitäten und Veränderungen im System, eine Anwendung des Paradigmenwechsel-Konzepts nach Hall und einen Vergleich mit den Modellen Dänemarks und Großbritanniens. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die Reformen einen tiefgreifenden Wandel (Paradigmenwechsel) darstellen.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentralen Forschungsfragen betreffen die Identifizierung des Ausmaßes des Wandels in der französischen Arbeitslosenversicherung, die Bewertung, ob dieser Wandel einen Paradigmenwechsel darstellt und die Einordnung der französischen Strategie im Vergleich zu anderen europäischen Modellen.
Welche Rolle spielen Dänemark und Großbritannien?
Dänemark und Großbritannien werden als Vergleichsmodelle herangezogen, um die französische Aktivierungsstrategie im Kontext liberaler und universalistisch-sozialdemokratischer Regime einzuordnen. Sie repräsentieren polare Aktivierungsmodelle, die im Vergleich mit Frankreich Aufschluss über die Art und das Ausmaß des Wandels geben.
Was sind die Schlüsselbegriffe der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Aktivierung, Arbeitslosenversicherung, Frankreich, Paradigmenwechsel, Policy Change, Hall, Barbier, Dänemark, Großbritannien, Liberalismus, Universalismus, Wohlfahrtsstaat, Europäische Integration, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Kontinuität und Wandel.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit nutzt die Konzepte von Hall und Barbier zur Analyse der französischen Reformen. Ein Vergleich mit Dänemark und Großbritannien ermöglicht die Einordnung der französischen Entwicklung im Kontext divergierender Aktivierungsstrategien.
- Arbeit zitieren
- Madeleine Koalick (Autor:in), 2005, Die Reform der Arbeitslosenversicherung in Frankreich unter dem Aspekt der "Aktivierung" - neue Qualität oder Schönheitskorrektur des alten Systems?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41449