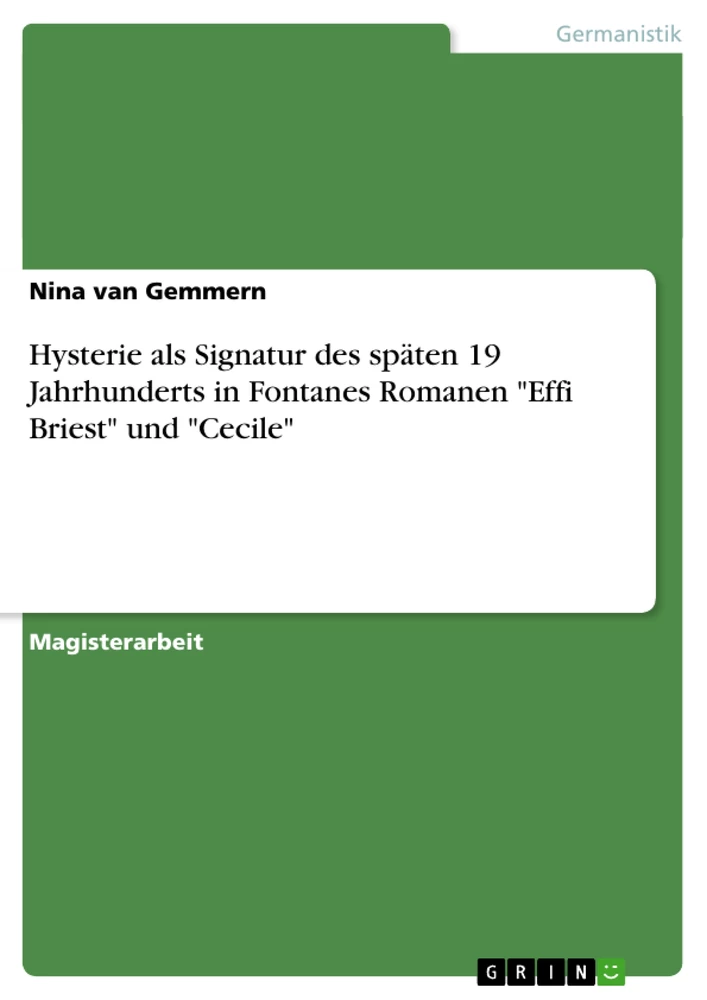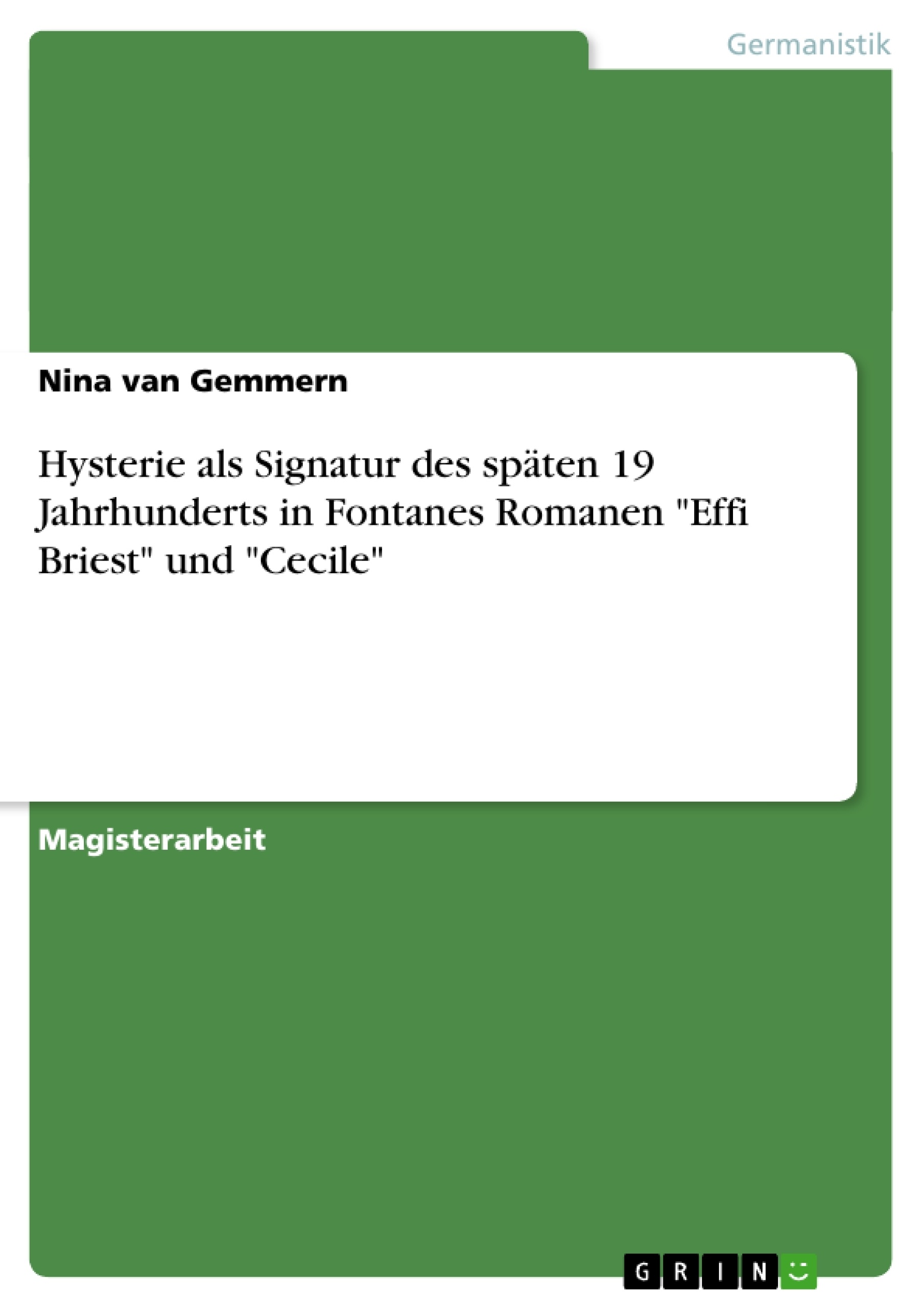„[...] Wie ein Quecksilberkügelchen läßt sie (die Hysterie) sich nicht fangen. Wo immer sie auftaucht, übernimmt sie die Färbung der umgebenden Kultur und der Sitten; und somit zeigt sie sich im Laufe der Jahrhunderte als ein ständig sich verstellendes, sich veränderndes, im Nebel verhülltes Phänomen, welches trotzdem so behandelt wird, wie wenn es definierbar und greifbar wäre [...].“
Nach dem Lexikon der Psychologie ist die „[...] Hysterie eine zweckgerichtete psychogenen Erkrankung mit seelischen und/oder körperlichen Symptomen als Reaktion auf emotional stark belastende Erlebnisse, die infolge einer angeborenen Disposition nicht normal verarbeitet werden. Symptome der Hysterie, die nicht notwendigerweise zusammen vorkommen müssen, sind Dämmerzustände, Wahnvorstellungen, Amnesien, Affektausbrüche mit Wein- oder Schreikrämpfen (ereignen sich stets in Anwesenheit anderer Personen), auch Pseudodemez, Sinnesstörungen (z.B. Blind- oder Taubheit, Anästhesien) Lähmungen, Tremor Tics und motorische Koordinationsstörungen („Vorbeihandeln, Nicht-stehen- oder Nicht-gehen-Können). Die Grenzen zur Simulation sind oft fließend. Behandlung erfolgt durch Milieu- oder Psychotherapie. [...]“
Dass der Zustand der „Hysterie“ meistens auf Frauen projeziert wird, geht auf die Etymologie zurück. Die Bezeichnung „Hysterie“ stammt von dem griechischen Wort Hystera ab. Die Übersetzung lautet Gebärmutter. Der Begriff geht auf den Arzt Hippokrates zurück, der diese, schon in der Antike als typisches Frauenleiden bekannte Krankheit, auf krankhafte Vorgänge im Unterleib zurückführte. Hysterie ist also aus diesen beiden etymologischen Gründen ein weibliches Phänomen. Wer immer über Hysterie schreibt, schreibt deshalb über Weiblichkeit. Kann man aber tatsächlich mit einer solchen Ausschließlichkeit von einem rein weiblichen Phänomen sprechen? Ein Blick auf das andere Geschlecht, auf die Männer, kann eine Antwort geben. Es muss also die Frage gestellt werden, ob es hysterische Männer gibt, oder wie man hysterische Erscheinungen bei Männern deutet. Ein Beispiel für Männer, die hysterische Symptome aufweisen, sind die Soldaten im Ersten Weltkrieg, jene Männer, die ihren Dienst auf dem Schlachtfeld durch unkontrolliertes Zittern verweigerten - organisch war dies nie erklärbar. Diese Kriegszitterer weisen Symptome auf, die als unmännlich betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hysterie im Wandel der Zeit
- 2.1 Hysterie als Ausdruck der unterdrückten Sprache
- III. Der sozio-kulturelle Hintergrund der Hysterie
- 3.1 Die Frau der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- 3.2 Hysterie als Merkmal des wohlhabenden Bürgertums
- IV. Vergleich von Hysterie bei Cécile und Effi Briest
- 4.1 Cécile - Die Wiedergeburt der Hexe?
- 4.2 Céciles Leiden aus Perspektive des Dritten
- 4.3 Ganz Frau - ganz weiblich – ganz krank!
- 4.4 Ein Leben ohne Liebe, oder: Wird im Roman eine Überlebensmöglichkeit aufgezeigt?
- 4.5 Effi Briest - eine moderne, aber dennoch gefallene Frau
- 4.6 Der Anfang vom Ende
- 4.7 Der Ehebruch als Rebellion
- 4.8 Gesellschaftliche Ächtung als Krankheitsursache
- 4.9 Zeigt auch dieser Roman alternative Lebensweisen auf?
- V. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Hysterie als charakteristisches Merkmal weiblicher Figuren im späten 19. Jahrhundert anhand der Romane „Effi Briest“ und „Cécile“ von Theodor Fontane. Ziel ist es, die spezifischen Ausprägungen der Hysterie bei Fontanes Figuren zu analysieren und im Kontext der damaligen medizinischen und gesellschaftlichen Diskurse zu interpretieren. Dabei werden die literaturwissenschaftliche, feministische und psychoanalytische Perspektive berücksichtigt.
- Darstellung von Hysterie in Fontanes Romanen
- Sozio-kultureller Kontext der Hysterie im 19. Jahrhundert
- Vergleich der Darstellung von Hysterie bei Cécile und Effi Briest
- Interpretation der Hysterie als Ausdruck gesellschaftlichen Widerstands
- Analyse der Lösungsansätze Fontanes für seine "kranken" Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hysterie als vielschichtiges und historisch wandelbares Phänomen ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Darstellung von Hysterie bei Fontane und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die literaturwissenschaftliche, feministische und psychoanalytische Ansätze verbindet. Der einleitende Text beschreibt Hysterie als ein Phänomen, dessen Bedeutung und Verständnis sich im Laufe der Zeit stark gewandelt haben, und hebt die besondere Rolle der Frauen in der Diskussion um diese Krankheit hervor. Die Arbeit kündigt an, die Figuren Cécile und Effi Briest im Licht der Schriften von Freud, Charcot und Christina von Braun zu untersuchen.
II. Hysterie im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel erforscht die historische Entwicklung des Hysterie-Konzepts. Es beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen und Deutungen von Hysterie in verschiedenen Epochen und medizinischen Schulen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Hysterie als weibliche Erkrankung und der Frage nach der Existenz und Darstellung von Hysterie bei Männern. Das Kapitel untermauert die Problematik einer eindeutigen Definition von Hysterie und beleuchtet den Übergang von einer rein körperlich-medizinischen Sichtweise hin zu einer stärker psychologischen Betrachtungsweise.
III. Der sozio-kulturelle Hintergrund der Hysterie: Dieses Kapitel untersucht den sozio-kulturellen Kontext, in dem die Hysterie im 19. Jahrhundert auftrat. Es analysiert die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft und die gesellschaftlichen Zwänge, die auf Frauen einwirkten. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Stellung der Frau und dem Auftreten von Hysterie-Symptomen. Es wird die These untersucht, dass Hysterie als Ausdruck unterdrückter Emotionen und eines fehlenden gesellschaftlichen Handlungsspielraums der Frauen verstanden werden kann.
IV. Vergleich von Hysterie bei Cécile und Effi Briest: Dieses Kapitel vergleicht die Darstellung der Hysterie bei den weiblichen Hauptfiguren Cécile und Effi Briest. Es untersucht die individuellen Ausprägungen der Hysterie-Symptome und die jeweiligen Ursachen und Hintergründe. Der Vergleich der beiden Figuren soll zeigen, wie Fontane die Hysterie als Ausdruck von Widerstand gegen gesellschaftliche Normen und Erwartungen darstellt, und welche unterschiedlichen Reaktionen und Lösungsansätze die beiden Frauen auf ihre jeweiligen Leiden finden. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit Fontane in seinen Romanen alternative Lebensweisen für Frauen aufzeigt.
Schlüsselwörter
Hysterie, Theodor Fontane, Effi Briest, Cécile, 19. Jahrhundert, Frauenrolle, bürgerliche Gesellschaft, Psychoanalyse, Feminismus, Literaturwissenschaft, gesellschaftliche Zwänge, Widerstand, Krankheit, Weiblichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung von Hysterie bei Fontane
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Darstellung von Hysterie als charakteristisches Merkmal weiblicher Figuren im späten 19. Jahrhundert in Theodor Fontanes Romanen „Effi Briest“ und „Cécile“. Die Analyse betrachtet die spezifischen Ausprägungen der Hysterie bei den Figuren und interpretiert sie im Kontext der damaligen medizinischen und gesellschaftlichen Diskurse unter Einbezug literaturwissenschaftlicher, feministischer und psychoanalytischer Perspektiven.
Welche Romane werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Hysterie bei den weiblichen Hauptfiguren in Theodor Fontanes Romanen „Effi Briest“ und „Cécile“. Ein Vergleich der beiden Figuren und deren Darstellung der Hysterie bildet einen zentralen Bestandteil der Analyse.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Die Analyse integriert literaturwissenschaftliche, feministische und psychoanalytische Perspektiven, um ein umfassendes Verständnis der Darstellung von Hysterie bei Fontane zu ermöglichen. Die Arbeiten von Freud, Charcot und Christina von Braun werden als Referenzpunkte herangezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Darstellung von Hysterie in Fontanes Romanen, den sozio-kulturellen Kontext der Hysterie im 19. Jahrhundert, einen Vergleich der Hysteriedarstellung bei Cécile und Effi Briest, die Interpretation der Hysterie als Ausdruck gesellschaftlichen Widerstands und die Analyse der von Fontane aufgezeigten Lösungsansätze für seine „kranken“ Frauen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Hysterie-Konzepts, ein Kapitel zum sozio-kulturellen Hintergrund der Hysterie im 19. Jahrhundert, ein Kapitel zum Vergleich der Hysteriedarstellung bei Cécile und Effi Briest und ein Resümee. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Hysterie, Theodor Fontane, Effi Briest, Cécile, 19. Jahrhundert, Frauenrolle, bürgerliche Gesellschaft, Psychoanalyse, Feminismus, Literaturwissenschaft, gesellschaftliche Zwänge, Widerstand, Krankheit, Weiblichkeit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Darstellung von Hysterie bei Fontanes weiblichen Figuren zu analysieren und im Kontext der damaligen medizinischen und gesellschaftlichen Diskurse zu interpretieren. Die Arbeit möchte ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Normen, weiblicher Identität und der Diagnose „Hysterie“ im 19. Jahrhundert schaffen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verbindet literaturwissenschaftliche Textanalyse mit feministischer und psychoanalytischer Theorie, um die Darstellung von Hysterie in Fontanes Romanen zu interpretieren. Der Vergleich der beiden Figuren Cécile und Effi Briest ermöglicht eine differenzierte Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Nina van Gemmern (Author), 2003, Hysterie als Signatur des späten 19 Jahrhunderts in Fontanes Romanen "Effi Briest" und "Cecile", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41445