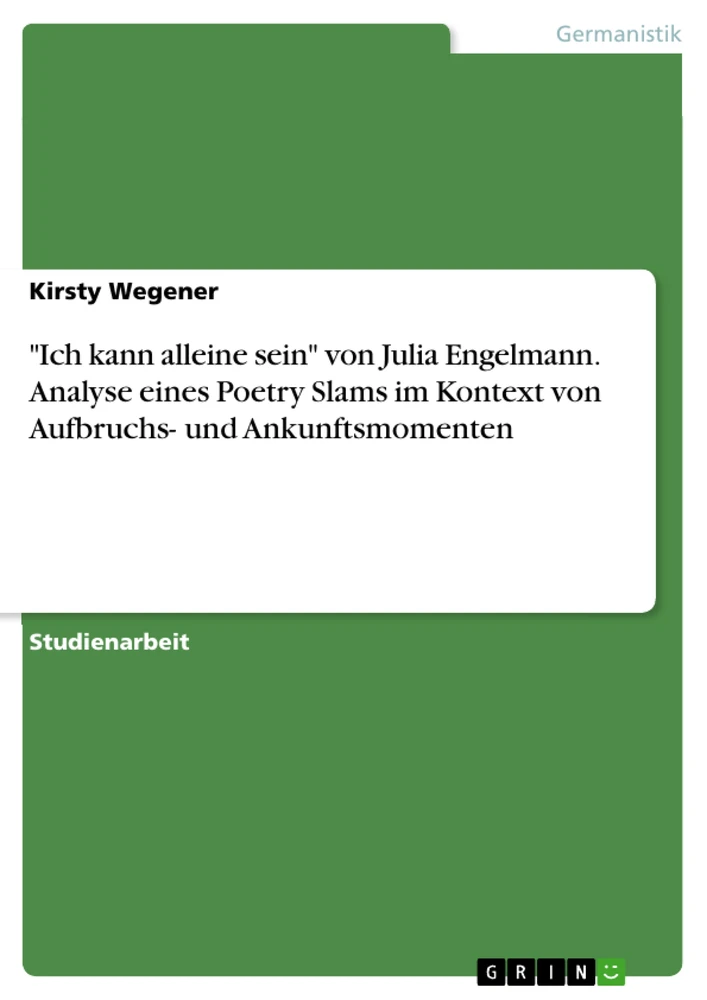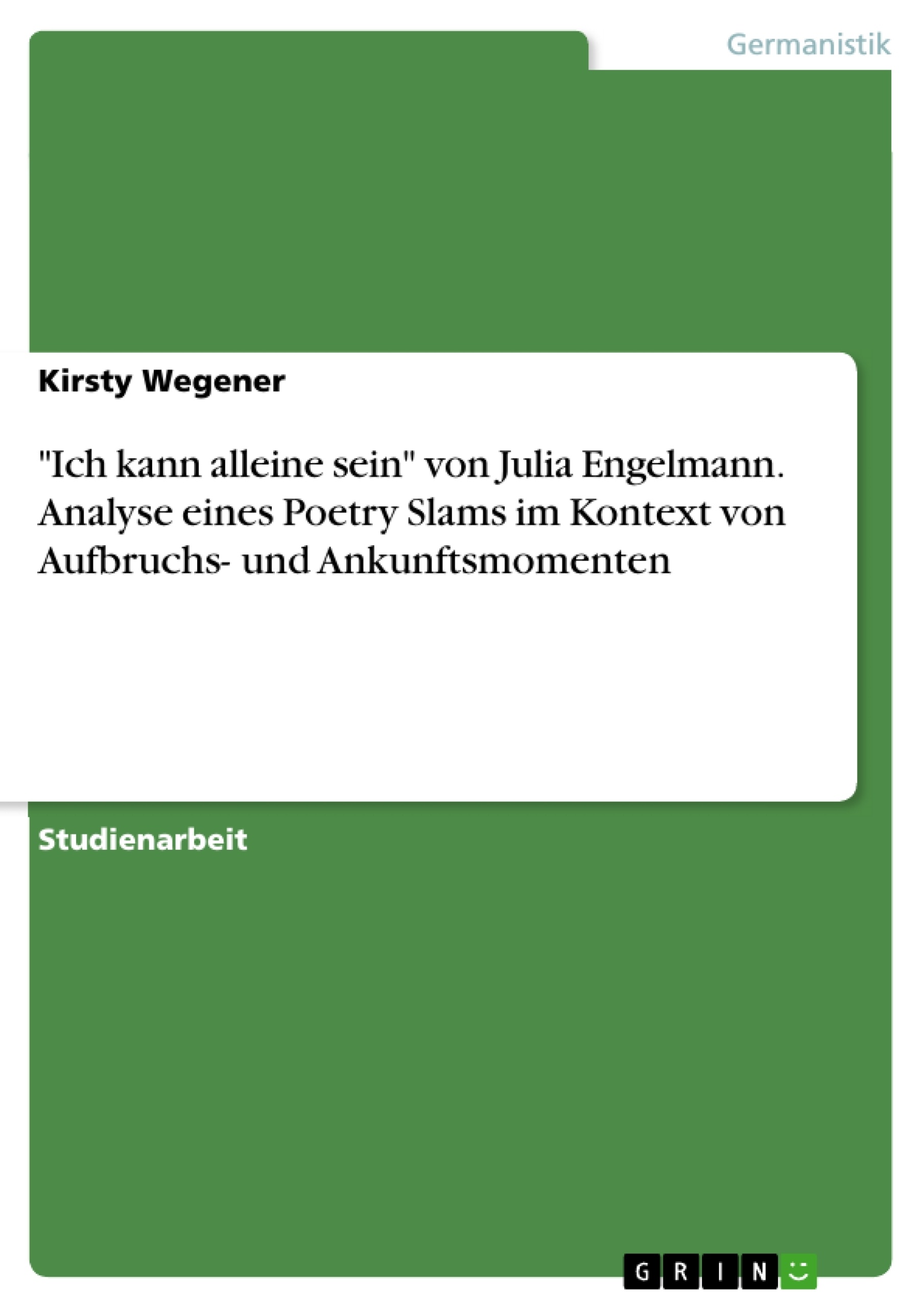Den Forschungsfragen nach Aufbruchs- und Ankunftsmomenten in der Literatur folgend, wird im Rahmen dieser Arbeit der Text "Ich kann alleine sein" aus dem Buch "Eines Tages, Baby" von Julia Engelmann formal analysiert, dann interpretiert und in Hinblick auf nachweisliche Aufbruchs- und Ankunftsmomente bearbeitet und zusammengefasst. Mit einem persönlichen Fazit endet diese Arbeit. Vorab wird kurz erläutert, um was für ein Format es sich beim Poetry Slam generell handelt, seiner Herkunft auf die Spur gekommen und anhand neuester, wenn auch immer noch viel zu wenig Forschungsliteraturen zu diesem Thema, erläutert, warum eine klassische Lyrikanalyse, wie sie in unzähligen Handbüchern erläutert wird, für einen Poetry Slam nur schwerlich möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Poetry Slam - Definition und Entwicklung
- 3. Woran erkennt man einen Poetry Slam?
- 4. Poetry Slam - Lyrikanalyse schwer gemacht
- 5. Das Gedicht „Ich kann alleine sein" - die Autorin, ihr Sprachmetrum und formale Lyrikelemente
- 5.1 Die Autorin „Julia Engelmann“
- 5.2 Sprechmetrum beim Vortrag „Ich kann alleine sein“
- 5.3 Formale Lyrikelemente im Slam Poetry „Ich kann alleine sein“
- 6. Das Gedicht „Ich kann alleine sein“ – Textinterpretation
- 6.1 Der (ungewollte?) Aufbruch zur Selbstfindung / Selbstidentität (Strophe 1-19)
- 6.2 Das lyrische Ich und der „Peter-Pan-Cowboy-Wolf“ (Strophe 20-23)
- 6.3 Die Ankunft im Selbst (Strophe 24-35)
- 7. Aufbruch vs. Ankunft: wo finden diese Momente in dem Gedicht „Ich kann alleine sein“ statt
- 8. Persönliches Fazit
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Julia Engelmanns Gedicht "Ich kann alleine sein" im Kontext des Poetry Slams. Ziel ist es, die formalen Elemente des Gedichts zu untersuchen und dessen Interpretation im Hinblick auf die im Seminar behandelten Themen "Aufbruch" und "Ankunft" zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie diese zentralen Motive im Gedicht dargestellt werden und welche Bedeutung sie im Kontext von Selbstfindung und Identität haben.
- Formale Analyse von Slam Poetry
- Interpretation von "Ich kann alleine sein" im Hinblick auf Aufbruch und Ankunft
- Analyse der Selbstfindung und Selbstidentität im Gedicht
- Der Einfluss von Vortragsweise und Performance auf die Wirkung des Gedichts
- Die spezifischen Merkmale des Poetry Slams als literarisches Format
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Kontext des Poetry Slams und Julia Engelmanns Werk dar. Sie verbindet den wachsenden Erfolg von Poetry Slams, exemplifiziert durch das große Open-Air-Event in Hamburg, mit der literaturwissenschaftlichen Arbeit an Engelmanns Gedicht "Ich kann alleine sein". Die Forschungsfrage nach Aufbruchs- und Ankunftsmomenten in Literatur wird formuliert, und der methodische Ansatz der Arbeit, die Textanalyse und Interpretation des Gedichts im Hinblick auf diese Motive, wird skizziert. Es wird betont, dass der Fokus auf der Analyse des ausgewählten Gedichts liegt und Vergleiche mit anderen Epochen und Werken hier nicht im Detail behandelt werden.
2. Poetry Slam - Definition und Entwicklung: Dieses Kapitel definiert den Poetry Slam als öffentliche, interaktive und wettbewerbsorientierte Veranstaltungsform, bei der selbstgeschriebene Texte unter Zeitdruck vorgetragen werden. Es beschreibt die Entstehung des Poetry Slams in Chicago durch Marc Smith und seine Entwicklung zu einem globalen Phänomen. Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung des Wettbewerbscharakters und der Rolle von Smiths Vision, Gefühlen durch den performativen Umgang mit Sprache Ausdruck zu verleihen. Die Verbreitung des Formats über Medien wie MTV und die New York Times wird ebenso thematisiert wie die schnelle Akzeptanz und Ausbreitung des Poetry Slams in Deutschland.
3. Woran erkennt man einen Poetry Slam?: Das Kapitel erläutert die Regeln und Kriterien eines Poetry Slams, wie sie von Marc Smith definiert wurden: Verbot von Requisiten, Kostümen und Musikinstrumenten sowie die Punkteabzüge bei Überschreitung des Zeitlimits. Die Rolle der Jury, die aus dem Publikum ausgewählt wird, und die verschiedenen Bewertungsansätze (Jury-Karten, Applaus) werden beschrieben. Die zentrale Bedeutung der persönlichen Vermittlung des Textes durch den Vortrag wird betont, und die Sichtweise, dass der Poetry Slam eine Wiedergeburt des Autors darstellt, wo Autor und Publikum zeitgleich am selben Ort sind, wird diskutiert.
4. Poetry Slam - Lyrikanalyse schwer gemacht: Dieses Kapitel, obwohl kurz im Auszug, legt nahe, dass eine klassische Lyrikanalyse auf Poetry Slams nur schwer anwendbar ist. Der performative Aspekt und der unmittelbare Kontakt zum Publikum machen eine rein textbasierte Analyse unzureichend. Der Textfragment deutet darauf hin, dass die spezifischen Eigenschaften des Mediums eine angepasste Methode zur Analyse erfordern.
5. Das Gedicht „Ich kann alleine sein" - die Autorin, ihr Sprachmetrum und formale Lyrikelemente: Dieses Kapitel, wie der Auszug zeigt, behandelt die Autorin Julia Engelmann, das Sprechmetrum ihres Vortrags und die formalen Lyrikelemente des Gedichts. Es legt den Grundstein für die anschließende Interpretation, indem es das Gedicht aus formal-linguistischer Perspektive beleuchtet. Die Analyse der formalen Elemente bildet die Basis für das Verständnis der Wirkungsweise des Gedichts auf den Zuhörer.
6. Das Gedicht „Ich kann alleine sein“ – Textinterpretation: Dieses Kapitel interpretiert das Gedicht "Ich kann alleine sein", indem es die Motive von Aufbruch und Ankunft entlang der Strophenstruktur analysiert. Es deutet auf eine Entwicklung der Protagonistin hin. Die Unterkapitel behandeln den Aufbruch zur Selbstfindung, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Identitätsvorstellungen und schließlich die Ankunft im Selbst. Die Analyse wird sich auf die Metaphern, sprachlichen Bilder und die Gesamtstruktur des Gedichts konzentrieren, um die dargestellte Entwicklung nachzuvollziehen.
7. Aufbruch vs. Ankunft: wo finden diese Momente in dem Gedicht „Ich kann alleine sein“ statt: Dieses Kapitel fasst die im vorherigen Kapitel identifizierten Aufbruchs- und Ankunftsmomente zusammen und analysiert deren Bedeutung im Kontext des gesamten Gedichts. Es wird ein Vergleich der gefundenen Motive innerhalb des Gedichtes stattfinden und die Bedeutung dieser für die Gesamtinterpretation herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Poetry Slam, Julia Engelmann, „Ich kann alleine sein“, Lyrikanalyse, Aufbruch, Ankunft, Selbstfindung, Selbstidentität, Textinterpretation, Performativität, Oralität.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu „Ich kann alleine sein“: Eine Poetry-Slam-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Julia Engelmanns Gedicht „Ich kann alleine sein“ im Kontext des Poetry Slams. Der Fokus liegt auf der formalen Analyse des Gedichts und seiner Interpretation im Hinblick auf die Motive „Aufbruch“ und „Ankunft“ im Zusammenhang mit Selbstfindung und Identität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition und Entwicklung des Poetry Slams, die formalen Elemente von Slam Poetry, eine detaillierte Interpretation von „Ich kann alleine sein“, die Analyse der Motive „Aufbruch“ und „Ankunft“ im Gedicht, die Bedeutung von Selbstfindung und Selbstidentität, den Einfluss von Vortragsweise und Performance, und die spezifischen Merkmale des Poetry Slams als literarisches Format.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einführung, ein Kapitel zur Definition und Entwicklung des Poetry Slams, ein Kapitel zu den Erkennungsmerkmalen eines Poetry Slams, ein Kapitel zu den Herausforderungen der Lyrikanalyse im Kontext von Poetry Slams, eine Analyse des Gedichts „Ich kann alleine sein“ (inkl. Autorin, Sprechmetrum und formalen Elementen), eine detaillierte Textinterpretation mit Fokus auf Aufbruch und Ankunft, ein Kapitel zum Vergleich von Aufbruch und Ankunft im Gedicht, ein persönliches Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textanalytische und interpretative Methode. Sie analysiert die formalen Elemente des Gedichts und interpretiert den Text im Hinblick auf die zentralen Motive „Aufbruch“ und „Ankunft“, um die Entwicklung der Protagonistin und deren Selbstfindungsprozess nachzuvollziehen. Der performative Aspekt des Poetry Slams wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Aspekte von Julia Engelmanns Gedicht „Ich kann alleine sein“ werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Autorin selbst, das Sprechmetrum im Vortrag, die formalen Lyrikelemente des Gedichts, die Interpretation der Strophen im Hinblick auf den Aufbruch zur Selbstfindung und die Ankunft im Selbst, sowie die Metaphern und sprachlichen Bilder des Gedichts.
Welche Bedeutung haben die Motive „Aufbruch“ und „Ankunft“ im Gedicht?
Die Motive „Aufbruch“ und „Ankunft“ symbolisieren den Prozess der Selbstfindung und Selbstidentität der Protagonistin. Der „Aufbruch“ repräsentiert den Beginn einer Reise zur Selbstfindung, während die „Ankunft“ das Erreichen eines Zustands von Selbstakzeptanz und innerer Ruhe symbolisiert. Die Arbeit analysiert, wo diese Momente im Gedicht stattfinden und welche Bedeutung sie im Kontext der Gesamtinterpretation haben.
Wie wird der Poetry Slam in der Arbeit behandelt?
Der Poetry Slam wird als literarisches Format definiert und seine Entwicklung von seinen Ursprüngen in Chicago bis hin zu seiner globalen Verbreitung beschrieben. Die Arbeit beleuchtet die Regeln, Kriterien und die Bedeutung der Performativität für das Verständnis von Poetry Slams. Die Arbeit diskutiert auch die Schwierigkeiten, eine klassische Lyrikanalyse auf Poetry Slams anzuwenden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Poetry Slam, Julia Engelmann, „Ich kann alleine sein“, Lyrikanalyse, Aufbruch, Ankunft, Selbstfindung, Selbstidentität, Textinterpretation, Performativität, Oralität.
- Citar trabajo
- Kirsty Wegener (Autor), 2015, "Ich kann alleine sein" von Julia Engelmann. Analyse eines Poetry Slams im Kontext von Aufbruchs- und Ankunftsmomenten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414065