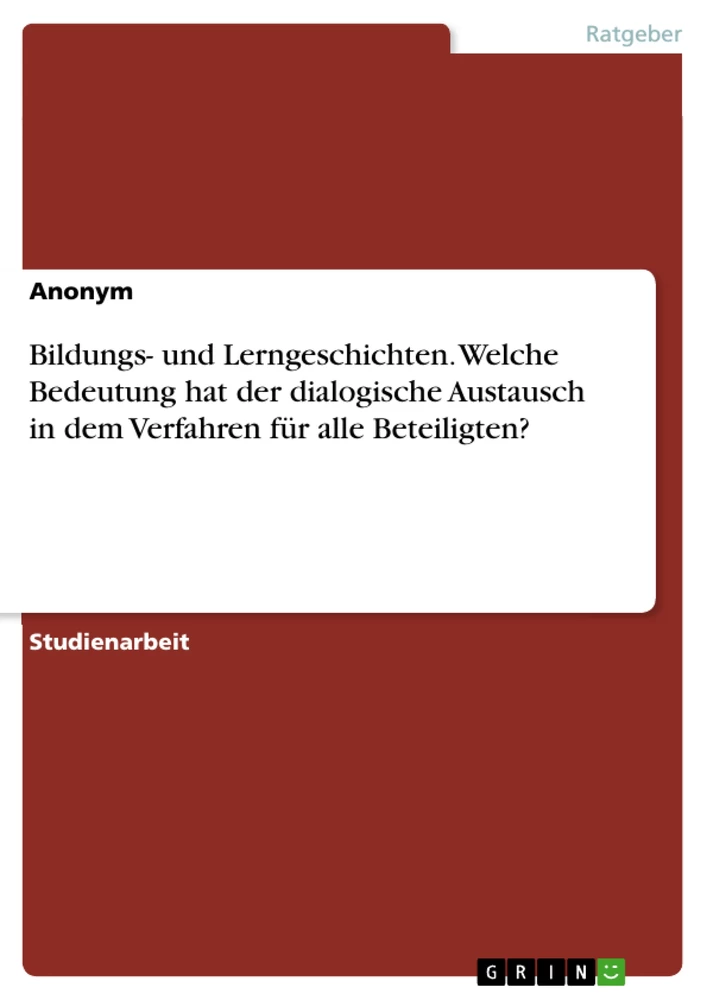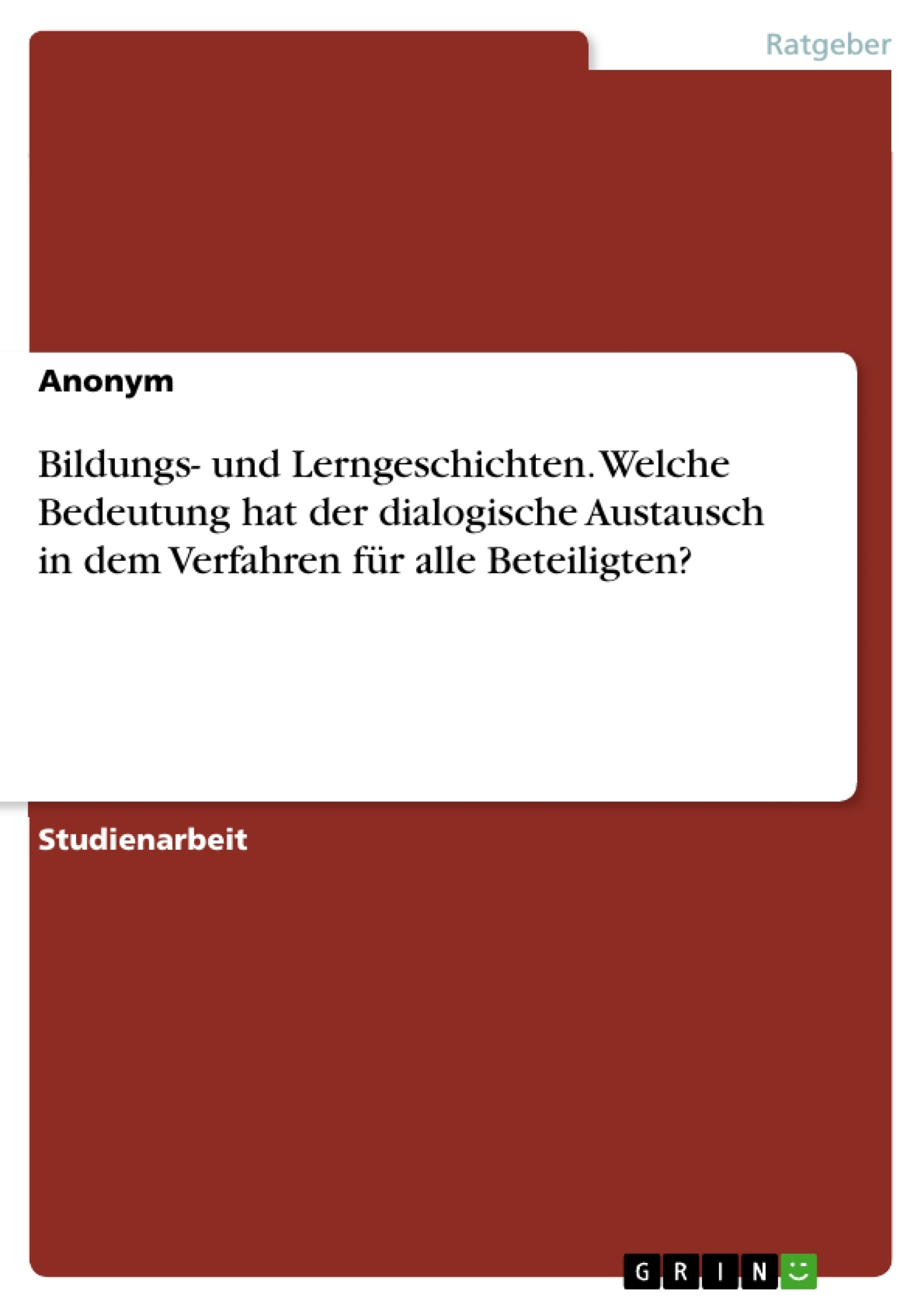Kinder erforschen und erleben ihre Umgebung ganzheitlich, mit allen Sinnen, und im Austausch mit anderen, konstruktiv, und erschließen sich so ihre Welt. Schon ab der Geburt beginnen Kinder ihre Umgebung selbst zu entdecken und dabei viele Erfahrungen zu machen, auf die sie immer wieder zurückgreifen und mit neuen verknüpfen können. Hierbei handelt es sich um Lern-und Selbstbildungsprozesse der Kinder. Diese helfen ihnen sich in ihrer Welt zurechtzufinden und in dieser handlungsfähig zu werden, sodass sie irgendwann selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und aktiv sein können.
Im Rahmen der nach der Pisa-Studie aufgekommenen Bildungsdebatte in Deutschland sind die Bundesländer verstärkt dazu übergegangen, eine Verbesserung der frühkindlichen Bildung anzustreben und schon im Elementarbereich anzusetzen. Aus diesem Grund wird nunmehr in den Curricula die Beobachtung und Dokumentation der Lern- und Bildungsprozesse jedes einzelnen Kindes als Grundlage des Handelns der pädagogischen Fachkräfte gesehen. Durch eine kontinuierliche und zielgerichtete Beobachtung und Dokumentation sollen die Entwicklung des Kindes, der Verlauf des Bildungsprozesses sowie die Umsetzung der pädagogischen Angebote erfasst werden. Die konkrete Umsetzung der Vorgaben verbleibt jedoch im Entscheidungsbereich der Einrichtungen.
Zur Realisierung des Bildungsauftrages ist es notwendig, dass die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört die Umgebung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Diese sollte so gestaltet sein, dass sie möglichst viele Lern- und Bildungsprozesse machen, um sich viel Wissen aneignen und ihren Interessen nachgehen zu können. Dabei sollte jedes einzelne Kind möglichst optimal durch die pädagogische Fachkraft unterstützt, angeregt und gefördert werden. Sie sollte in der Lage sein, die kindlichen Aktivitäten bewusst wahrzunehmen, auf die Ideen und Interessen der Kinder einzugehen und diese auch in die Entwicklung von Bildungsangeboten mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beobachtungsformen
- Teilnehmende und nicht teilnehmende Beobachtung
- Offene und verdeckte Beobachtung
- Beobachtung mit gerichteter und ungerichteter Aufmerksamkeit
- Beobachtungsverfahren
- Verfahren zur Kontrolle des Entwicklungsstandes des Kindes
- Verfahren zur Kontrolle des Kompetenzerwerbs des Kindes nach Alter und Lernzielen
- Verfahren zur Entwicklung einer kindzentrierten Perspektive
- Beschreibung der „learning stories“ nach Margaret Carr
- Entwicklung der Bildungs-und Lerngeschichten nach dem Konzept der „learning stories“
- Die Bedeutung der fünf Lerndispositionen
- Die Beschreibung der fünf Lerndispositionen nach Margaret Carr
- Interessiert sein
- Engagiert sein
- Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten
- Sich ausdrücken und mitteilen
- An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen
- Voraussetzungen für die Anwendung der Bildungs-und Lerngeschichten
- Strukturelle Bedingungen
- Personelle Bedingungen
- Umsetzung der Bildungs-und Lerngeschichten
- Beobachtung
- Analyse der Beobachtung nach Lerndispositionen
- Kollegialer Austausch
- Die Lerngeschichte
- Dokumentation zum Beispiel in Portfolios
- Erfahrungen in der Praxis
- Bedeutung des dialogischen Austauschs
- für das Kind
- für die pädagogische Fachkraft
- für die Eltern
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten, insbesondere mit der Bedeutung des dialogischen Austauschs in diesem Verfahren. Dabei wird untersucht, welche Bedeutung der Austausch für alle Beteiligten (Kind, pädagogische Fachkraft, Eltern) hat und welche Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung dieses Konzepts gegeben sein müssen.
- Beobachtungstechniken in der Bildung
- Das Konzept der „learning stories“ nach Margaret Carr
- Die Rolle der fünf Lerndispositionen in der Bildung
- Der dialogische Austausch als zentrale Komponente der Bildungs- und Lerngeschichten
- Die Bedeutung der Bildungs- und Lerngeschichten für die kindliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungs- und Lerngeschichten ein und erläutert die Relevanz des dialogischen Austauschs in diesem Kontext. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den verschiedenen Beobachtungstechniken, die in der Bildung eingesetzt werden können, und erläutern die unterschiedlichen Verfahren zur Kontrolle des Entwicklungsstandes und des Kompetenzerwerbs von Kindern. Anschließend wird das Konzept der „learning stories“ nach Margaret Carr vorgestellt und die Bedeutung der fünf Lerndispositionen in diesem Zusammenhang erläutert. Es werden die strukturellen und personellen Voraussetzungen für die Anwendung von Bildungs- und Lerngeschichten sowie die konkrete Umsetzung des Verfahrens in der Praxis beschrieben. Abschließend werden die Erfahrungen mit dem Einsatz von Bildungs- und Lerngeschichten in der Praxis dargelegt und die Bedeutung des dialogischen Austauschs für alle Beteiligten (Kind, pädagogische Fachkraft, Eltern) beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bildungs- und Lerngeschichten, dialogischer Austausch, „learning stories“, Margaret Carr, Lerndispositionen, Beobachtungstechniken, kindzentrierte Perspektive, Entwicklung, Kompetenz, Partizipation, Dokumentation, Portfolio.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Bildungs- und Lerngeschichten. Welche Bedeutung hat der dialogische Austausch in dem Verfahren für alle Beteiligten?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414011