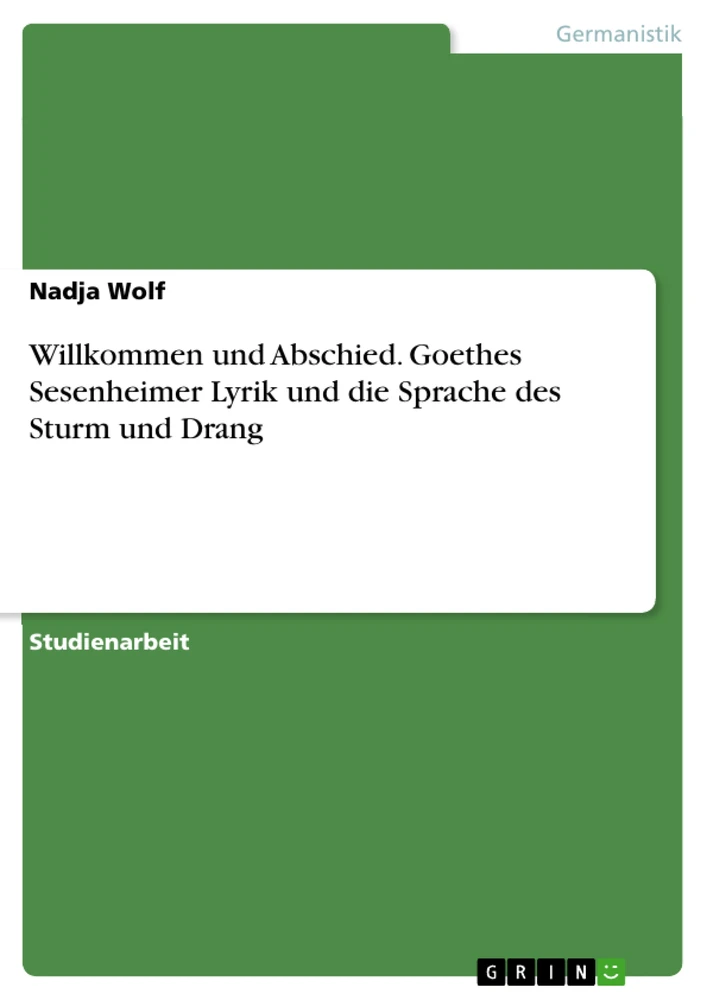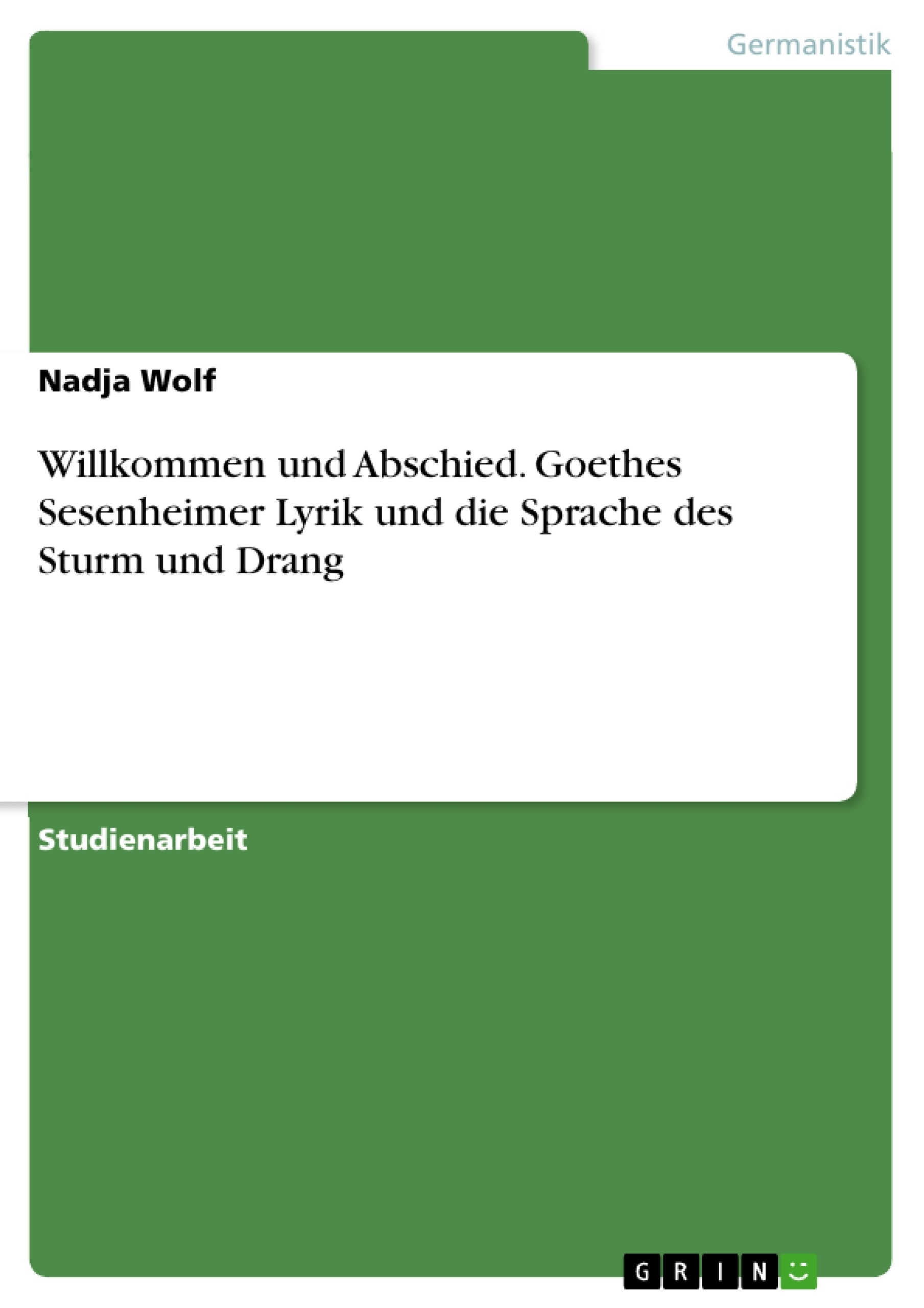Goethe schrieb einst in einem Brief vom 19. April 1770: „Ich binn [sic] anders.“ Zu dieser Erkenntnis kam er nach seinem Entschluss, sein Rechtswissenschaftsstudium zu unterbrechen und Frankfurt zu verlassen sowie durch die innere Distanz zu seinen Leipziger Liebeserlebnissen. Er war auf der Suche nach einem Neubeginn, der auch seine Literatur betreffen sollte. Seine neue Parole hieß: „Literatur solle den Leser empfinden machen, was zuvor nicht gefühlt, sie solle denken machen, was zuvor nicht gedacht wurde.“
Schauplatz für seinen literarischen Neubeginn war Straßburg, wo er sich zwischen April 1770 und August 1771 aufhielt. Dieser Aufenthalt ließ ihn und seine Dichtkunst zu etwas anderem machen und ist mit dem Stichwort „Sesenheimer Lyrik“ verbunden. In der Literaturwissenschaft wird auch von Erlebnislyrik gesprochen, da den Gedichten persönliche Erlebnisse zugrunde liegen, die unmittelbar dargestellt werden.
Diese Unmittelbarkeit und Echtheit finde man vor allem in den Sesenheimer Liebesgedichten. Eines der Bekanntesten, das darüber hinaus auch eines der Berühmtesten Goethes und der deutschen Literatur allgemein ist, schrieb der
Dichter im Jahr 1771. „Willkommen und Abschied“ ist uns insgesamt in drei Textfassungen erhalten: Ein im Jahr 1771 in zehn Zeilen handgeschriebenes Fragment, der Erstdruck in Jacobis Zeitschrift „Iris“ aus dem Jahr 1775 (noch ohne Überschrift) und die überarbeitete Fassung der „Schriften“ mit dem Titel „Willkomm und Abschied“ von 1789. Nach Goethes Tod wurde die Überschrift in der Werkausgabe von 1810 noch einmal in „Willkommen und Abschied“ umgeändert.
In dieser Arbeit soll anhand einer Analyse und Interpretation des Gedichts die Frage „Welche Tropen und rhetorischen Mittel nutzt Goethe in Willkommen und Abschied, um das ständige Auf und Ab der Gefühle darzustellen und inwiefern schlägt sich seine neue Sprache in diesem Gedicht nieder?“ diskutiert und beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbetrachtungen
- 2.1 Die Epoche des Sturm und Drang
- 2.2 Goethes Sesenheimer Lyrik
- 3. Analyse und Interpretation
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert und interpretiert Goethes Gedicht „Willkommen und Abschied“, um die verwendeten Tropen und rhetorischen Mittel zu untersuchen, die das ständige Auf und Ab der Gefühle darstellen. Die Arbeit beleuchtet, wie Goethes neue Sprache in diesem Gedicht zum Ausdruck kommt. Die Analyse basiert auf dem Goethe-Handbuch, Kutschers „Naturgefühl in Goethes Lyrik“ und Weimars Aufsatz „Mir schlug das Herz“.
- Goethes neue Sprache und Stilmittel
- Die Darstellung von Gefühlen in „Willkommen und Abschied“
- Der Einfluss des Sturm und Drang auf das Gedicht
- Goethes Sesenheimer Lyrik im Kontext seiner Biografie
- Analyse der rhetorischen Mittel (Anapher, etc.)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Goethes Aussage „Ich binn [sic] anders“ in den Kontext seines Lebenswandels und seines literarischen Neubeginns in Straßburg dar. Sie führt in die Thematik der Sesenheimer Lyrik ein, die von persönlicher Erlebnislyrik geprägt ist und eine neue, unmittelbare Sprache verwendet, wie von Ulrich Karthaus beschrieben. Das berühmte Gedicht „Willkommen und Abschied“ dient als zentrales Beispiel und wird in seinen verschiedenen Versionen vorgestellt. Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage der Seminararbeit: Wie nutzt Goethe sprachliche Mittel, um das Auf und Ab der Gefühle darzustellen, und wie manifestiert sich seine neue Sprache im Gedicht?
2. Vorbetrachtungen: Dieser Abschnitt liefert den notwendigen Kontext für die Analyse von „Willkommen und Abschied“. Zunächst wird die Epoche des Sturm und Drang beleuchtet, die durch Rebellion gegen gesellschaftliche Zwänge, Naturverbundenheit, Geniebegriff und Subjektivismus gekennzeichnet ist. Der Fokus liegt auf dem Bruch mit dem Rationalismus der Aufklärung und der Betonung von Gefühl und Leidenschaft. Im zweiten Teil werden Goethes Sesenheimer Gedichte im Kontext seiner Liebe zu Friederike Brion und der Entstehung seiner Lyrik in dieser Zeit dargestellt. Die Gedichte zeichnen sich durch subjektiven Gefühlsausdruck, Innigkeit und Freude aus und markieren einen wichtigen Wendepunkt in Goethes dichterischem Schaffen.
3. Analyse und Interpretation: Dieser Abschnitt geht detailliert auf das Gedicht „Willkommen und Abschied“ ein. Nach einer kurzen Inhaltsangabe, die das Gedicht in drei Sinnabschnitte gliedert (nächtlicher Ritt, Begegnung, Abschied), werden die sprachlichen Mittel und ihre Wirkung analysiert. Ein Beispiel hierfür ist die Anapher „Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!/ Es war gethan [sic] fast eh gedacht“, die die ungezügelten Emotionen des lyrischen Ichs verdeutlicht. Die Analyse beleuchtet die Parallelen zwischen dem Gedicht und Goethes Biographie, und der Bezug zu den Vorbetrachtungen zur Epoche des Sturm und Drang und zur Sesenheimer Lyrik wird hergestellt. Die Analyse wird auf die im Vorwort gestellte Leitfrage eingehen.
Schlüsselwörter
Willkommen und Abschied, Goethe, Sesenheimer Lyrik, Sturm und Drang, Erlebnislyrik, rhetorische Mittel, Tropen, Anapher, Gefühl, Leidenschaft, Sprache, Interpretation, Analyse, Subjektivismus, Naturgefühl.
Goethes "Willkommen und Abschied": Eine Seminararbeit - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert und interpretiert Johann Wolfgang von Goethes Gedicht "Willkommen und Abschied". Im Fokus steht die Untersuchung der sprachlichen Mittel und rhetorischen Figuren, die Goethes Gefühlswelt und die Dynamik seiner Emotionen in diesem Gedicht zum Ausdruck bringen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Goethes neue Sprache und Stilmittel, die Darstellung von Gefühlen in "Willkommen und Abschied", den Einfluss des Sturm und Drang auf das Gedicht, Goethes Sesenheimer Lyrik im Kontext seiner Biografie und die Analyse rhetorischer Mittel (wie z.B. die Anapher).
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Goethe-Handbuch, Kutschers "Naturgefühl in Goethes Lyrik" und Weimars Aufsatz "Mir schlug das Herz".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Vorbetrachtungen, die Hauptanalyse und Interpretation des Gedichts sowie ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik der Sesenheimer Lyrik und die Forschungsfrage ein. Die Vorbetrachtungen beleuchten den historischen Kontext (Sturm und Drang) und die biographischen Hintergründe. Die Analyse interpretiert detailliert das Gedicht "Willkommen und Abschied" unter Berücksichtigung der sprachlichen Mittel.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie nutzt Goethe sprachliche Mittel, um das Auf und Ab der Gefühle darzustellen, und wie manifestiert sich seine neue Sprache im Gedicht?
Welche Aspekte des Sturm und Drang werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Epoche des Sturm und Drang mit ihren charakteristischen Merkmalen wie Rebellion gegen gesellschaftliche Zwänge, Naturverbundenheit, Geniebegriff und Subjektivismus. Der Fokus liegt auf dem Bruch mit dem Rationalismus der Aufklärung und der Betonung von Gefühl und Leidenschaft.
Welche Rolle spielt Goethes Sesenheimer Lyrik?
Die Sesenheimer Lyrik, entstanden während Goethes Beziehung zu Friederike Brion, wird als wichtiger Kontext für das Verständnis von "Willkommen und Abschied" dargestellt. Die Gedichte dieser Phase zeichnen sich durch subjektiven Gefühlsausdruck, Innigkeit und Freude aus und markieren einen Wendepunkt in Goethes dichterischem Schaffen.
Welche sprachlichen Mittel werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene sprachliche Mittel, beispielsweise die Anapher, um die Wirkung und die Darstellung der Emotionen im Gedicht zu verstehen. Die Analyse geht detailliert auf die verwendeten Tropen und rhetorischen Mittel ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Willkommen und Abschied, Goethe, Sesenheimer Lyrik, Sturm und Drang, Erlebnislyrik, rhetorische Mittel, Tropen, Anapher, Gefühl, Leidenschaft, Sprache, Interpretation, Analyse, Subjektivismus, Naturgefühl.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfrage), Vorbetrachtungen (Kontextualisierung im Sturm und Drang und der Sesenheimer Lyrik), Analyse und Interpretation (detaillierte Gedichtanalyse) und Fazit (Zusammenfassung der Ergebnisse).
- Quote paper
- Nadja Wolf (Author), 2016, Willkommen und Abschied. Goethes Sesenheimer Lyrik und die Sprache des Sturm und Drang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413984