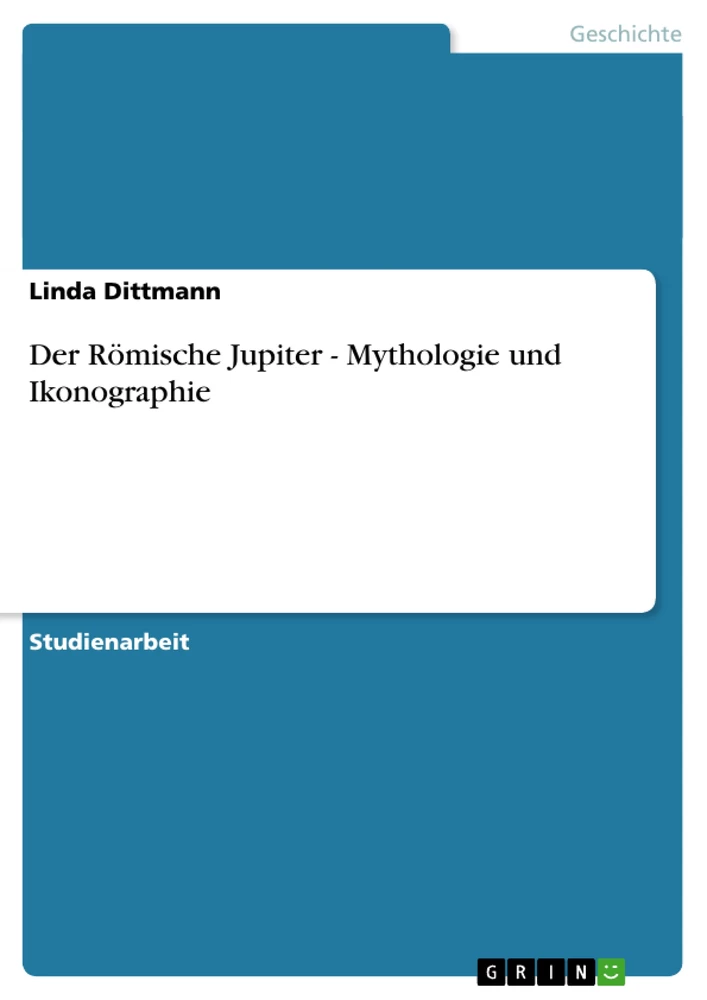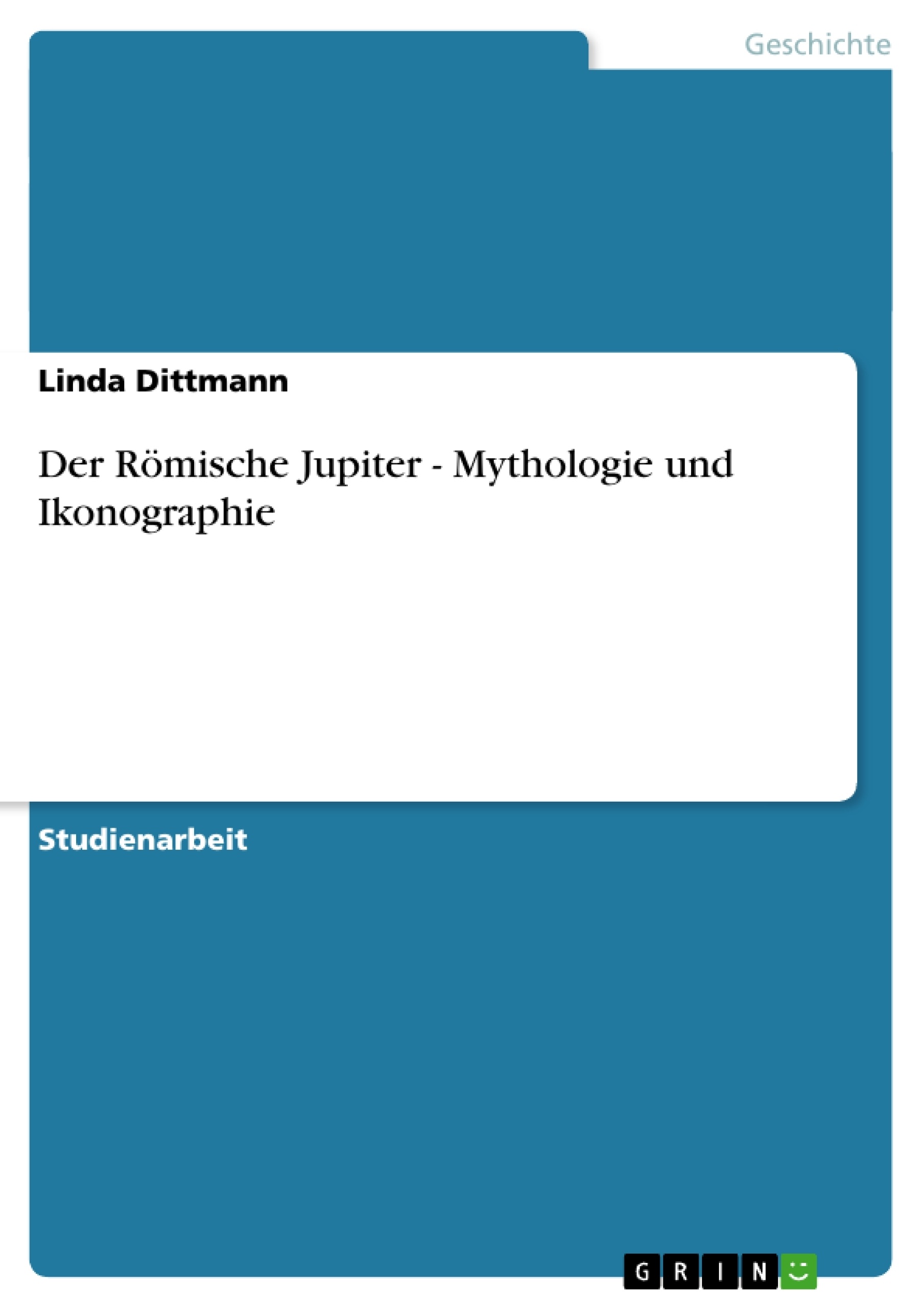Schon sehr früh hingen die Römer einer mächtigen Religion an, die alle Lebensbereiche durchdrang. Diese gründete sich auf gegenseitiges Vertrauen zwischen Göttern und den Menschen. Das Vertrauen in das Wohlwollen der Götter fand seinen Ausdruck im Glauben an den Götterfrieden. Dies war ein natürliches Gleichgewicht, an dessen Aufrechterhaltung die himmlischen Mächte und die Menschen harmonisch zusammenwirkten. Dieser Frieden ließ sich vor allem durch den gewissenhaften Vollzug des Rituals erreichen und nicht so sehr durch moralisches Verhalten, wie es heut in der christlichen Religion der Fall ist. Die Idee vom Gottesfrieden übte jedoch indirekt einen moralischen Einfluss aus, den die erforderte Einhaltung der den Göttern geleisteten Gelübde dehnte sich im Laufe der Zeit auch auf die Verpflichtungen gegenüber den Menschen aus.
Einer der wohl wichtigsten Götter in der römischen Religion war Jupiter, auf den ich in meiner folgenden Seminararbeit eingehe. Diese Arbeit behandelt die Herkunft, das Wesen und die Ikonographie von Jupiter. Außerdem werden die Kultausübungen, die dem Jupiter galten näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herkunft und Namensgebung
- Jupiters Wesen und seine Bedeutung
- Ikonographie
- Verehrung
- Heiligtümer
- Priester
- Festtage
- Mythologie
- Quellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den römischen Gott Jupiter, beleuchtet seine Herkunft und Namensgebung, beschreibt sein Wesen und seine Bedeutung im römischen Pantheon und analysiert seine ikonografische Darstellung. Die Arbeit konzentriert sich auf die verschiedenen Aspekte der Verehrung Jupiters und beleuchtet seine Rolle in der römischen Mythologie.
- Jupiters Herkunft und Namensdeutung
- Die vielschichtigen Bedeutungen Jupiters (Wettergott, Schutzgott, Kriegsgott)
- Die ikonografische Darstellung Jupiters im Wandel der Zeit
- Die verschiedenen Aspekte der Verehrung Jupiters (Heiligtümer, Priester, Feste)
- Jupiters Rolle in der römischen Mythologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die römische Religion ein und betont das zentrale Konzept des "Gottesfriedens" und des Vertrauens zwischen Göttern und Menschen. Sie hebt die Bedeutung des Rituals für die Aufrechterhaltung dieses Friedens hervor und betont den indirekten moralischen Einfluss der religiösen Pflichten. Die Arbeit konzentriert sich auf Jupiter als einen der wichtigsten Götter im römischen Pantheon und kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit seiner Herkunft, seinem Wesen, seiner Ikonographie und seinen Kultpraktiken befassen.
Herkunft und Namensgebung: Dieses Kapitel untersucht die Herkunft des Namens Jupiter und seine Verbindungen zu indogermanischen Sprachfamilien. Es diskutiert die verschiedenen Interpretationen des Namens, die von "leuchtender, göttlich verehrter Himmel" bis zu "helfender Vater" reichen. Die Arbeit betont, dass Jupiter, im Gegensatz zum griechischen Zeus, nicht als leiblicher Vater anderer Götter angesehen wurde, sondern eher als der Vater des Himmels und des Lichtes.
Jupiters Wesen und seine Bedeutung: Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Rollen Jupiters in der römischen Religion. Er wird als Wettergott mit verschiedenen Aspekten (z.B. Jupiter Pluvius für Regen, Jupiter Fulgur für Blitze) dargestellt. Gleichzeitig ist er ein Schutzgott (Jupiter Latiaris, Jupiter Conservator) und spielt eine wichtige Rolle im militärischen Kontext (Jupiter Stator, Jupiter Victor, Jupiter Feretrius). Die besondere Bedeutung von Jupiter Optimus Maximus als oberster Staatsgott wird hervorgehoben.
Ikonographie: Dieses Kapitel befasst sich mit der ikonografischen Darstellung Jupiters. Es beschreibt die anfängliche Verehrung Jupiters in Form von Steinen (lapis manalis, silex) und den Übergang zur menschlichen Darstellung ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. unter etruskischem Einfluss. Die Bedeutung des silex als Instrument für Eide und die damit verbundene Strafe Jupiters durch Blitze wird erläutert.
Schlüsselwörter
Jupiter, römische Religion, Mythologie, Ikonographie, Wettergott, Schutzgott, Kriegsgott, Kult, Heiligtümer, Priester, Festtage, Optimus Maximus, Indogermanisch, Namensgebung, Pietas erga deos.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Jupiter - Der römische Gott
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den römischen Gott Jupiter umfassend. Sie beleuchtet seine Herkunft und Namensgebung, beschreibt sein Wesen und seine Bedeutung im römischen Pantheon, analysiert seine ikonografische Darstellung und die verschiedenen Aspekte seiner Verehrung, sowie seine Rolle in der römischen Mythologie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Jupiters Herkunft und Namensdeutung, seine vielschichtigen Bedeutungen (Wettergott, Schutzgott, Kriegsgott), seine ikonografische Darstellung im Wandel der Zeit, die verschiedenen Aspekte seiner Verehrung (Heiligtümer, Priester, Feste) und seine Rolle in der römischen Mythologie. Besondere Beachtung findet Jupiter Optimus Maximus als oberster Staatsgott.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Herkunft und Namensgebung, Jupiters Wesen und Bedeutung, Ikonographie, Verehrung (inkl. Heiligtümer, Priester und Festtage), Mythologie, Quellen und Anhang. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Aspekt.
Wie wird Jupiters Herkunft und Namensgebung behandelt?
Das Kapitel zur Herkunft und Namensgebung untersucht die etymologischen Wurzeln des Namens "Jupiter" und seine Verbindungen zu indogermanischen Sprachen. Es diskutiert verschiedene Interpretationen der Namensbedeutung und hebt den Unterschied zu Zeus hervor, indem Jupiter nicht als leiblicher Vater anderer Götter, sondern als Vater des Himmels und des Lichtes dargestellt wird.
Wie beschreibt die Arbeit Jupiters Wesen und Bedeutung?
Dieses Kapitel beschreibt Jupiters vielseitige Rollen als Wettergott (Jupiter Pluvius, Jupiter Fulgur), Schutzgott (Jupiter Latiaris, Jupiter Conservator) und Kriegsgott (Jupiter Stator, Jupiter Victor, Jupiter Feretrius). Die herausragende Bedeutung von Jupiter Optimus Maximus als oberster Staatsgott wird besonders hervorgehoben.
Wie wird die Ikonographie Jupiters dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die anfängliche Verehrung Jupiters in Form von Steinen (lapis manalis, silex) und den Übergang zur menschlichen Darstellung ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. unter etruskischem Einfluss. Die Bedeutung des silex im Zusammenhang mit Eiden und der Strafe Jupiters durch Blitze wird erläutert.
Welche Aspekte der Verehrung Jupiters werden behandelt?
Die Verehrung Jupiters wird umfassend behandelt, inklusive der Beschreibung von Heiligtümern, Priestern und Festtagen. Die Arbeit beleuchtet die rituellen Praktiken und ihre Bedeutung für den "Gottesfrieden" und das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen im römischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jupiter, römische Religion, Mythologie, Ikonographie, Wettergott, Schutzgott, Kriegsgott, Kult, Heiligtümer, Priester, Festtage, Optimus Maximus, Indogermanisch, Namensgebung, Pietas erga deos.
Für wen ist diese Seminararbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich für die römische Religion, Mythologie und Geschichte interessieren. Sie bietet eine strukturierte und professionelle Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Linda Dittmann (Author), 2003, Der Römische Jupiter - Mythologie und Ikonographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41367