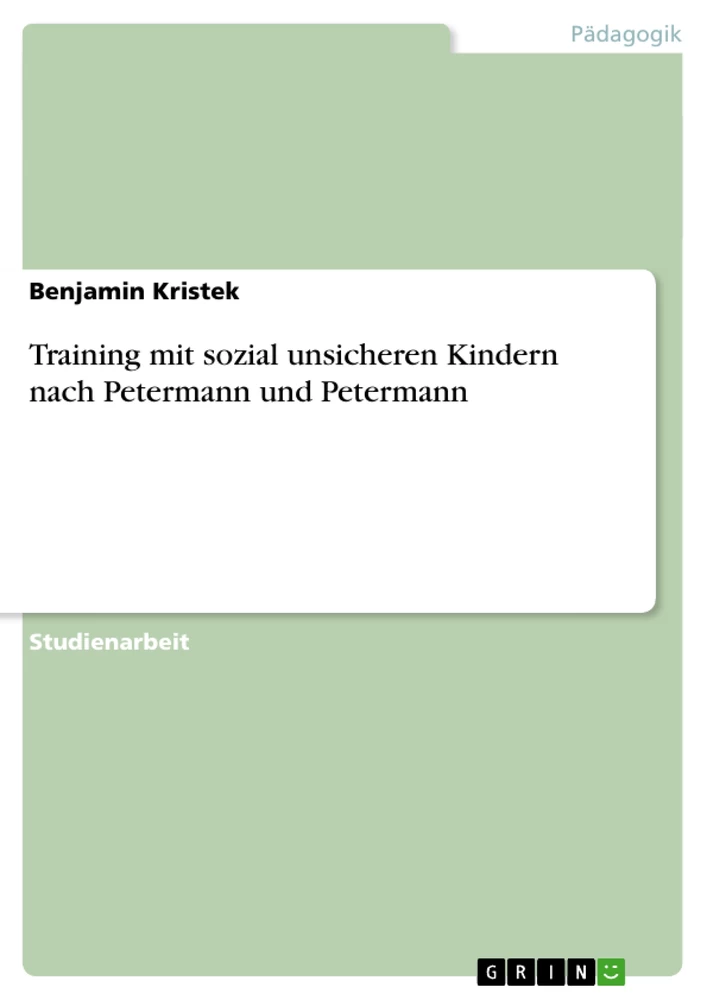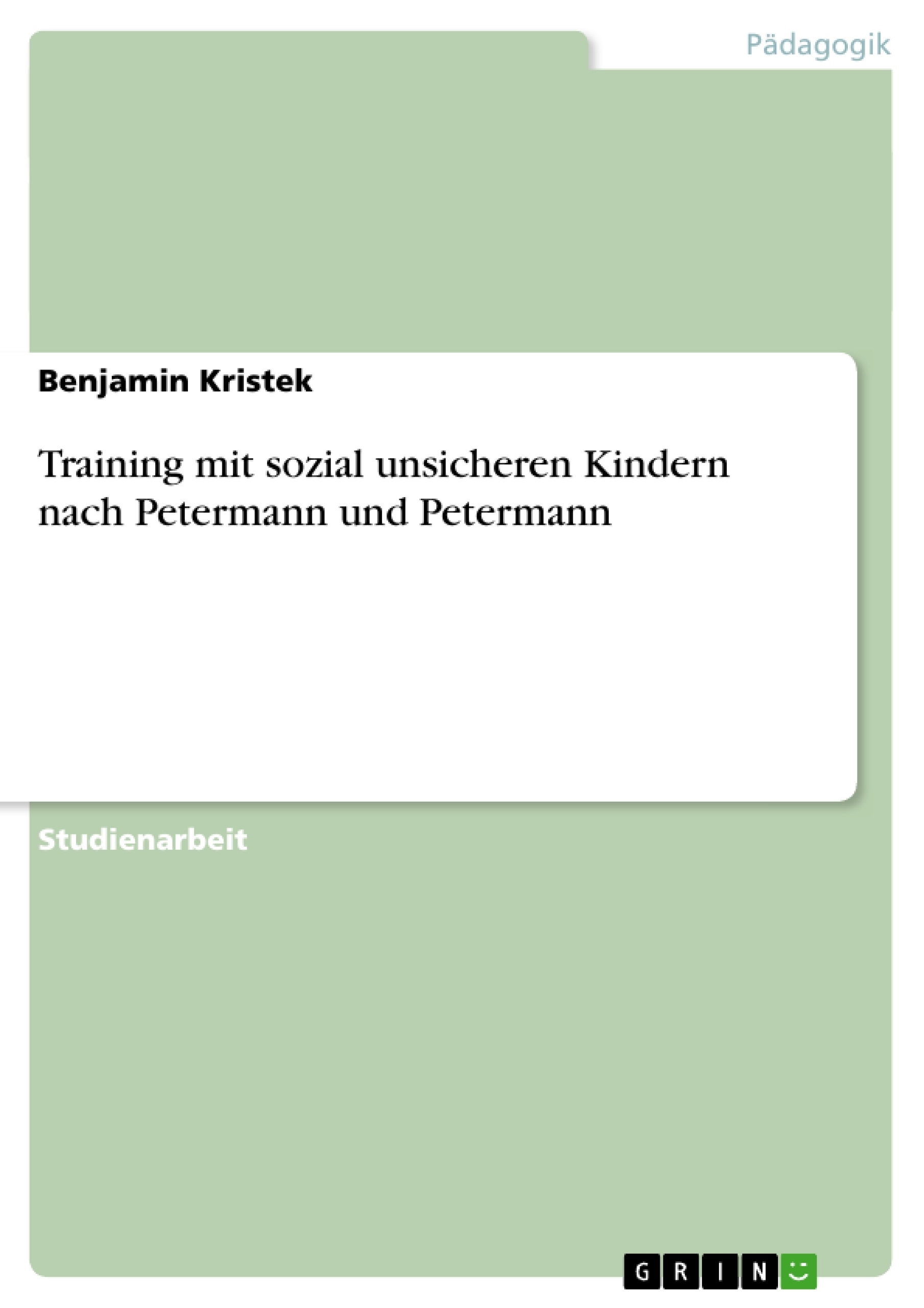Sozial unsicheres Verhalten ist kein Begriff, der nur ein bestimmtes Verhalten von Kindern umschreibt, sondern beinhaltet verschiedene Verhaltensweisen, die auf die spezielle Familiensituation und erfahrene Sozialisation zurückgehen und ist somit ein Sammelbegriff.1 Was genau sind aber sozial unsichere Kinder? Petermann und Petermann geben eine beschreibende Definition ab: „Sozial unsichere Kinder werden häufig als schüchtern, sozial isoliert, kontaktängstlich, trennungsängstlich, gehemmt und sozial inkompetent bezeichnet.“2 Auffallend ist oft das Verhalten dieser Kinder in sozialen Interaktionen, bei denen sie Schwierigkeiten haben, anderen Personen in die Augen zu schauen, sehr leise sprechen oder auch stottern, „dass sie sich nicht behaupten können und Sozialkontakt vermeiden oder verweigern, d. h. sie können keinen Kontakt zu anderen Kindern, manchmal auch nicht zu Erwachsenen außerhalb der Familie aufnehmen, aufrecht erhalten oder angemessen beenden.“3 In engem Zusammenhang mit sozial unsicherem Verhalten steht laut Petermann und Petermann die Angststörung.
Verschiedenste Ängste treten bei fast allen Kindern auf und gehören zur alltäglichen Lebensbewältigung und zum Sammeln von Erfahrungen mit dazu. Aber kindliche Ängste, die das Sozialverhalten stören, beeinträchtigen die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes enorm. Zu unterscheiden sind bestimmte Angstformen, wie sie auch Hillenbrand auflistet: „Trennungsangst, Kontaktangst und Überängstlichkeit“.4 Soziale Angst, die eng verwandt ist mit den genannten Ängsten, ist bei fast allen sozial unsicheren Kindern gegeben und kann auf verschiedene Weise zum Ausdruck kommen, z. B. die Angst vor der Kritik von Personen, Angst vor Autoritätspersonen, Angst, sich in sozialen Situationen nicht angemessen verhalten zu können, Angst, den Erwartungsvorstellungen der Personen nicht gerecht werden zu können.
1 Vgl., Petermann, Ulrike, Petermann, Franz, Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung, 6., überarbeitete und veränderte Auflage, Weinheim 1996, S. 13.
2 Ebd., S. 11.
3 Ebd.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Theorie
- 1.1 Erklärungskonzepte
- 1.2 Theorie der erlernten Hilflosigkeit
- 1.2.1 Darstellung der Theorie
- 1.3 Über den Zusammenhang von erlernter Hilflosigkeit und sozial unsicherem Verhalten
- 2. Der besondere Aspekt der Praxis
- 2.1 Elternsitzung
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht sozial unsicheres Verhalten bei Kindern basierend auf dem Ansatz von Petermann und Petermann. Ziel ist es, die zugrundeliegenden Erklärungskonzepte und insbesondere die Theorie der erlernten Hilflosigkeit zu erläutern und deren Relevanz für die Praxis zu verdeutlichen.
- Erklärungskonzepte für sozial unsicheres Verhalten
- Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman
- Zusammenhang zwischen erlernter Hilflosigkeit und sozial unsicherem Verhalten
- Praktische Implikationen für die Arbeit mit sozial unsicheren Kindern
- Bedeutung von Elternarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Theorie: Dieses Kapitel beschreibt sozial unsicheres Verhalten bei Kindern als einen Sammelbegriff für verschiedene Verhaltensweisen, die auf die Familiensituation und Sozialisation zurückzuführen sind. Es werden verschiedene Angstformen wie Trennungsangst, Kontaktangst und Überängstlichkeit diskutiert, die eng mit sozial unsicherem Verhalten verbunden sind. Die Autoren Petermann und Petermann führen soziale Angst und soziale Fertigkeitsdefizite als Hauptursachen an, wobei die Frage nach der zeitlichen Abfolge und wechselseitigen Beeinflussung individuell geklärt werden muss. Als Erklärungskonzepte werden Modelllernen, Verstärkungslernen, klassische Konditionierung und die Theorie der erlernten Hilflosigkeit vorgestellt. Diese Konzepte dienen nicht nur der Erklärung, sondern auch der Entwicklung von Übungsprogrammen zur Verbesserung sozialer Kompetenz.
2. Der besondere Aspekt der Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Aspekten der Arbeit mit sozial unsicheren Kindern, wobei der Fokus auf der Elternarbeit liegt. Konkrete Inhalte und Methoden zur Elternberatung werden hier vermutlich genauer beschrieben. Die Elternsitzung als wichtiger Bestandteil der Intervention wird erläutert, wobei der genaue Inhalt dieses Kapitels nicht ohne Weiteres aus dem Text entnommen werden kann.
Schlüsselwörter
Sozial unsicheres Verhalten, soziale Angst, soziale Fertigkeitsdefizite, erlernte Hilflosigkeit, Modelllernen, Verstärkungslernen, klassische Konditionierung, Angststörung, Elternarbeit, Intervention.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Sozial Unsicheres Verhalten bei Kindern
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit sozial unsicherem Verhalten bei Kindern. Es untersucht die zugrundeliegenden Erklärungskonzepte, insbesondere die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman, und deren Relevanz für die Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte sozial unsicheren Verhaltens, darunter Erklärungskonzepte wie Modelllernen, Verstärkungslernen und klassische Konditionierung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Theorie der erlernten Hilflosigkeit und ihrem Zusammenhang mit sozial unsicherem Verhalten. Der praktische Aspekt wird anhand der Elternarbeit und konkreter Interventionsmethoden (z.B. Elternsitzungen) beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 ("Theorie") befasst sich mit theoretischen Erklärungskonzepten und der Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Kapitel 2 ("Der besondere Aspekt der Praxis") konzentriert sich auf die praktische Anwendung, insbesondere die Elternarbeit. Kapitel 3 ("Fazit") fasst die Ergebnisse zusammen (der Inhalt dieses Kapitels ist im Preview nicht detailliert beschrieben).
Welche Erklärungskonzepte werden für sozial unsicheres Verhalten vorgestellt?
Das Dokument präsentiert verschiedene Erklärungskonzepte, darunter Modelllernen, Verstärkungslernen, klassische Konditionierung und die Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Diese Konzepte sollen das Auftreten von sozial unsicherem Verhalten erklären und Ansatzpunkte für Interventionen liefern.
Welche Rolle spielt die Theorie der erlernten Hilflosigkeit?
Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman spielt eine zentrale Rolle. Das Dokument erläutert diese Theorie und untersucht ihren Zusammenhang mit sozial unsicherem Verhalten bei Kindern. Sie dient als ein wichtiges Erklärungsmodell für die Entstehung und Aufrechterhaltung sozial unsicherer Verhaltensweisen.
Wie wird der praktische Aspekt behandelt?
Der praktische Aspekt konzentriert sich auf die Arbeit mit den Eltern sozial unsicherer Kinder. Die Elternsitzung wird als wichtiger Bestandteil der Intervention hervorgehoben, wobei die konkreten Inhalte und Methoden der Elternberatung im Dokument detaillierter beschrieben werden (jedoch nicht im Preview).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Sozial unsicheres Verhalten, soziale Angst, soziale Fertigkeitsdefizite, erlernte Hilflosigkeit, Modelllernen, Verstärkungslernen, klassische Konditionierung, Angststörung, Elternarbeit, Intervention.
Wer sind die Autoren (implizit)?
Der Text erwähnt Petermann und Petermann als Autoren, deren Ansatz zur Erklärung von sozial unsicherem Verhalten zugrunde liegt. Der genaue Titel ihrer Arbeit wird jedoch nicht genannt.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit den Themen sozial unsicheres Verhalten bei Kindern, psychologischen Erklärungskonzepten und Interventionsmethoden auseinandersetzt. Es ist als Grundlage für akademische Analysen und Forschung gedacht.
- Quote paper
- Benjamin Kristek (Author), 2002, Training mit sozial unsicheren Kindern nach Petermann und Petermann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41360