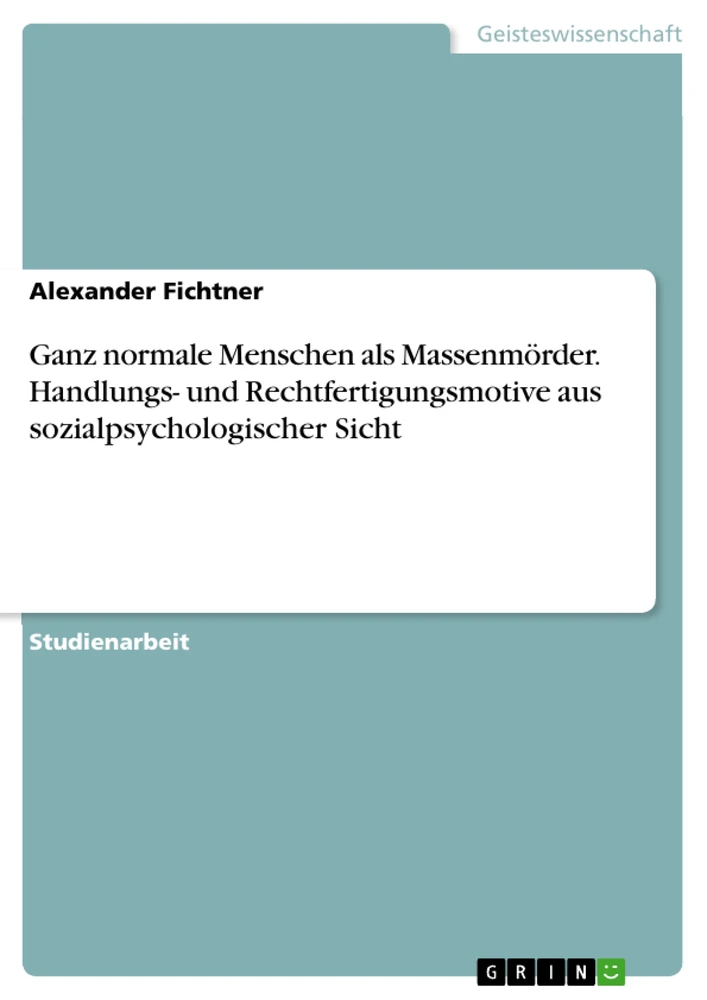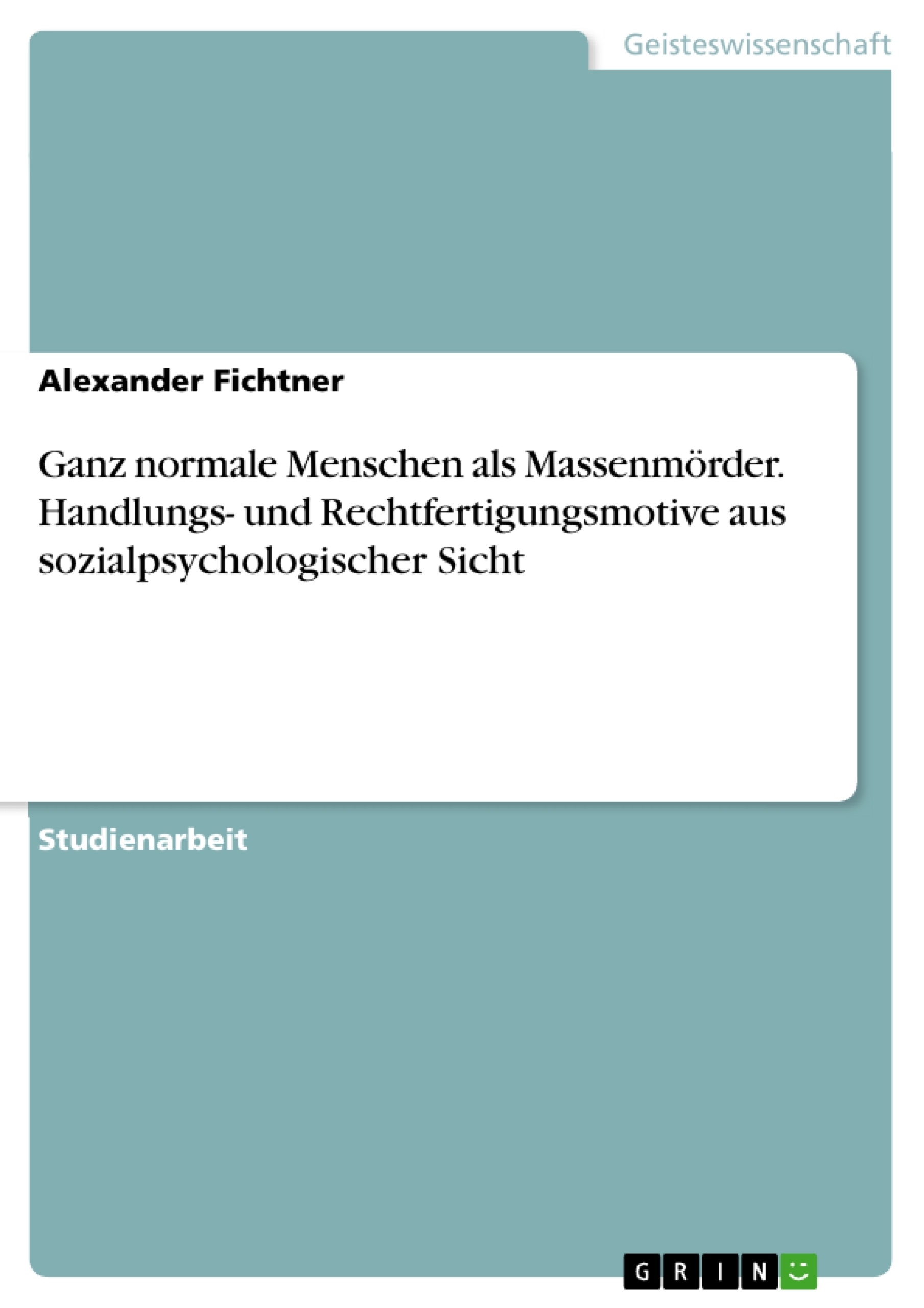Das Töten und die Begehung von Greueltaten im Krieg ist eine Erscheinung, die wir aus der Vergangenheit gut kennen. Auch Verbrechen wie Mord, Totschlag und Vergewaltigung sind bekannte Verbrechen, die in der Menschheitsgeschichte immer schon vorhanden waren. Weniger plausibel ist die Gegebenheit, dass auch ganz durchschnittliche Menschen – wenn die richtigen Umstände vorhanden sind – in der Lage sind, Gewalttaten zu begehen und diese auch rechtfertigen und mit dem eigenen Gewissen vereinbaren können. Das 20. Jahrhundert wurde häufig als das „Jahrhundert des Totalitarismus“ bezeichnet, da die totalitären Systeme – Kommunismus und Nationalsozialismus – viele Jahrzehnte das politische Klima dominierten. Auch die Verbrechen der totalitären Diktaturen zeigte eine neue Dimension. Im Nationalsozialismus kam es beispielsweise zu unvorstellbaren Exzessen, die von der NS-Führung befohlen wurden, aber (auch) von ganz gewöhnlichen Menschen – sie unterschieden sich nicht von dem gesellschaftlichen Durchschnitt - durchgeführt bzw. begangen wurden. Jedoch beschränkt sich ein solches Verhalten nicht auf autoritäre oder totalitäre Regime, sondern es zeigt sich beispielsweise auch bei Menschen, die in freiheitlichen Demokratien sozialisiert wurden, wie Harald Welzer am Beispiel von Greueltaten US-amerikanischer Soldaten in Vietnam zeigt.
Diese Arbeit will dem Phänomen nachgehen, warum scheinbar ganz normale Menschen zu Massenmördern werden - verbrecherisch handeln - sofern sie in eine Befehlshierarchie eingebunden sind, die das Töten erlaubt und sogar ausdrücklich honoriert. Diese sozialpsychologische Sichtweise wird anhand von Gustave Le Bons, Hannah Arendts und besonders Harald Welzers Thesen untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Massenmord aus sozialpsychologischer Sicht
- Durchführung und Rechtfertigung von Massenmord durch Befehlshierarchien und soziale Zugehörigkeit
- Massenmord als moralisches Projekt
- Harald Welzer: Wie und warum man Feinde vernichtet
- Beispiel Vietnam
- Beispiel Ruanda
- Beispiel Jugoslawien
- Kritik bzw. Gegenpositionen zu der sozialpsychologischen Interpretation
- Persönlichkeit der Täter
- Überzeugungen als wichtige Triebquelle für verbrecherisches Handeln
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen, warum scheinbar normale Menschen zu Massenmördern werden, insbesondere im Kontext von Befehlshierarchien, die Töten erlauben und sogar honorieren. Der sozialpsychologische Ansatz wird im Mittelpunkt stehen, unter Berücksichtigung der Thesen von Gustave Le Bon, Hannah Arendt und Harald Welzer. Das Ziel ist, die Handlungs- und Rechtfertigungsmechanismen zu verstehen und daraus mögliche Interventionsmöglichkeiten abzuleiten, insbesondere für die Erziehungswissenschaft.
- Sozialpsychologische Erklärungen für Massenmord
- Der Einfluss von Befehlshierarchien und sozialer Zugehörigkeit
- Massenmord als moralisches Projekt
- Analyse von Fallbeispielen (Vietnam, Ruanda, Jugoslawien)
- Kritik und Gegenpositionen zum sozialpsychologischen Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Motiven und Rechtfertigungsmustern von scheinbar normalen Menschen, die Massenmord begehen, vor. Sie betont die besondere Relevanz des Themas im 20. Jahrhundert, vor allem im Kontext totalitärer Regime, und erweitert den Blick auf freiheitliche Demokratien, unter Verweis auf Beispiele wie die Gräueltaten US-amerikanischer Soldaten in Vietnam. Die Arbeit fokussiert auf einen sozialpsychologischen Ansatz und die Bedeutung des Verständnisses von Handlungs- und Rechtfertigungsmechanismen für präventive Maßnahmen in Bildung und Erziehung.
Forschungsstand: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zum Thema. Es werden die Beiträge von Gustave Le Bon mit seiner "Psychologie der Massen", Sigmund Freuds "Massenpsychologie und Ich-Analyse" und Hannah Arendts Analyse des Totalitarismus in "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" erwähnt und zusammenfassend dargestellt. Zusätzlich werden relevante sozialpsychologische Experimente wie das Milgram-Experiment und das Stanford-Prison-Experiment als Bezugspunkte genannt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der psychologischen Prozesse in Massen und deren Auswirkungen auf individuelles Verhalten.
Massenmord aus sozialpsychologischer Sicht: Dieses Kapitel untersucht den sozialpsychologischen Ansatz vertieft und greift insbesondere die Erkenntnisse von Harald Welzer auf. Es analysiert, wie Befehlshierarchien und soziale Zugehörigkeit die Durchführung und Rechtfertigung von Massenmord beeinflussen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Betrachtung von Massenmord als moralisches Projekt, wobei die Frage untersucht wird, wie Täter ihre Taten moralisch rechtfertigen können.
Harald Welzer: Wie und warum man Feinde vernichtet: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien aus Vietnam, Ruanda und Jugoslawien, um die von Harald Welzer identifizierten Bedingungen zu veranschaulichen, unter denen "normale Menschen" zu Massenmördern werden. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie die von Welzer beschriebenen Faktoren in den jeweiligen Kontexten wirkten und zu den Gräueltaten beitrugen. Die Kapitel beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Fallbeispiele.
Kritik bzw. Gegenpositionen zu der sozialpsychologischen Interpretation: Dieses Kapitel beleuchtet kritische Stimmen und alternative Erklärungen für das verbrecherische Verhalten von Tätern. Es werden Gegenpositionen zum sozialpsychologischen Ansatz vorgestellt, die beispielsweise die Persönlichkeit der Täter oder deren Überzeugungen als zentrale Triebfedern des Handelns hervorheben. Die unterschiedlichen Perspektiven werden kontrastiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
Massenmord, Sozialpsychologie, Befehlshierarchie, soziale Zugehörigkeit, moralisches Projekt, Handlungsmotive, Rechtfertigungsstrategien, Totalitarismus, Gustave Le Bon, Hannah Arendt, Harald Welzer, Vietnam, Ruanda, Jugoslawien, Persönlichkeit, Überzeugungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Massenmord aus sozialpsychologischer Sicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sozialpsychologischen Ursachen von Massenmord, insbesondere die Frage, warum scheinbar normale Menschen zu solchen Taten fähig sind. Sie konzentriert sich auf den Einfluss von Befehlshierarchien, sozialer Zugehörigkeit und der moralischen Rechtfertigung von Gewalt.
Welche Theorien und Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf sozialpsychologische Theorien, insbesondere die Ansätze von Gustave Le Bon, Hannah Arendt und Harald Welzer. Sie bezieht sich auch auf relevante Experimente wie das Milgram-Experiment und das Stanford-Prison-Experiment. Kritische Gegenpositionen und alternative Erklärungen, die z.B. die Persönlichkeit der Täter oder deren Überzeugungen betonen, werden ebenfalls diskutiert.
Welche Fallbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Fälle von Massenmord in Vietnam, Ruanda und Jugoslawien, um die Theorien anhand konkreter Beispiele zu veranschaulichen und die von Harald Welzer beschriebenen Faktoren zu untersuchen.
Welche Rolle spielen Befehlshierarchien und soziale Zugehörigkeit?
Die Arbeit untersucht, wie Befehlshierarchien und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe die Durchführung und die moralische Rechtfertigung von Massenmord beeinflussen. Es wird gezeigt, wie diese Faktoren dazu beitragen können, dass Individuen Handlungen begehen, die sie unter anderen Umständen als moralisch verwerflich ansehen würden.
Wie wird Massenmord als moralisches Projekt betrachtet?
Die Arbeit analysiert, wie Täter ihre Taten moralisch rechtfertigen. Es wird untersucht, welche Mechanismen und Strategien eingesetzt werden, um die eigene moralische Verantwortung zu relativieren oder zu leugnen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Handlungs- und Rechtfertigungsmechanismen von Massenmördern zu verstehen, um daraus mögliche Interventionsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich der Erziehungswissenschaft, abzuleiten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Massenmord, Sozialpsychologie, Befehlshierarchie, soziale Zugehörigkeit, moralisches Projekt, Handlungsmotive, Rechtfertigungsstrategien, Totalitarismus, Gustave Le Bon, Hannah Arendt, Harald Welzer, Vietnam, Ruanda, Jugoslawien, Persönlichkeit, Überzeugungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Forschungsstand, ein Kapitel zum sozialpsychologischen Ansatz von Massenmord, ein Kapitel zu den Fallstudien von Harald Welzer (Vietnam, Ruanda, Jugoslawien), ein Kapitel zur Kritik am sozialpsychologischen Ansatz und eine Schlussbetrachtung.
- Arbeit zitieren
- Alexander Fichtner (Autor:in), 2017, Ganz normale Menschen als Massenmörder. Handlungs- und Rechtfertigungsmotive aus sozialpsychologischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413427