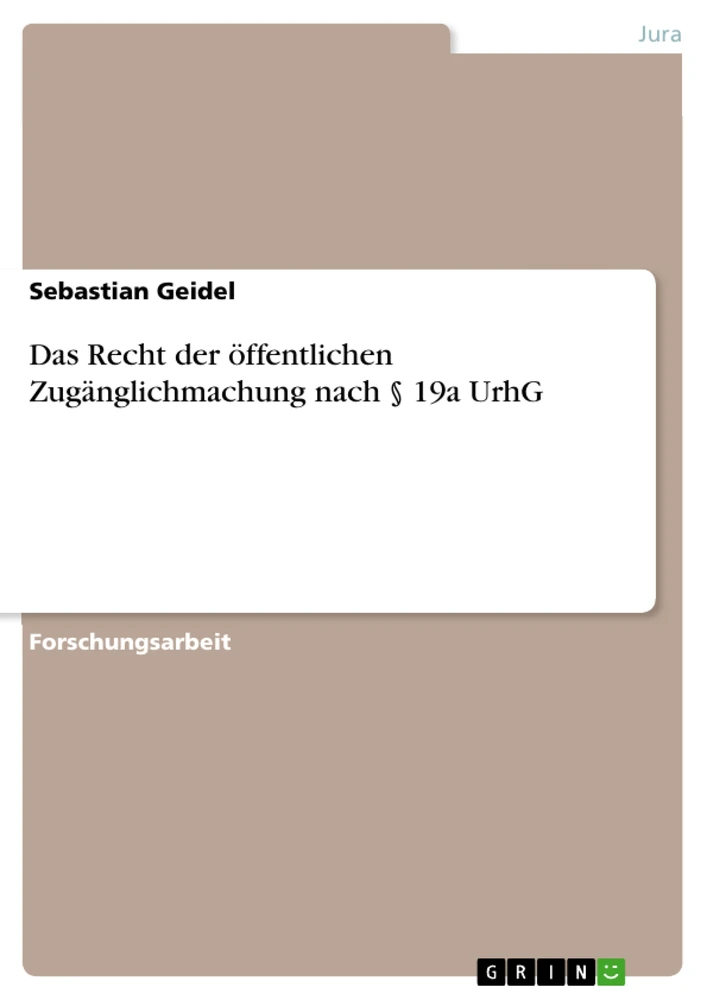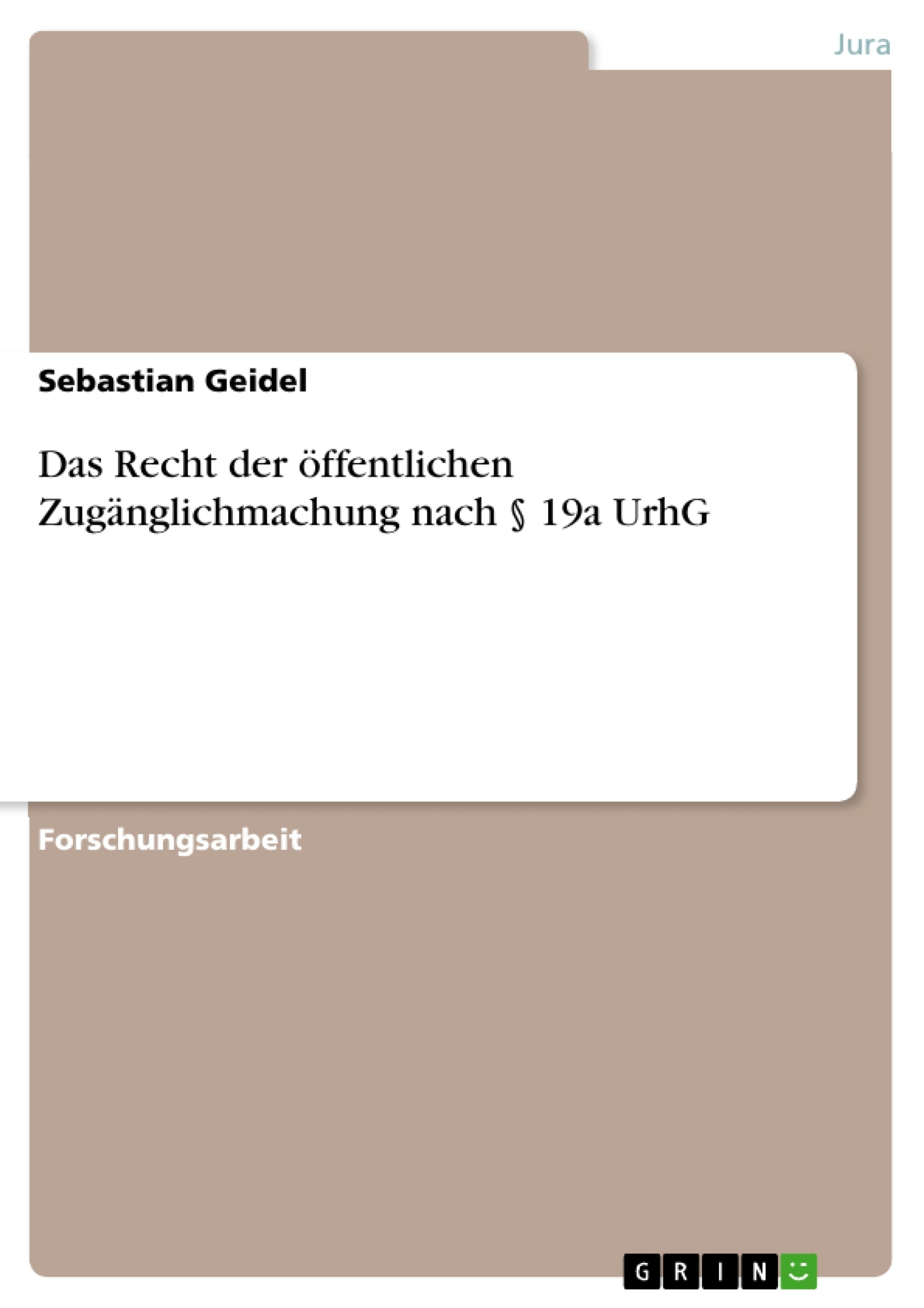Dass „das Internet für uns alle Neuland" ist, wie Frau Dr. Merkel 2013 bemerkte, kann gerne als strittige Aussage dahingestellt sein. Was jedoch zweifellos der Fall ist, dass sich mit der digitalen Revolution auch neue Rechtsprobleme eröffnet haben, mit denen vor 30 Jahren noch keiner gerechnet hätte. Um dennoch nicht den Schutz von Urhebern aus dem Blick zu verlieren, ist sowohl der europäische als auch der deutsche Gesetzgeber gefordert den neuen Umständen Rechnung zu tragen.
Die nachfolgende Arbeit soll sich mit dem Thema „Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG" beschäftigen. Mit dessen Einführung den Urhebern ein neues Verwertungsrecht an die Hand gegeben wird, zur öffentlichen Zugänglichmachung von geschützten Werken.
Wie die Entstehungsgeschichte zeigen wird, ist diese Norm jedoch nicht gänzlich neu, sondern bestand schon vorher, wobei die Einordnung in die Verwertungsrecht schwierig gestaltete. Die sperrige Formulierung dieser Norm soll ebenfalls analysiert werden und hierbei die Frage geklärt werden, was genau unter den Rechtsbegriff „öffentlich Zugänglichmachen" zu verstehen ist.
In einem weiteren Schritt werden die Tatbestandsmerkmal des § 19a UrhG dargestellt. Mit denen eine genauere Abgrenzung zu anderen Verwertungsrechten des Urheberrechts vorgenommen werden kann.
Das Internet bietet verschiedene Nutzungsformen, so kann man Werke mittels eines Links zugänglich machen, oder sie via E-Mail versenden. Die rechtliche Würdigung dieser einzelnen Nutzungsformen, soll zumindest beispielhaft ein weiterer Bestandteil der Arbeit sein.
Eine Abgrenzung zu anderen Verwertungsrechten, sowie die Darstellung der Schrankenbestimmungen, soll diese Analyse von § 19a UrhG abrunden. Ziel ist es einen Überblick über die Norm zu verfassen und auf bestehende Problemfelder hinzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Herkunft, Bedeutung und Terminologie des § 19a UrhG
- a. Herkunft und Umsetzung der EU-Richtlinie
- b. Das Verhältnis zu den internationalen Verträgen
- c. Bedeutung
- d. Terminologie
- 2. Übertragung auf Abruf als Teil des § 19a UrhG
- 3. Begriffsbestimmung
- a. Drahtgebunden und drahtlos
- b. Öffentlichkeit
- c. Zugänglich machen
- d. vom Ort und Zeit ihrer Wahl
- 4. Zuordnung einzelner Nutzungsformen
- a. Unstrittige Nutzungsformen
- b. strittige Nutzungsformen
- (1). Kopierversand per E-Mail und Videorecording
- (2). Near On-Demand Diensten
- (3). Verlinken von Werken
- aa. einfache Hyperlinks und Deep-Links
- bb. Framing
- cc. Grenzen der freien Verlinkung
- dd. Linksetzung und Framing von rechtswidrige Webseiten
- 5. Abgrenzung zu anderen Verwertungsrecht
- a. Abgrenzung zu §§ 16-18 UrhG
- b. Abgrenzung zu den Rechten der Wahrnehmbarmachung
- c. Abgrenzung zum Senderecht
- 6. Schrankenbestimmungen
- II. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG. Ziel ist es, die Herkunft, Bedeutung und die Anwendung dieses Paragraphen im Kontext des Urheberrechts zu untersuchen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung zu anderen Verwertungsrechten und der Klärung strittiger Nutzungsformen im digitalen Raum.
- Begriffsbestimmung der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG
- Abgrenzung zu anderen verwandten Rechtsbereichen des Urheberrechts
- Analyse strittiger Nutzungsformen, insbesondere im digitalen Kontext (z.B. Linking, Streaming)
- Die Rolle des § 19a UrhG im Spannungsfeld zwischen Urheberrechten und technischem Fortschritt
- Schrankenbestimmungen des § 19a UrhG
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, die Bedeutung und die Terminologie des Paragraphen im Kontext der EU-Richtlinien und internationalen Verträge. Die Einleitung legt den Grundstein für die weitere Untersuchung, indem sie die zentralen Begriffe und die Problematik der "Übertragung auf Abruf" im digitalen Zeitalter definiert und einordnet. Sie skizziert die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden, wie die Abgrenzung zu anderen Nutzungsrechten und die Einordnung verschiedener, teilweise umstrittener, digitaler Anwendungsmöglichkeiten.
II. Fazit: (Kein Fazit enthalten, da nach Aufgabenstellung keine Zusammenfassung des Schlusskapitels gewünscht ist)
Schlüsselwörter
§ 19a UrhG, Öffentliche Zugänglichmachung, Urheberrecht, Digitale Medien, Übertragung auf Abruf, Verwertungsrecht, Hyperlinks, Streaming, On-Demand-Dienste, Schrankenbestimmungen, EU-Richtlinie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG. Ziel ist die Untersuchung der Herkunft, Bedeutung und Anwendung dieses Paragraphen im Urheberrecht, insbesondere die Abgrenzung zu anderen Verwertungsrechten und die Klärung strittiger Nutzungsformen im digitalen Raum.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG, die Abgrenzung zu anderen verwandten Rechtsbereichen des Urheberrechts, die Analyse strittiger Nutzungsformen (z.B. Linking, Streaming), die Rolle des § 19a UrhG im Spannungsfeld zwischen Urheberrechten und technischem Fortschritt und die Schrankenbestimmungen des § 19a UrhG.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung und ein Fazit. Die Einleitung umfasst die Herkunft, Bedeutung und Terminologie des § 19a UrhG (inkl. EU-Richtlinien und internationaler Verträge), die Übertragung auf Abruf, Begriffsbestimmungen (drahtgebunden/drahtlos, Öffentlichkeit, Zugänglichmachung etc.), die Zuordnung einzelner Nutzungsformen (unstrittige und strittige, z.B. Kopierversand per E-Mail, Videorecording, Near On-Demand Dienste, Verlinken von Werken inkl. Hyperlinks, Deep-Links, Framing und deren Grenzen), und die Abgrenzung zu anderen Verwertungsrechten (§§ 16-18 UrhG, Wahrnehmbarmachung, Senderecht). Ein Fazit ist zwar vorgesehen, aber im vorliegenden Auszug nicht enthalten.
Welche strittigen Nutzungsformen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere strittige Nutzungsformen im digitalen Kontext, wie z.B. das Verlinken von Werken (einfache Hyperlinks, Deep-Links, Framing), die Einordnung von Streaming-Diensten und Near-On-Demand-Diensten. Die Problematik der Linksetzung und des Framings von rechtswidrigen Webseiten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen § 19a UrhG, Öffentliche Zugänglichmachung, Urheberrecht, Digitale Medien, Übertragung auf Abruf, Verwertungsrecht, Hyperlinks, Streaming, On-Demand-Dienste, Schrankenbestimmungen und EU-Richtlinie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendung des § 19a UrhG im Kontext des Urheberrechts zu untersuchen und die Problematik der öffentlichen Zugänglichmachung im digitalen Zeitalter zu klären. Ein besonderer Fokus liegt auf der Abgrenzung zu anderen Verwertungsrechten und der Einordnung umstrittener Nutzungsformen.
- Quote paper
- Dipl. jur Sebastian Geidel (Author), 2016, Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413283