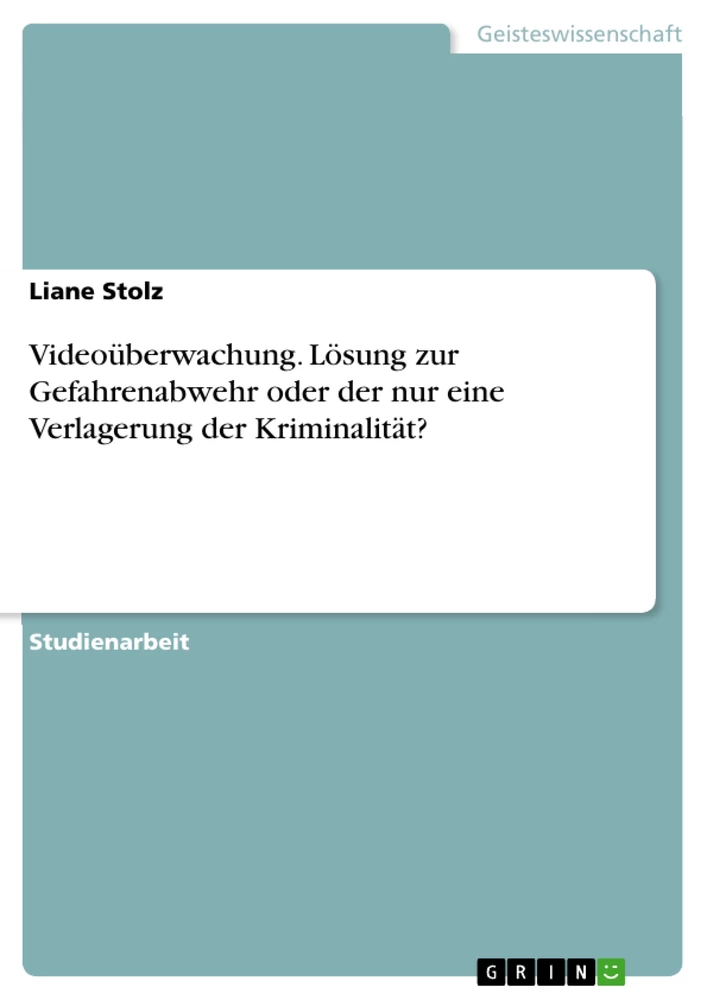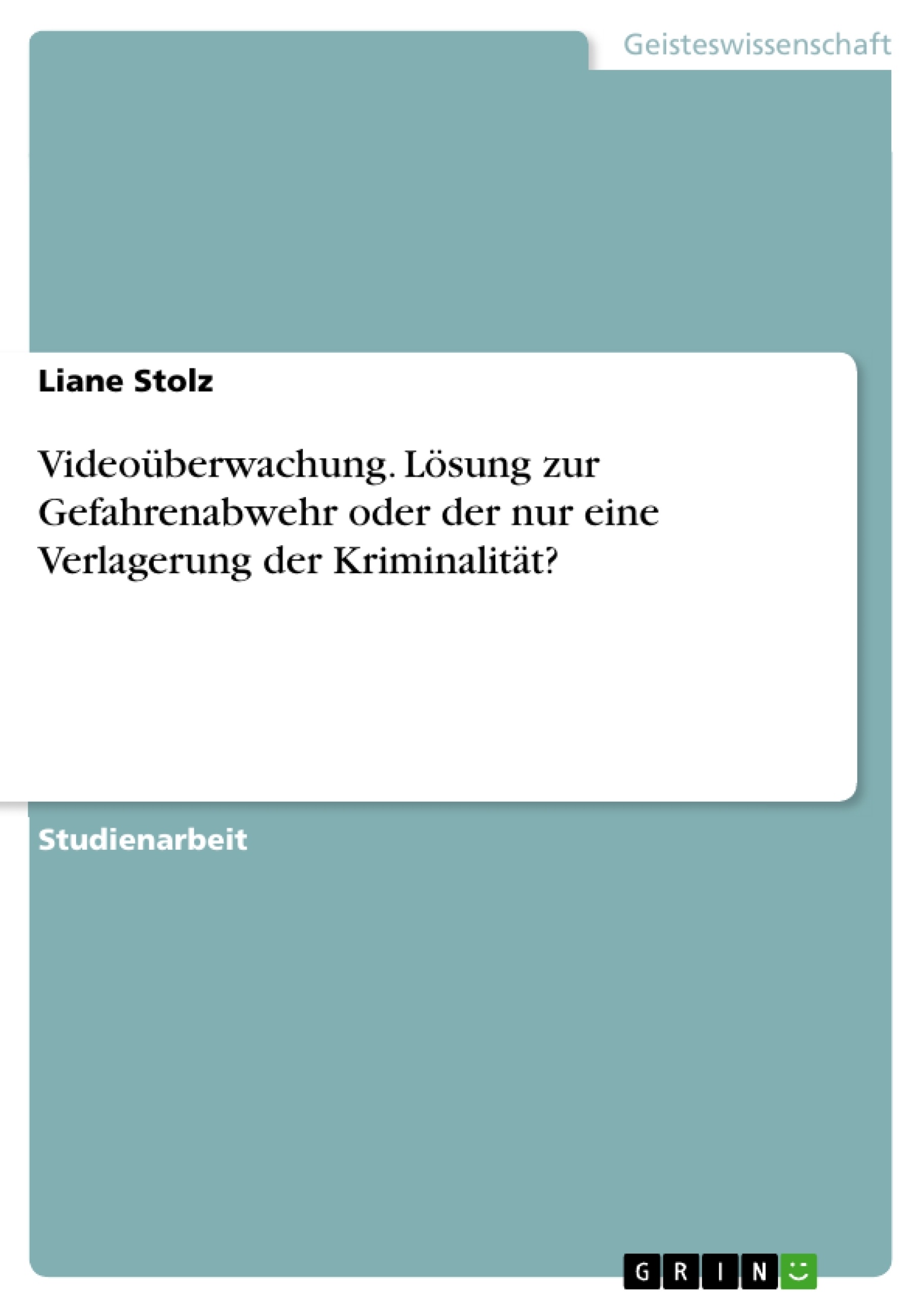Ein Anschlag jagt den nächsten. Einer Straftat folgt die nächste. Nach jedem Delikt geht die Diskussion um die Videoüberwachung erneut von vorne los. Die Politik fordert seit langem eine schärfere Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen, um Straftaten vorzubeugen. So fordert auch die SPD einen stärkeren Gebrauch von Videoüberwachung, um dem Terror ein Ende zu setzen. Auch Wolfgang Schäuble forderte schon 2006 die Ausweitung der Videoüberwachung zum Schutz vor Straftaten.
Die Frage ist, ob ein Ende des Terrors durch Videoüberwachung zu erreichen ist. Videoüberwachung soll nicht nur die Begehung von Straftaten verhindern, sondern auch psychologische Aspekte aufgreifen. Dazu gehört, das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu steigern. Dem steht jedoch die Angst eines Überwachungsstaates entgegen, welches die Grundrechtsausübung der Bürger beschränken würde. Andere sind der Meinung, eine Videoüberwachung führe nicht zu mehr Sicherheit, sondern wiege lediglich den Bürger in Sicherheit und würde den Personalmangel der Polizei verschleiern. Zudem wird bezweifelt, ob eine Überwachung allein den Effekt einer Kriminalitätsverlagerung, also einen Verdrängungseffekt, bewirke. Zusammengefasst stellt sich somit die Frage, ob Videoüberwachung – politisch gewünscht – ein taugliches Mittel zur Gefahrenabwehr ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlage zur Videoüberwachung
- Wie weit darf gegangen werden? Gefahrenabwehr vs. Grundrechtsschutz!
- Videoüberwachung – Ein taugliches Mittel zur Gefahrenabwehr?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Frage, ob Videoüberwachung ein wirksames Mittel zur Gefahrenabwehr ist. Er untersucht die rechtlichen Grundlagen, die ethischen und praktischen Herausforderungen sowie die Auswirkungen auf die Sicherheit und die Grundrechte der Bürger.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Videoüberwachung
- Abwägung zwischen Gefahrenabwehr und Grundrechtsschutz
- Effektivität und Grenzen der Videoüberwachung
- Psychologische Aspekte der Videoüberwachung
- Diskussion um den Überwachungsstaat
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Diskussion um Videoüberwachung dar und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente. Sie verdeutlicht die aktuelle Debatte um die Ausweitung der Videoüberwachung im Kontext von Terrorismus und Kriminalität.
- Gesetzliche Grundlage zur Videoüberwachung: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen für die Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Bereichen. Es analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die spezifische Rechtslage in Nordrhein-Westfalen.
- Wie weit darf gegangen werden? Gefahrenabwehr vs. Grundrechtsschutz!: Dieses Kapitel diskutiert die Spannungsverhältnisse zwischen der Notwendigkeit der Gefahrenabwehr und dem Schutz der Grundrechte der Bürger. Es befasst sich mit der Frage, inwieweit Videoüberwachung zulässig ist und welche Grenzen einzuhalten sind.
- Videoüberwachung – Ein taugliches Mittel zur Gefahrenabwehr?: Dieses Kapitel untersucht die Effektivität und Wirksamkeit der Videoüberwachung als Instrument der Gefahrenabwehr. Es analysiert die Argumente für und gegen die Videoüberwachung und diskutiert mögliche Auswirkungen wie Kriminalitätsverlagerung.
Schlüsselwörter
Videoüberwachung, Gefahrenabwehr, Grundrechte, Datenschutz, Überwachungsstaat, Kriminalität, Terrorismus, Rechtliche Rahmenbedingungen, Effektivität, Kriminalitätsverlagerung, psychologischer Effekt, öffentliche Sicherheit, Bürgerrechte.
- Quote paper
- Liane Stolz (Author), 2017, Videoüberwachung. Lösung zur Gefahrenabwehr oder der nur eine Verlagerung der Kriminalität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413164