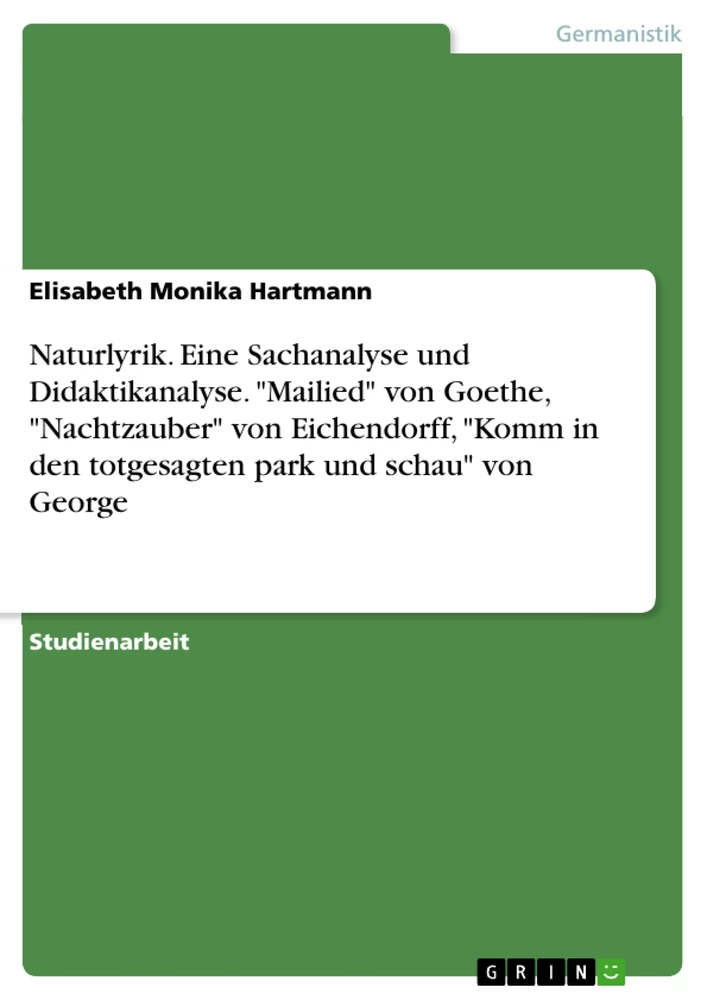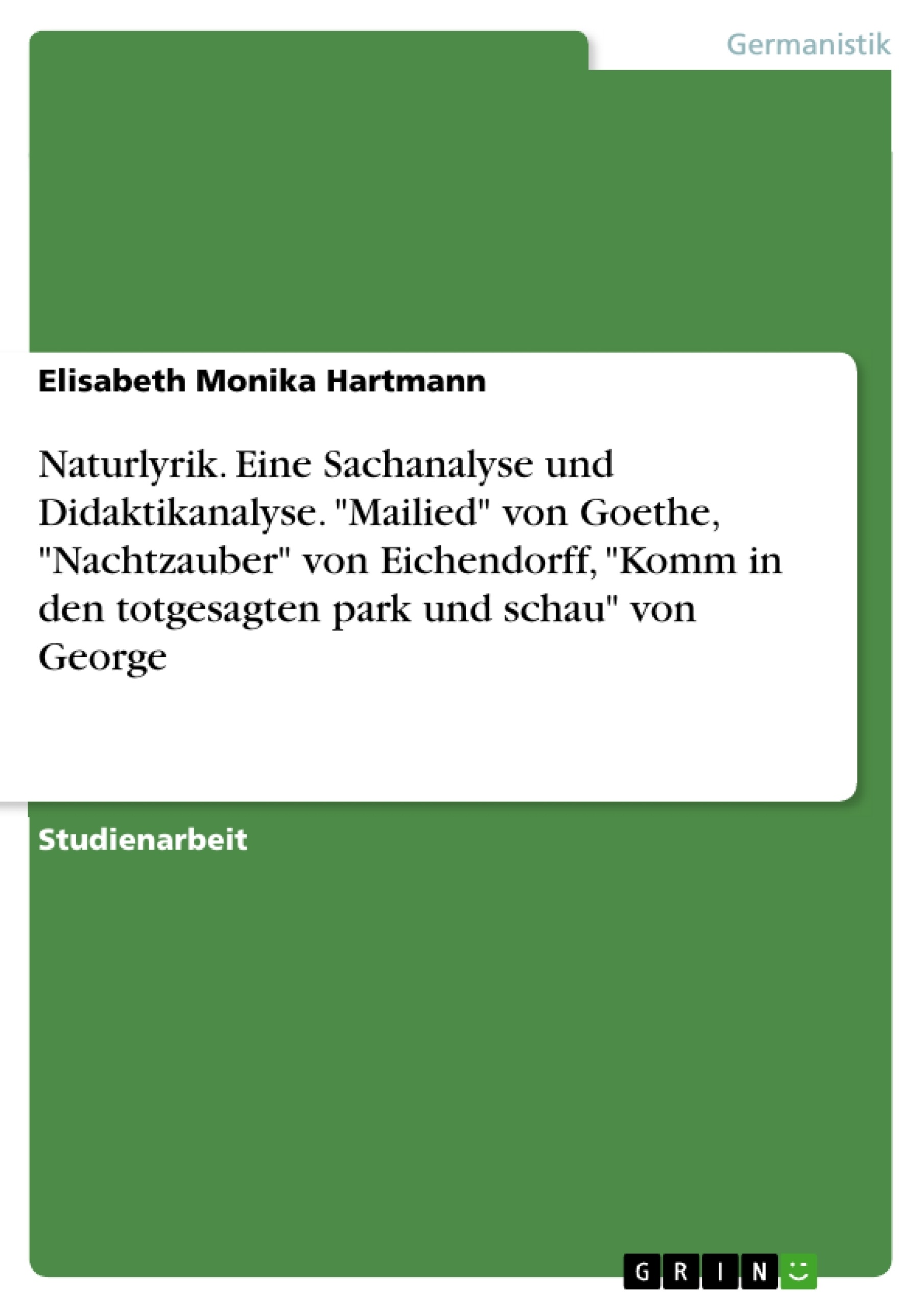Das 1771 entstandene Gedicht „Mailied“ gehört zur Erlebnislyrik des jungen Goethe. Diese Zeit ist stark von einer Gefühlsintensität geprägt, da Goethe auf der Suche nach dem Ursprünglichen beziehungsweise Volkstümlichen in der Dichtung war und Emotionen die Rationalität unterdrückt haben. Diese Emotionalität wird durch die vielen Ausrufezeichen verstärkt.
Bei der Analyse des „Mailieds“ stellt sich die Frage nach der formalen Einheit. Das Gedicht ist in zweihebigen Kurzzeilen geschrieben und wirkt auf den Leser deshalb etwas stürmisch und atemlos. Das lyrische Ich scheint hier voller Enthusiasmus zu stecken und gibt seine Freude dem Leser kund. Die Alternation von Hebung und Senkung bildet eine gewisse Kontinuität und Regelmäßigkeit. Der Parallelismus und die Anapher als Wiederholung des Versanfangs verstärken die Kontinuität und steigern zugleich ebenso den Augenblick. Durch den Daktylus – einem Hintereinander einer schweren und zwei leichten Silben – gewinnt das Gedicht jedoch auch wieder an Unregelmäßigkeit und ein subjektiver Eindruck wird erweckt. Es gibt eine Unausgewogenheit beziehungsweise Bewegung, aber zugleich auch eine Ordnung. Bei dem Ausruf „Mir die Natur!“ ist alles immer betont und man kann diesen als einzigen Vers betrachten, der auftaktlos ist. Hier kommt das Gefühl des „In-der-Welt-Seins“ auf („die volle Welt“) als aufklärerisches Denken und kalkulierte Unmittelbarkeit. Der zuweilen unregelmäßige Kreuzreim, der keine Kontinuität bildet, ist von Goethe bedacht und bewusst eingesetzt worden.
In diesem Gedicht der Emotion wird ein Kosmos aufgebaut, der sich organisch über die Strophen eins bis vier erstreckt. Das Wörtchen „dringen“ erhält eine Sinnaufgabe für mehrere Strophen. Auch die Strophen sind keine fest gegeneinander abgegrenzten Einheiten; die meisten öffnen sich zur jeweils folgenden Zeile als sogenannten Zeilensprung oder Enjambement. Dies zeigt den Schaffensrausch des lyrischen Ichs, als ob es mündlich mitgeteilt werde. Der Grundrhythmus soll aufgehoben werden, da der Satz über das Versende hinaus in den nächsten Vers hinein läuft. Auch die Satzstruktur wird zerstört und die Sprache löst sich auf, wobei eine Grenze zu sehen ist. Die Volksliedstrophe des „Mailied“ ist holprig und nicht ganz regelmäßig.
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Unterrichtssequenz: Gedichtanalysen
- Mailied (Johann Wolfgang von Goethe)
- Nachtzauber (Joseph von Eichendorff)
- ,,Komm in den totgesagten park und schau:“ (Stefan George)
- Gedichtvergleich
- Legitimation und Didaktikanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse und didaktischen Relevanz von drei Gedichten der deutschen Literatur. Der Fokus liegt auf der Beleuchtung der formalen und inhaltlichen Besonderheiten sowie auf der Klärung der jeweiligen ästhetischen und ideengeschichtlichen Hintergründe.
- Formal- und Inhaltsanalyse der Gedichte
- Vergleich der drei Gedichte
- Legitimation des Einsatzes der Gedichte im Unterricht
- Didaktische Analyse der ausgewählten Gedichte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Sachanalyse
1.1 Unterrichtssequenz: Gedichtanalysen
1.1.1 Mailied (Johann Wolfgang von Goethe)
Das Gedicht „Mailied“ von Johann Wolfgang von Goethe (1771) zeichnet sich durch eine lyrische, gefühlsbetonte Sprache aus, die die Suche nach dem Ursprünglichen und Volkstümlichen in der Dichtung widerspiegelt. Die formale Analyse des Gedichts zeigt eine stürmische, atemlose Struktur mit zweizeiligen Kurzzeilen und einem unregelmäßigen Kreuzreim. Die Strophen sind nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern durch Enjambements miteinander verbunden, was den Schaffensrausch des lyrischen Ichs unterstreicht. Die Natur wird im „Mailied“ als Ausdruck göttlicher Liebe und Schöpfungskraft dargestellt, wobei sich ein spinozistische Pantheismus bemerkbar macht. Die ewige Glückseligkeit bildet das Ziel des Menschen auf Erden.
1.1.2 Nachtzauber (Joseph von Eichendorff)
Das Gedicht „Nachtzauber“ von Joseph von Eichendorff (1853) thematisiert die romantische Unendlichkeit der Natur, die in Träumen und Phantasien erfahren wird. Formal wird der typische Romantik-Stil mit unklarer Regelhaftigkeit und einem Wechsel zwischen Eros und Thanatos verwendet. Der Dichter setzt Synästhesien ein, die das Akustische mit dem Räumlichen verbinden. Die Nacht spielt eine wichtige Rolle als Zeit der Auflösung und des Übergangs in das Unbewusste. Das lyrische Ich erlebt eine Vision von Liebe und Schönheit, die im Kontext der mittelalterlichen Schönheitsideals verortet werden kann.
1.1.3 „Komm in den totgesagten park und schau:“ (Stefan George)
Stefan George (1897) gilt als Vertreter des Ästhetizismus, einer Strömung innerhalb der literarischen Moderne, die die Kunst als autonom und zweckfrei sieht (l'art pour l'art). Das Gedicht „Komm in den totgesagten park und schau:“ markiert eine Abgrenzung von der gesellschaftlichen Moderne und etabliert eine Gegenwelt zur Gesellschaft. Die Kunst wird als Entwurf einer Gegenwelt angesehen, die das Hässliche der Gegenwart ausschließt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt zentrale Themen der deutschen Literatur, wie beispielsweise die Erlebnislyrik, den Spinozistische Pantheismus, die Romantik, den Ästhetizismus und die literarische Moderne. Die Schwerpunkte liegen auf der Analyse von formalen und inhaltlichen Merkmalen, der Interpretation von Symbolen und Motiven, sowie der Klärung der jeweiligen ästhetischen und ideengeschichtlichen Hintergründe.
- Quote paper
- B.A. Elisabeth Monika Hartmann (Author), 2017, Naturlyrik. Eine Sachanalyse und Didaktikanalyse. "Mailied" von Goethe, "Nachtzauber" von Eichendorff, "Komm in den totgesagten park und schau" von George, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412951