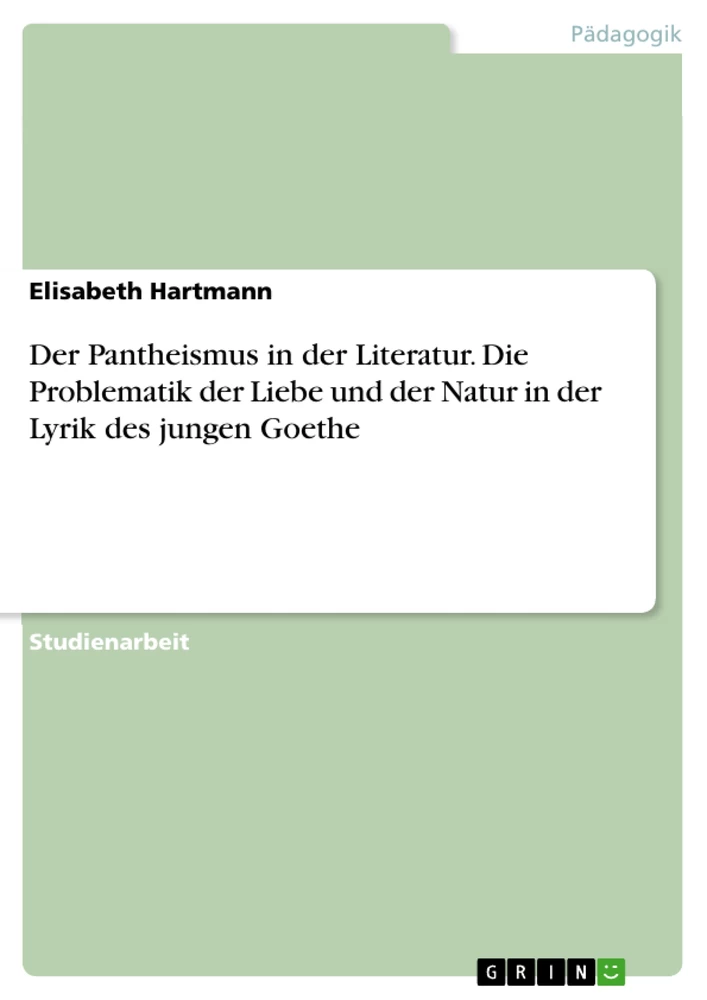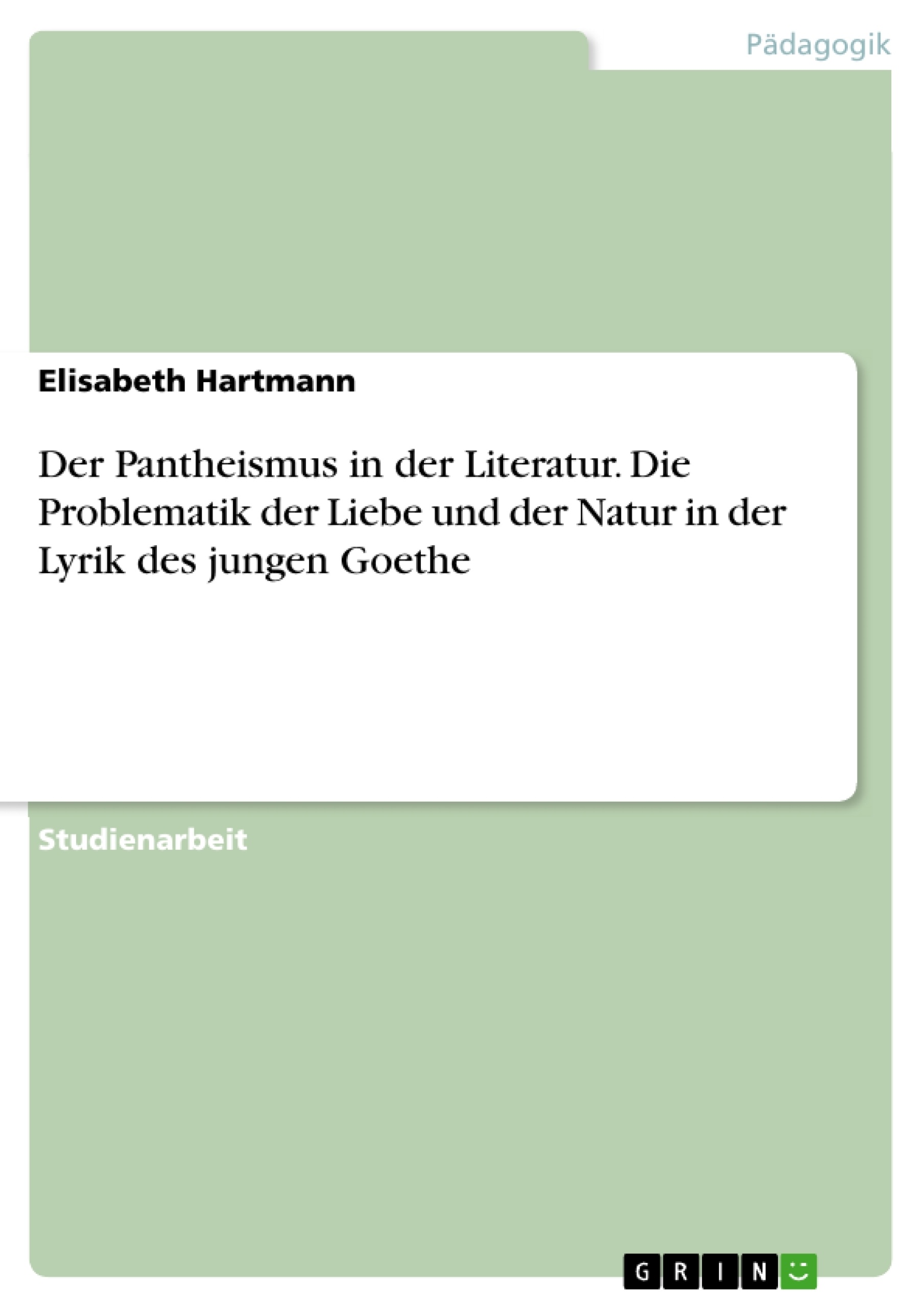Der Begriff des Pantheismus entwickelte sich im Zeitalter der Aufklärung. Er wurde 1709 von dem niederländischen Theologen J. De La Faye in einer gegen den irischen Freidenker John Toland (1670-1722) gerichteten Streitschrift geprägt. John Toland hatte die Lehre der Pantheisten, von denen er erstmals 1705 spricht, in seinen "Origines Judaicae" von 1709 auf die Formel gebracht.
Die bedeutendsten literarischen und philosophischen Vertreter des Pantheismus sind Baruch de Spinoza, Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Schleiermacher und Friedrich Schelling (im weiteren Sinne).
Grundlegender Gedanke des Pantheismus ist, dass der Mensch die Einsicht gewinnt, die uns gegebene Natur mit ihren Gesetzen oder Ideen (Erscheinungen/Gestalten) sinnlich wahrzunehmen und dabei "Göttliches" empfindet, das von keinem Materialismus und Sensualismus erklärt werden kann. Dieses "Göttliche" entziehe sich immer einer vollen Erkenntnis. Wir haben von ihm nur eine "bildliche Vorstellung" im Reich der Poesie und nur eine "hypothetische Erklärung" im Reich der Philosophie. Aus historischer Perspektive der Philosophie diene der Terminus zur Kennzeichnung der antiken Philosophie der Eleaten (Xenophanes, Parmenides, Zenon).
Der Begriff Pantheismus (von altgriechisch: "alles Gott" beziehungsweise "Allgottvorstellung") bezeichnet also demnach die Anschauung, Gott sei eins mit dem Kosmos und der Natur, Welt und Gott identisch. Die Welt beziehungsweise Natur sei Gott (Einheits- und Ursprungsgedanke Goethes). Es entsteht gedanklich also eine Einheit des "Ich" (Gott) mit der Welt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethe und der Pantheismus
- Verschiedene Auslegungen und Formen des Pantheismus
- Hauptteil
- Analyse und Interpretation des Gedichts „Mailied" (1771)
- Der Konflikt zwischen Liebe und Natur
- Die Liebe bei Goethe
- Die Natur bei Goethe
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik der Liebe und der Natur in der Lyrik des jungen Goethe im Kontext des Pantheismus. Sie analysiert das Gedicht „Mailied" (1771) und setzt es in Beziehung zu Goethes philosophischer Denkweise.
- Goethes pantheistische Ansichten
- Die Rolle der Natur in Goethes Werk
- Der Konflikt zwischen Liebe und Natur in der Lyrik Goethes
- Die Bedeutung des „Mailieds" als Ausdruck dieser Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt den Begriff des Pantheismus ein und erläutert seine historische Entwicklung. Sie stellt die wichtigsten Vertreter des Pantheismus vor und gibt einen Überblick über die grundlegenden Gedanken dieser philosophischen Strömung.
Goethe und der Pantheismus
Dieser Abschnitt beleuchtet Goethes eigene philosophische Positionierung und zeigt auf, wie sich seine pantheistischen Ansichten in seinen Werken manifestieren. Er setzt Goethes Denken in Beziehung zu anderen wichtigen Denkern des Pantheismus.
Verschiedene Auslegungen und Formen des Pantheismus
Dieser Abschnitt diskutiert verschiedene Auslegungen und Formen des Pantheismus, die in der Geschichte der Philosophie vertreten wurden. Er beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Beziehung zwischen Gott und der Natur, sowie die Rolle des Menschen in diesem Zusammenhang.
Analyse und Interpretation des Gedichts „Mailied" (1771)
Dieser Abschnitt analysiert und interpretiert das Gedicht „Mailied" (1771) im Hinblick auf die Thematik von Liebe und Natur. Er untersucht die sprachlichen Mittel und literarischen Elemente, die Goethe in diesem Gedicht verwendet, um seine pantheistische Sichtweise zum Ausdruck zu bringen.
Der Konflikt zwischen Liebe und Natur
Dieser Abschnitt untersucht den Konflikt zwischen Liebe und Natur in der Lyrik des jungen Goethe. Er analysiert, wie die Liebe im Werk Goethes dargestellt wird und in welcher Beziehung sie zur Natur steht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind Pantheismus, Liebe, Natur, Lyrik, Goethe, „Mailied", Konflikt, Analyse, Interpretation.
- Quote paper
- Elisabeth Hartmann (Author), 2014, Der Pantheismus in der Literatur. Die Problematik der Liebe und der Natur in der Lyrik des jungen Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412948