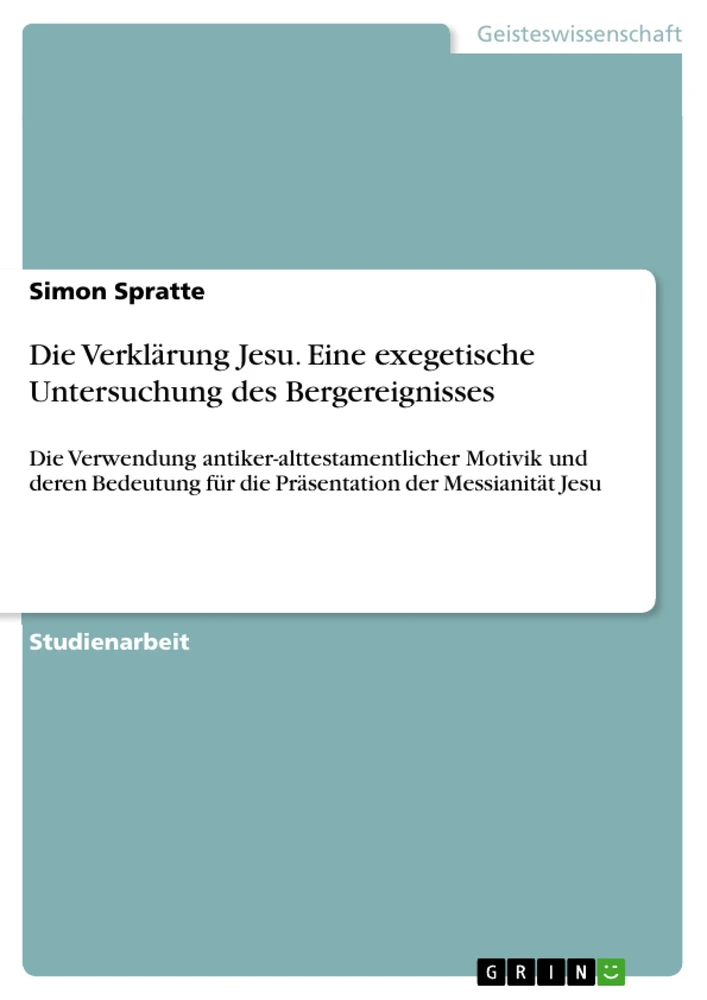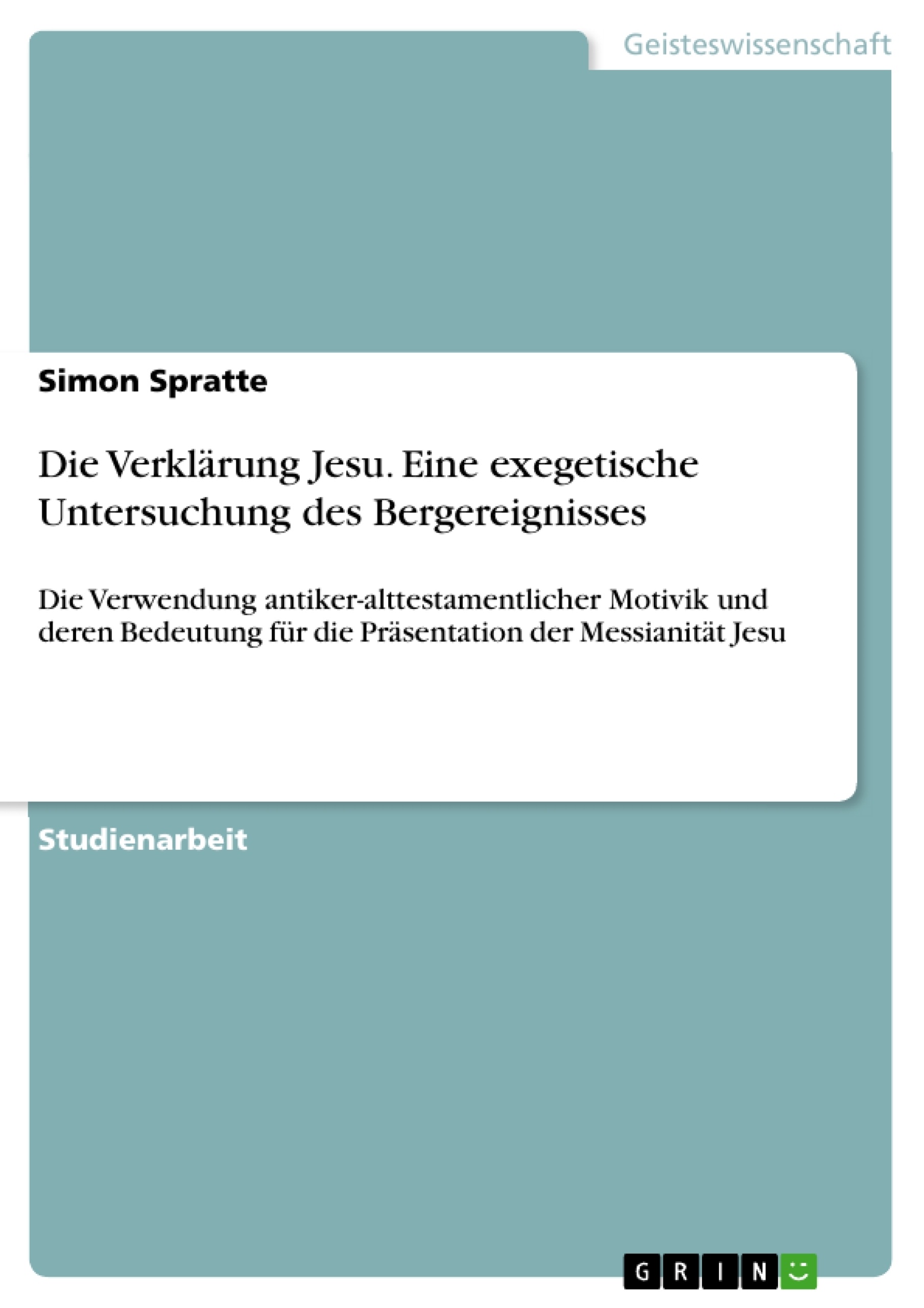Die Verklärung Jesu gehört zu den beeindruckendsten aber auch zu den komplexesten Erzählungen über die Person des Jesus von Nazareth. Sie kommt bei jedem der Synoptiker vor und hat dort jeweils eine zentrale Position im Handlungsverlauf des Evangeliums. Im Folgenden soll nun innerhalb dieser Hausarbeit anhand der Verklärung im Markusevangelium eine exegetische Untersuchung durchgeführt werden. Dabei soll vom besonderen Interesse sein, die Textstelle auf ihre alttestamentliche Motivik hin zu untersuchen und auf die markinische Christologie zu beziehen.
Dafür ist es notwendig, den Text auf synchrone aber auch auf diachrone Weise zu analysieren. Dabei wird zunächst textkritisch vorgegangen werden, damit die Schriftstelle in einen bestimmten Kontext eingeordnet werden kann. In einem ersten Schritt wird dabei ein Rahmen geschaffen werden, welcher die Textstelle sowohl nach vorne als auch nach hinten abgrenzt. Dabei gilt es darzustellen, welche Erzählungen vor der Verklärung stehen und welche auf diese folgen. Ebenfalls sind auch eine exakte Arbeitsübersetzung sowie ein synoptischer Vergleich mit Matthäus und Lukas Teil des textkritischen Vorgehen.
Auf diese Methode der Textkritik folgt dann eine sprachliche Einordnung der Textstelle. So wird zum einen Phonetik und Syntax der einzelnen Verse untersucht werden. Aber auch die Semantik ist für die Analyse des Textes von tragender Bedeutung. Welche Arten von Wörtern und Sätzen werden innerhalb der Textstelle verwendet? Und welche Bedeutung haben diese für die Gesamtkonstruktion sowie den Verlauf des Textes? Nach dieser synchronen Analyse der Verklärungsperikope folgt dann unter diachronen Gesichtspunkten eine weitere methodische Ausdifferenzierung. Dabei soll ein gesonderter Schwerpunkt auf die detaillierte Traditionskritik gelegt werden, welche vor allem alttestamentliche Grundmotive behandeln wird. So wird zum einen die Bedeutung von Mose und Elija im alten Testament hinsichtlich ihres Auftretens in der zu analysierenden Textstelle untersucht werden. Zum anderen soll aber auch ein Schwerpunkt auf das Motiv der Offenbarungsstimme gelegt werden. Ebenfalls sind für das Verständnis der Textstelle das Verwandlungs-, das Berg-, sowie das Zeltmotiv von Bedeutung. Anhand dieser begrifflichen Motivkritik wird danach auch noch ein Blick auf den hellenistisch- jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus geworfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Text und Literarkritik
- 2.1) Arbeitsübersetzung
- 2.2) Rekonstruktion und Kontextuierung der Textstelle
- 2.3) Synoptischer Vergleich
- 3.) Sprachliche Analyse
- 3.1) Narrative Analyse
- 3.2) Linguistische Analyse
- 4.) Traditionskritik
- 4.1) Mose und Elija im AT-Kontext
- 4.2) Wolke und Offenbarungsstimme im jüdischen Kontext
- 4.3) Berg und Verwandlungsmotivik
- 4.4) Hinweise bei Flavius Josephus
- 5.) Markinische Christologie
- 5.1) Definition
- 5.2) Fokusierung an Mk 9, 2-13
- 6.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verklärung Jesu im Markusevangelium (Mk 9,2-13) exegetisch. Das Hauptziel ist die Analyse der alttestamentlichen Motivik in der Textstelle und deren Bezug zur markinischen Christologie. Die Arbeit verbindet synchrone und diachrone Analysemethoden.
- Alttestamentliche Motivik in der Verklärungsgeschichte
- Markinische Christologie und die Darstellung der Messianität Jesu
- Textkritische Analyse der Markusstelle
- Sprachliche und narrative Analyse der Perikope
- Traditionsgeschichtliche Einordnung der Motive
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Verklärung Jesu ein, betont deren Bedeutung und Komplexität in den synoptischen Evangelien, und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Untersuchung konzentriert sich auf die alttestamentliche Motivik in Markus und deren Relevanz für die Darstellung der Messianität Jesu. Es wird ein Vorgehen angekündigt, das textkritische, sprachliche und traditionsgeschichtliche Analysen umfasst, um die Perikope in ihren Kontext einzuordnen und ihre Bedeutung zu erschließen. Der Fokus liegt auf der diachronen Analyse alttestamentlicher Motive und deren Funktion in der markinischen Christologie.
2.) Text und Literarkritik: Dieses Kapitel beschreibt den ersten Schritt der exegetischen Arbeit: die Textkritik. Es erläutert die Bedeutung der Arbeitsübersetzung als Grundlage für die weitere Analyse und die Berücksichtigung der Textbasis, der Textversion und der Position der Textstelle innerhalb des Evangeliums. Der synoptische Vergleich mit Matthäus und Lukas wird als methodisches Werkzeug zur Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden hervorgehoben. Die Arbeitsübersetzung selbst wird als Grundlage für die nachfolgenden Analysen präsentiert. Die Positionierung der Perikope im Kontext des Markusevangeliums wird als essentiell für das Verständnis ihrer Bedeutung dargestellt.
Schlüsselwörter
Verklärung Jesu, Markusevangelium, alttestamentliche Motivik, markinische Christologie, Messianität, Textkritik, Sprachliche Analyse, Traditionskritik, Mose, Elija, Offenbarungsstimme, Bergmotiv, Verwandlung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Exegetische Untersuchung der Verklärung Jesu im Markusevangelium (Mk 9,2-13)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht exegetisch die Verklärung Jesu im Markusevangelium (Mk 9,2-13). Der Fokus liegt auf der Analyse der alttestamentlichen Motivik in der Textstelle und deren Bezug zur markinischen Christologie. Es werden synchrone und diachrone Analysemethoden kombiniert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der alttestamentlichen Motivik in der Verklärung Jesu und deren Relevanz für die markinische Christologie. Die Arbeit zielt darauf ab, die Perikope in ihren Kontext einzuordnen und ihre Bedeutung zu erschließen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: alttestamentliche Motivik in der Verklärungsgeschichte, markinische Christologie und die Darstellung der Messianität Jesu, textkritische Analyse der Markusstelle, sprachliche und narrative Analyse der Perikope und traditionsgeschichtliche Einordnung der Motive.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus textkritischen, sprachlichen, narrativen und traditionsgeschichtlichen Analysemethoden. Es wird ein synoptischer Vergleich mit Matthäus und Lukas durchgeführt. Die diachrone Analyse alttestamentlicher Motive und deren Funktion in der markinischen Christologie steht im Mittelpunkt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Text und Literarkritik (inklusive Arbeitsübersetzung, Rekonstruktion und Kontextuierung, synoptischer Vergleich), Sprachliche Analyse (Narrative und Linguistische Analyse), Traditionskritik (Mose und Elija, jüdischer Kontext, Berg und Verwandlungsmotivik, Flavius Josephus), Markinische Christologie (Definition und Fokusierung auf Mk 9,2-13) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verklärung Jesu, Markusevangelium, alttestamentliche Motivik, markinische Christologie, Messianität, Textkritik, Sprachliche Analyse, Traditionskritik, Mose, Elija, Offenbarungsstimme, Bergmotiv, Verwandlung.
Was wird im Kapitel "Text und Literarkritik" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die textkritische Analyse, die Arbeitsübersetzung als Grundlage der Analyse, die Rekonstruktion und Kontextuierung der Textstelle im Markusevangelium sowie einen synoptischen Vergleich mit den parallelen Stellen in Matthäus und Lukas.
Was wird im Kapitel "Traditionskritik" behandelt?
Das Kapitel "Traditionskritik" untersucht die alttestamentlichen und jüdischen Traditionen, die mit den Motiven der Verklärung (Mose und Elija, Offenbarungsstimme, Berg und Verwandlung) in Verbindung stehen, sowie deren mögliche Einflüsse auf die Markusstelle und Hinweise bei Flavius Josephus.
Was wird im Kapitel zur "Markinischen Christologie" behandelt?
Dieses Kapitel definiert die markinische Christologie und konzentriert sich auf die Darstellung der Messianität Jesu in der Verklärungsgeschichte (Mk 9,2-13).
- Quote paper
- Simon Spratte (Author), 2017, Die Verklärung Jesu. Eine exegetische Untersuchung des Bergereignisses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412297