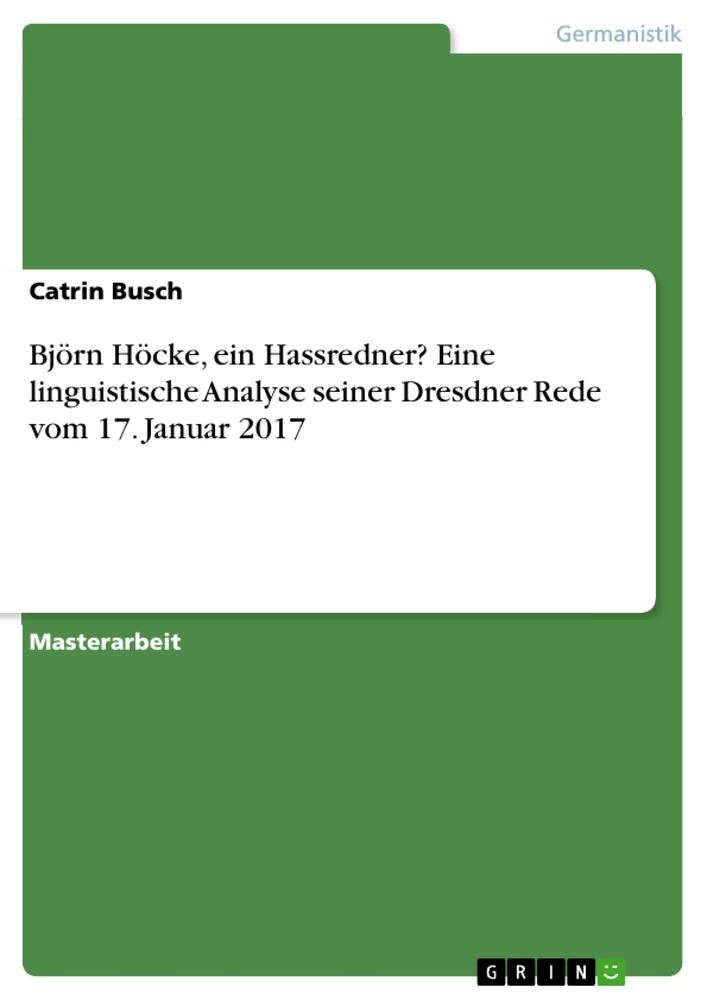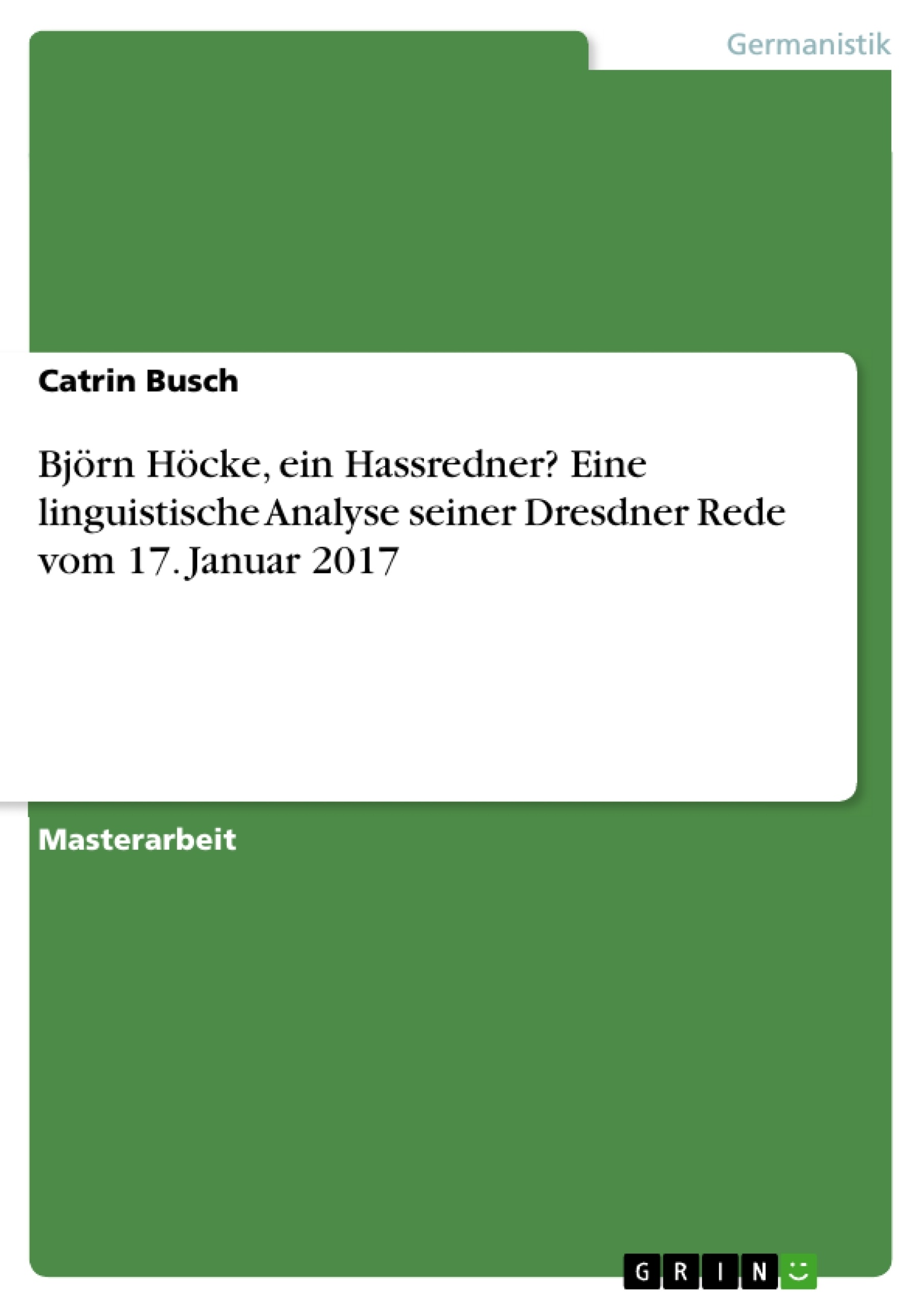Sprache ist das Kommunikationsmittel schlechthin: Sie bildet seit Jahrtausenden die Grundlage für das gegenseitige Verständigen und Verstehen von heute mehr als sieben Milliarden Menschen weltweit. Währenddessen liegt die Aufmerksamkeit eigentlich mehr auf dem was wir sagen, als auf dem wie wir es sagen. Strukturen und Gebrauchsmuster der Sprache bleiben für die meisten eigentlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle – aber eben nur eigentlich. Denn Sprache ist nie wertfrei, nur „selten objektiv in der Information und ebenso selten ideologieindifferent“: Jedes sprachliche Zeichen, das wir zur Realisierung der sprachlichen Inhalte wählen, verrät etwas über unsere Werte und Vorstellungen. Dementsprechend ist Sprache „not only an instrument of communication or even knowledge but also an instrument of power. Die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft sind in der Lage, versteckt Wertungen zu transportieren und zu verbreiten. Und genau das macht Sprache so gefährlich: Sie sei das stärkste Rauschgift, das die Menschheit verwende, soll der britische Dichter Rudyard Kipling einmal gesagt haben. Ein Beispiel dafür, wie Inhalt und Sprache zum Gegenstand der Kommunikation werden können, liefert die Rede von Björn Höcke, Thüringer Landes und Fraktionsvorsitzender der Alternative für Deutschland. Der 45Jährige löste im Januar dieses Jahres eine Diskussion darüber aus, wo ‚ehrliches und demokratiekonformes‘ Sprechen endet und ‚manipulierendes und demokratiefeindliches‘ Sprechen beginnt. Die Auseinandersetzung darum, was Höcke sagt und wie er das versprachlicht, entwickelte sich schnell zur Frage, ob das eine Demokratie noch vertragen kann – oder vertragen muss. Der Redner, Björn Höcke, ist seit April 2013 AfD-Mitglied und wird dem nationalkonservativen Flügel zugerechnet. Wiederholt sorgte er in den letzten Monaten für kontroverse Diskussionen, wie um den „ lebensbejahende(n) afrikanische(n) Ausbreitungstyp “ Deutschlands. Am 17. Januar 2017 hielt Höcke eine Rede vor der Nachwuchsorganisation der AfD, der Jungen Alternative, in Dresden. Darin bezeichnete er das Berliner HolocaustMahnmal als „Denkmal der Schande“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ in der deutschen Erinnerungskultur. Während er auf der einen Seite einen Sturm der Entrüstung auslöste und Strafanzeigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingingen, sorgte er bei Anderen für lebhaften Beifall und laute Zurufe. Wie ist es möglich, dass ein und dieselbe Rede derart polarisiert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politik (in) der Sprache
- Rede als Textsorte
- Politische Rede
- Hassrede
- Methodik
- Zur Rede
- Analyse und Interpretation: Höckes Redestrategien
- Vereinfachung
- Emotionalisierung
- Pseudowissenschaft
- Intertextualisierung
- Freunde und Feinde
- Freunde
- Feinde
- Personalisierung
- Historisierung
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Dresdner Rede von Björn Höcke vom 17. Januar 2017 linguistisch, um die Frage zu untersuchen, ob seine Rhetorik als Hassrede einzustufen ist. Die Analyse fokussiert auf die sprachlichen Mittel und Strategien, die Höcke einsetzt, um seine politischen Botschaften zu vermitteln.
- Analyse der sprachlichen Mittel der Vereinfachung und Emotionalisierung
- Untersuchung des Einsatzes von pseudowissenschaftlichen Argumenten
- Identifizierung von Strategien der Intertextualisierung und Personalisierung
- Erfassung der Konstruktion von „Freunden“ und „Feinden“ in der Rede
- Bewertung der Verwendung historischer Bezüge
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Einordnung von Höckes Rede als Hassrede. Sie beschreibt den Kontext der Rede und skizziert den methodischen Ansatz der linguistischen Analyse.
Politik (in) der Sprache: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse, indem es den Zusammenhang zwischen Politik und Sprache beleuchtet und verschiedene Konzepte und Theorien der politischen Kommunikation und Rhetorik einführt. Es dient als theoretische Basis für die anschließende Analyse von Höckes Rede.
Rede als Textsorte: Dieses Kapitel definiert und differenziert zwischen politischen Reden und Hassreden. Es beschreibt charakteristische Merkmale beider Textsorten und liefert Kriterien zur Unterscheidung, die im weiteren Verlauf der Arbeit angewendet werden, um Höckes Rede zu analysieren und zu kategorisieren.
Methodik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die angewandte Methode der linguistischen Analyse. Es erläutert die verwendeten Verfahren und begründet die Auswahl der analytischen Kategorien, die für die Untersuchung von Höckes Redestrategien relevant sind.
Zur Rede: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Kontext und die zentralen Aussagen der Dresdner Rede von Björn Höcke. Es stellt den Inhalt und die Struktur der Rede kurz dar, ohne bereits eine detaillierte Analyse vorzunehmen. Es dient als Grundlage für die anschließende detaillierte Analyse der einzelnen Aspekte der Rede.
Analyse und Interpretation: Höckes Redestrategien: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert verschiedene Redestrategien Höckes. Es untersucht die Verwendung von Vereinfachungen, Emotionalisierungen, pseudowissenschaftlichen Argumenten, Intertextualisierungen, die Konstruktion von Freund-Feind-Bildern, Personalisierungen und Historisierungen. Jede Strategie wird einzeln betrachtet, mit konkreten Beispielen belegt und deren Wirkung auf das Publikum erörtert. Die Analyse verbindet diese Strategien mit den zuvor eingeführten theoretischen Konzepten, um eine fundierte Bewertung zu ermöglichen.
Ergebnisse: Das Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage der Arbeit. Es bewertet den Grad, in dem Höckes Rede Merkmale von Hassrede aufweist, ausgehend von der zuvor durchgeführten detaillierten Analyse der verwendeten rhetorischen und sprachlichen Mittel.
Schlüsselwörter
Björn Höcke, Dresdner Rede, Hassrede, Linguistische Analyse, Politische Rhetorik, Redestrategien, Emotionalisierung, Vereinfachung, Pseudowissenschaft, Intertextualität, Personalisierung, Historisierung, Freund-Feind-Schema.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur linguistischen Analyse der Dresdner Rede von Björn Höcke
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert linguistisch die Dresdner Rede von Björn Höcke vom 17. Januar 2017. Der zentrale Forschungsfokus liegt auf der Frage, ob Höckes Rhetorik als Hassrede einzustufen ist.
Welche Aspekte der Rede werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel und Strategien, die Höcke einsetzt, um seine politischen Botschaften zu vermitteln. Dies beinhaltet die Untersuchung von Vereinfachungen, Emotionalisierungen, pseudowissenschaftlichen Argumenten, Intertextualisierungen, der Konstruktion von Freund-Feind-Bildern, Personalisierungen und Historisierungen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine linguistische Analysemethode. Das Kapitel "Methodik" beschreibt detailliert die angewandten Verfahren und die Auswahl der analytischen Kategorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Politik (in) der Sprache, Rede als Textsorte, Methodik, Zur Rede, Analyse und Interpretation: Höckes Redestrategien, Ergebnisse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die sprachlichen Mittel zu untersuchen, die Höcke in seiner Rede einsetzt, um seine politischen Botschaften zu vermitteln, und diese im Hinblick auf ihre Einstufung als Hassrede zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Björn Höcke, Dresdner Rede, Hassrede, Linguistische Analyse, Politische Rhetorik, Redestrategien, Emotionalisierung, Vereinfachung, Pseudowissenschaft, Intertextualität, Personalisierung, Historisierung, Freund-Feind-Schema.
Wie wird die Frage nach der Einstufung als Hassrede beantwortet?
Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt im Kapitel "Ergebnisse", welches die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die Bewertung des Grades der Merkmale von Hassrede in Höckes Rede beinhaltet.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Das Kapitel "Politik (in) der Sprache" legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse, indem es den Zusammenhang zwischen Politik und Sprache beleuchtet und verschiedene Konzepte und Theorien der politischen Kommunikation und Rhetorik einführt.
Wie wird der Kontext der Rede berücksichtigt?
Das Kapitel "Zur Rede" bietet einen Überblick über den Kontext und die zentralen Aussagen der Dresdner Rede, bevor die detaillierte Analyse erfolgt.
Welche konkreten Beispiele werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse im Kapitel "Analyse und Interpretation: Höckes Redestrategien" verwendet konkrete Beispiele aus der Rede, um die Verwendung der verschiedenen Strategien zu belegen und deren Wirkung zu erörtern.
- Quote paper
- Catrin Busch (Author), 2017, Björn Höcke, ein Hassredner? Eine linguistische Analyse seiner Dresdner Rede vom 17. Januar 2017, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412037