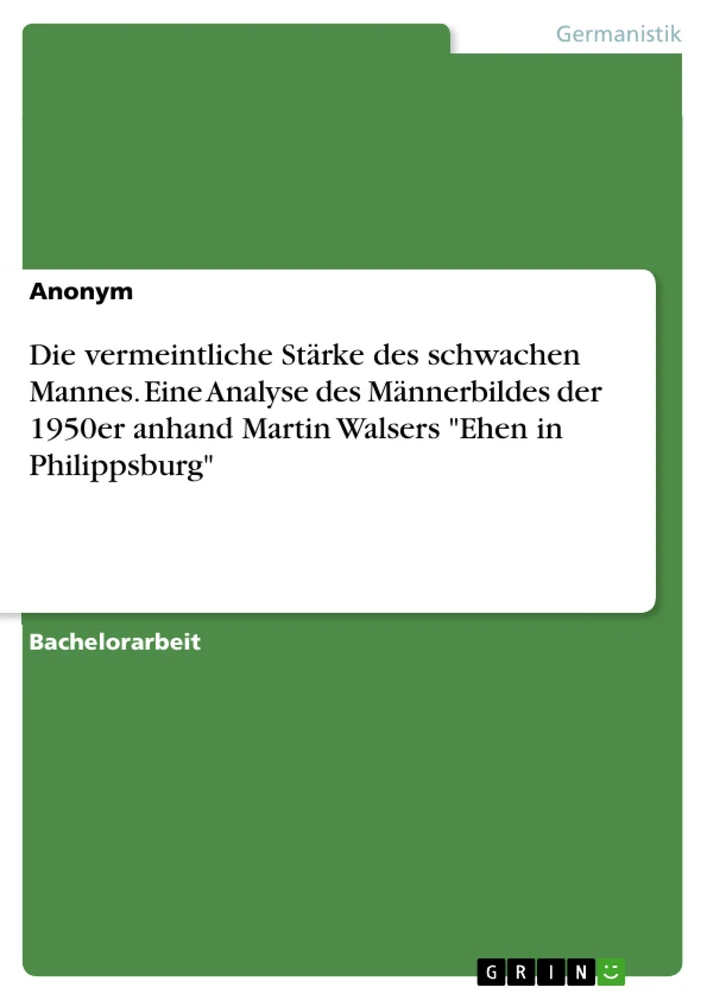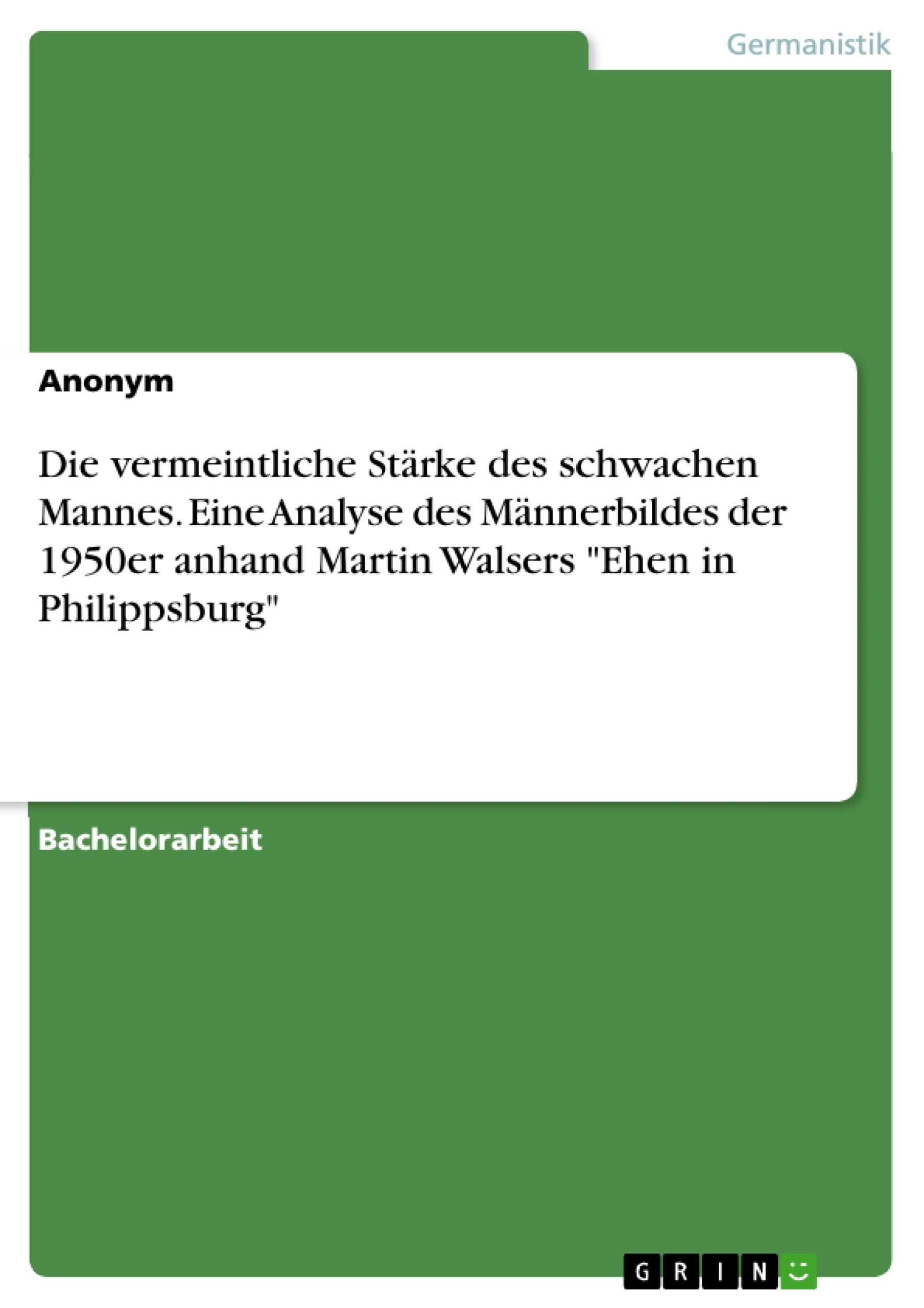Ehen in Philippsburg ist der Debütroman Martin Walsers. Trotz der vielen guten Kritiken verschwindet der Roman recht bald wieder aus den Köpfen der Menschen, obwohl das Werk eine Thematik anspricht, die sowohl damals als auch heute auf die Gesellschaft anwendbar ist: der Mann in einer oberflächlichen, homophoben Gesellschaft, in der Betrug und Lügen gegenüber der Ehefrau an der Tagesordnung stehen, man aber nicht auf die Tradition des Familienlebens verzichten möchte.
Das Werk zeigt unter anderem drei scheinbar grundverschiedene Männer, die unterschiedliche Situationen durchleben. Hinter der Fassade des starken Mannes und der perfekten Gemeinschaft, erkennt man eine Gesellschaft, die die Männer formt und aus ihnen ein ‚Ein-Mann-Theater‘ macht. Das Erstaunliche an diesem Werk ist das Zeitgemäße, denn unsere Gesellschaft ist, wie sie hier beschrieben wird, oberflächlich. Jeder versucht krampfhaft individuell zu sein, unterscheidet sich in seiner Individualität aber nicht von den anderen vermeintlichen Individuen.
Auch die Thematik des Egoismus‘ und der stetigen Krise, die wie eine Gewitterwolke über einem schwebt, ist sehr zeitgemäß, da sich jeder auf sich selbst konzentriert und sich weiterbringen will ohne Rücksicht auf Verluste. Die Thematik des Betrugs und der Unfähigkeit zu lieben beziehungsweise monogam zu sein, ist nun aktueller denn je. ‚Generation Beziehungsunfähig‘ nennt Michael Nast die jetzige Generation und genau diese Unfähigkeit thematisierte Walser schon 1957. Das Vergessen des Werkes erklärt Walser in einem Interview mit den Worten: „Ein Buch kann auf seine Leser warten.“(Illies, 2008). Nun hat Ehen in Philippsburg lange genug gewartet, denn niemals war dieses Buch zeitgemäßer als jetzt. Nicht nur die Oberflächlichkeit, die scheinbare Emotionslosigkeit, sondern auch der schwache Mann, der sich hinter seinem Bart und seiner Attitüde des starken Mannes versteckt, sind adäquate Themen des 21. Jahrhunderts. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Männlichkeit in der Theorie
- 2.1 Männlichkeit(en): eine erste Definition
- 2.2 Männlichkeit aus soziologischer Perspektive
- 2.3 Männlichkeit aus literaturwissenschaftlicher Perspektive
- 2.4 Die Krise der Männlichkeit
- 2.5 Das Männerbild der 1950er
- 2.5.1 Der schwache Mann
- 2.5.2 Der starke Mann
- 3. Analyse
- 3.1 Hans Beumann
- 3.2 Dr. Alf Benrath
- 3.3 Dr. Alexander Alwin
- 3.4 Harry Büsgen und Claude
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Männerbild der 1950er Jahre anhand von Martin Walsers Roman "Ehen in Philippsburg". Ziel ist es, die Darstellung der Männlichkeit in diesem Werk im Kontext der soziologischen und literaturwissenschaftlichen Theorien der Männlichkeitsforschung zu untersuchen. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte männliche Figuren und deren Konflikte.
- Die verschiedenen Facetten der Männlichkeit in den 1950ern
- Der Konflikt zwischen dem Ideal des "starken Mannes" und der Realität des "schwachen Mannes"
- Die gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und deren Auswirkungen auf deren Leben
- Identitätskrisen und die Suche nach Anerkennung bei Männern
- Marginalisierung und Diskriminierung von Männern, die nicht dem hegemonialen Männerbild entsprechen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Martin Walsers Roman "Ehen in Philippsburg" vor und hebt dessen Aktualität hervor. Der Roman thematisiert Männer in einer oberflächlichen, homophoben Gesellschaft, in der Ehebruch und mangelnde emotionale Tiefe weit verbreitet sind. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Darstellung dreier unterschiedlicher Männerfiguren im Roman und ihrer Konflikte mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit. Die scheinbare Stärke der Männer wird als Fassade entlarvt, hinter der sich eine tiefe Krise der Männlichkeit verbirgt, die bis in die Gegenwart relevant ist.
2. Männlichkeit in der Theorie: Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen für die anschließende Analyse. Es definiert den Begriff der Männlichkeit, betrachtet ihn aus soziologischer (u.a. mit Bezug auf Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit) und literaturwissenschaftlicher Perspektive, beleuchtet die Krise der Männlichkeit und untersucht das spezifische Männerbild der 1950er Jahre. Es werden verschiedene Konzepte der Männlichkeit vorgestellt und deren Relevanz für die Interpretation der Romanfiguren erläutert. Die Diskussion über den "schwachen" und "starken" Mann liefert einen wichtigen analytischen Schlüssel für die folgende Figuren-Analyse.
3. Analyse: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von vier männlichen Figuren aus dem Roman: Hans Beumann, Dr. Alf Benrath, Dr. Alexander Alwin und Harry Büsgen und Claude. Es untersucht deren individuelle Erfahrungen und Konflikte im Kontext der zuvor etablierten theoretischen Konzepte. Beumanns Entwicklung vom "Neuling" zum "echten Mann" der Philippsburger Gesellschaft, Benraths Identitätskrise und Flucht nach einem familiären Trauma, Alwins Krisen im Kontext von Anerkennungssuche und einem Unfall, sowie die marginalisierte Position von Büsgen und Claude werden umfassend beleuchtet. Die Analyse zeigt, wie die Figuren die verschiedenen Aspekte des Männerbildes der 1950er Jahre verkörpern und wie sie mit den Erwartungen und Konflikten ihrer Zeit umgehen.
Schlüsselwörter
Männerbild, 1950er Jahre, Martin Walser, Ehen in Philippsburg, Hegemoniale Männlichkeit, Identitätskrise, schwacher Mann, starker Mann, Soziologie, Literaturwissenschaft, Marginalisierung.
Häufig gestellte Fragen zu "Ehen in Philippsburg" - Männerbilder der 1950er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Männerbild der 1950er Jahre anhand von Martin Walsers Roman "Ehen in Philippsburg". Sie untersucht die Darstellung von Männlichkeit in diesem Werk im Kontext soziologischer und literaturwissenschaftlicher Theorien und konzentriert sich auf ausgewählte männliche Figuren und deren Konflikte.
Welche Aspekte der Männlichkeit werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten der Männlichkeit in den 1950ern, den Konflikt zwischen dem Ideal des "starken Mannes" und der Realität des "schwachen Mannes", gesellschaftliche Erwartungen an Männer und deren Auswirkungen, Identitätskrisen und die Suche nach Anerkennung, sowie die Marginalisierung von Männern, die nicht dem hegemonialen Männerbild entsprechen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet soziologische und literaturwissenschaftliche Theorien der Männlichkeitsforschung, unter anderem Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit, um die Darstellung der Männlichkeit in "Ehen in Philippsburg" zu interpretieren.
Welche Figuren werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf vier männliche Figuren aus dem Roman: Hans Beumann, Dr. Alf Benrath, Dr. Alexander Alwin und Harry Büsgen und Claude. Ihre individuellen Erfahrungen und Konflikte werden im Kontext der theoretischen Konzepte untersucht.
Wie werden die Figuren analysiert?
Die Analyse untersucht, wie die Figuren verschiedene Aspekte des Männerbildes der 1950er Jahre verkörpern und wie sie mit den Erwartungen und Konflikten ihrer Zeit umgehen. Beispielsweise wird Beumanns Entwicklung, Benraths Identitätskrise, Alwins Krisen im Kontext der Anerkennungssuche und die marginalisierte Position von Büsgen und Claude beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Männlichkeit in der Theorie, ein Kapitel zur Analyse der ausgewählten Figuren und einen Schluss. Die Einleitung stellt den Roman vor und erläutert die Zielsetzung. Das Theoriekapitel liefert den analytischen Rahmen. Das Analysekapitel untersucht die Figuren im Detail. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die scheinbare Stärke der Männer im Roman wird als Fassade entlarvt, hinter der sich eine tiefe Krise der Männlichkeit verbirgt, die bis in die Gegenwart relevant ist. Der Roman zeigt die Konflikte der Männer mit gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit in einer oberflächlichen, homophoben Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Männerbild, 1950er Jahre, Martin Walser, Ehen in Philippsburg, Hegemoniale Männlichkeit, Identitätskrise, schwacher Mann, starker Mann, Soziologie, Literaturwissenschaft, Marginalisierung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Die vermeintliche Stärke des schwachen Mannes. Eine Analyse des Männerbildes der 1950er anhand Martin Walsers "Ehen in Philippsburg", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411871