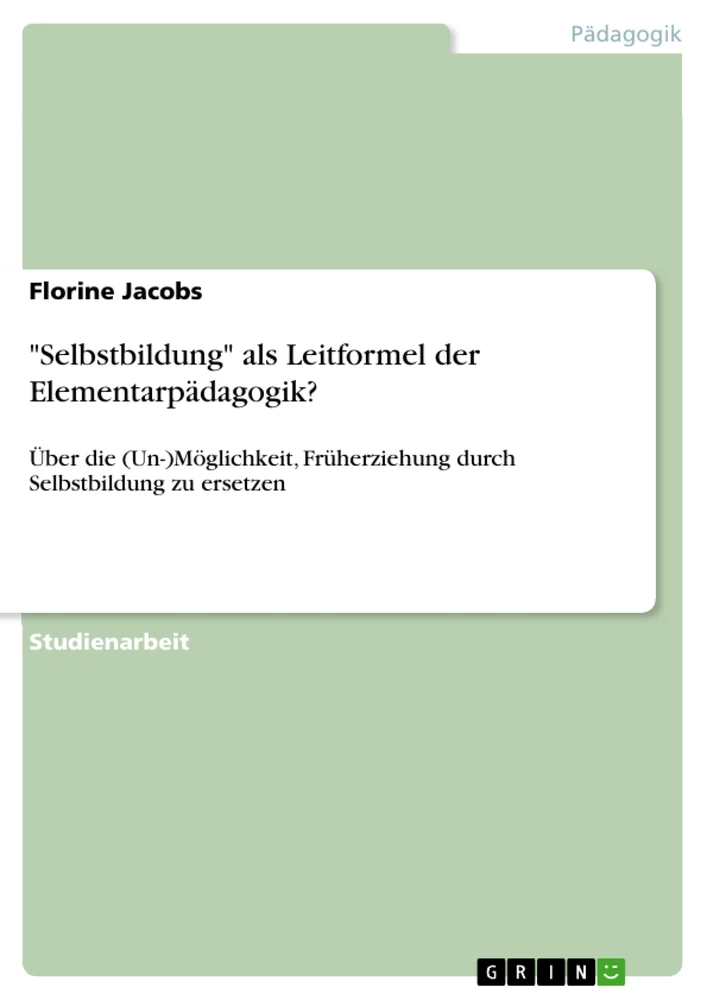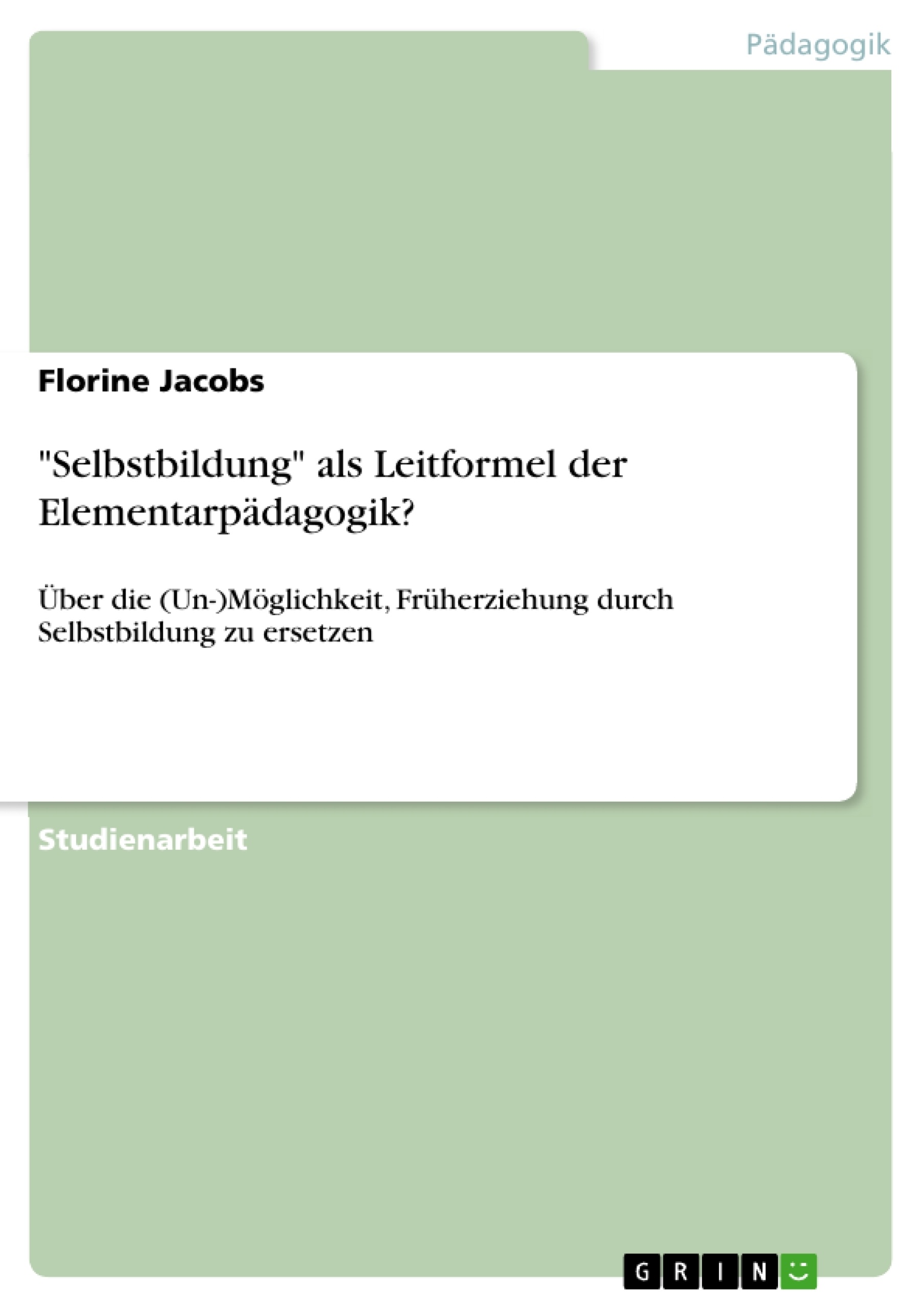In dieser Arbeit werde ich das klassische und das moderne Selbstbildungskonzept behandeln und die Frage ob „Selbstbildung als Leitformel der Elementarpädagogik“ angesehen werden kann, mit Hilfe meines eigenen Standpunktes erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Selbstbildung: „Ausgangspunkt einer innovativen' Pädagogik der frühen Kindheit?
- Zur Rekonstruktion des pädagogischen Problems der kindlichen Selbstbildung
- Das Problem der kindlichen Selbstbildung in der klassischen Elementarpädagogik
- Kritik an modernen Selbstbildungsansätzen
- Kritische Beurteilung des Thüringer Bildungsplanes
- Schluss: Anmerkung zu modernen Selbstbildungskonzepten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Selbstbildung in der Elementarpädagogik und hinterfragt die Möglichkeit, Früherziehung vollständig durch Selbstbildung zu ersetzen. Sie vergleicht klassische und moderne Selbstbildungsansätze und analysiert deren Stärken und Schwächen. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstbildung und dessen Implikationen für die pädagogische Praxis.
- Der Vergleich klassischer und moderner Selbstbildungskonzepte.
- Die kritische Analyse der Anwendbarkeit von Selbstbildung in der frühen Kindheit.
- Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im Kontext der Selbstbildung.
- Die Berücksichtigung individueller Unterschiede bei der Förderung von Selbstbildung.
- Die Grenzen und Möglichkeiten der Selbstbildung im Rahmen der Elementarpädagogik.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit dem Thema frühkindlicher Selbstbildung auseinanderzusetzen, ausgelöst durch eine persönliche Beobachtung. Sie skizziert die gegensätzlichen Ansätze der klassischen Elementarpädagogik und moderner Selbstbildungskonzepte und benennt Frithjof Grells Text „Über die (Un-)Möglichkeit Früherziehung durch Selbstbildung zu ersetzen“ als Grundlage der Arbeit. Die Autorin kündigt an, klassische und moderne Selbstbildungskonzepte zu behandeln und die Frage nach der Eignung von Selbstbildung als Leitformel der Elementarpädagogik zu diskutieren.
Selbstbildung: „Ausgangspunkt einer innovativen' Pädagogik der frühen Kindheit?: Dieses Kapitel analysiert das Konzept der Selbstbildung in der frühen Kindheit. Es werden die zentralen Aspekte moderner frühpädagogischer Konzepte wie Subjektperspektive, Selbsttätigkeit, Umweltbedeutung, Lernpartnerschaft und Herrschaftskritik erläutert. Die Autorin kritisiert jedoch die Annahme, dass Selbstbildung alle pädagogischen Problemstellungen der frühen Kindheit ausreichend abdeckt und bezeichnet es als Verkürzung elementarpädagogischer Fragestellungen.
Zur Rekonstruktion des pädagogischen Problems der kindlichen Selbstbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle von Eigenaktivität, Aufmerksamkeit, Interesse und Lernbereitschaft im Lernprozess. Es hinterfragt, inwieweit diese Faktoren durch die pädagogische Fachkraft beeinflusst werden können und argumentiert, dass Lernen immer selbsttätig und eigenaktiv erfolgen muss. Das Kapitel bezieht sich auf Jean-Jacques Rousseau und dessen Beitrag zur Diskussion um kindliche Selbstbildungsfähigkeit.
Schlüsselwörter
Selbstbildung, Elementarpädagogik, Früherziehung, klassische Pädagogik, moderne Pädagogik, Jean-Jacques Rousseau, Frithjof Grell, Subjektperspektive, Lernpartnerschaft, Herrschaftskritik, Bildungsplan.
Häufig gestellte Fragen zu: Selbstbildung in der Elementarpädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die Rolle der Selbstbildung in der Elementarpädagogik und hinterfragt die Möglichkeit, Früherziehung vollständig durch Selbstbildung zu ersetzen. Sie vergleicht klassische und moderne Selbstbildungsansätze und analysiert deren Stärken und Schwächen. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstbildung und dessen Implikationen für die pädagogische Praxis.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich klassischer und moderner Selbstbildungskonzepte, die kritische Analyse der Anwendbarkeit von Selbstbildung in der frühen Kindheit, die Rolle der pädagogischen Fachkraft im Kontext der Selbstbildung, die Berücksichtigung individueller Unterschiede bei der Förderung von Selbstbildung und die Grenzen und Möglichkeiten der Selbstbildung im Rahmen der Elementarpädagogik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit verschiedenen Unterkapiteln (Selbstbildung als Ausgangspunkt innovativer Pädagogik, Rekonstruktion des pädagogischen Problems der kindlichen Selbstbildung, Selbstbildung in der klassischen Elementarpädagogik, Kritik an modernen Selbstbildungsansätzen, Kritik am Thüringer Bildungsplan) und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin und den methodischen Ansatz. Die Hauptkapitel analysieren das Selbstbildungskonzept, die Rolle von Eigenaktivität und Lernprozessen, und liefern eine kritische Auseinandersetzung mit klassischen und modernen Ansätzen. Der Schluss bietet Anmerkungen zu modernen Selbstbildungskonzepten.
Welche Autoren werden erwähnt und welche Bedeutung haben sie für die Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf Jean-Jacques Rousseau und dessen Beitrag zur Diskussion um kindliche Selbstbildungsfähigkeit und auf Frithjof Grell und dessen Text „Über die (Un-)Möglichkeit Früherziehung durch Selbstbildung zu ersetzen“, der als Grundlage der Arbeit dient.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Selbstbildung, Elementarpädagogik, Früherziehung, klassische Pädagogik, moderne Pädagogik, Jean-Jacques Rousseau, Frithjof Grell, Subjektperspektive, Lernpartnerschaft, Herrschaftskritik und Bildungsplan.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin?
Die Autorin möchte die Rolle der Selbstbildung in der Elementarpädagogik untersuchen und die Frage nach der Eignung von Selbstbildung als Leitformel der Elementarpädagogik diskutieren. Sie will klassische und moderne Selbstbildungskonzepte vergleichen und deren Stärken und Schwächen analysieren.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer klaren Struktur mit Einleitung, Hauptteil (gegliedert in mehrere Unterkapitel), und Schluss. Ein Inhaltsverzeichnis ermöglicht einen schnellen Überblick über die einzelnen Abschnitte.
- Quote paper
- Florine Jacobs (Author), 2011, "Selbstbildung" als Leitformel der Elementarpädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411776