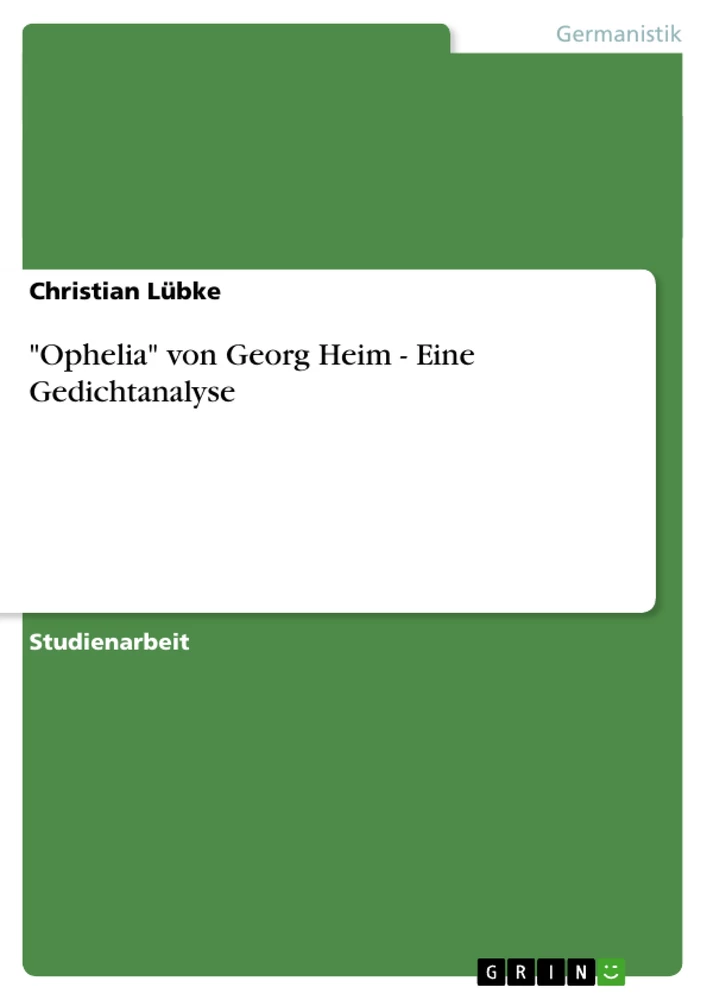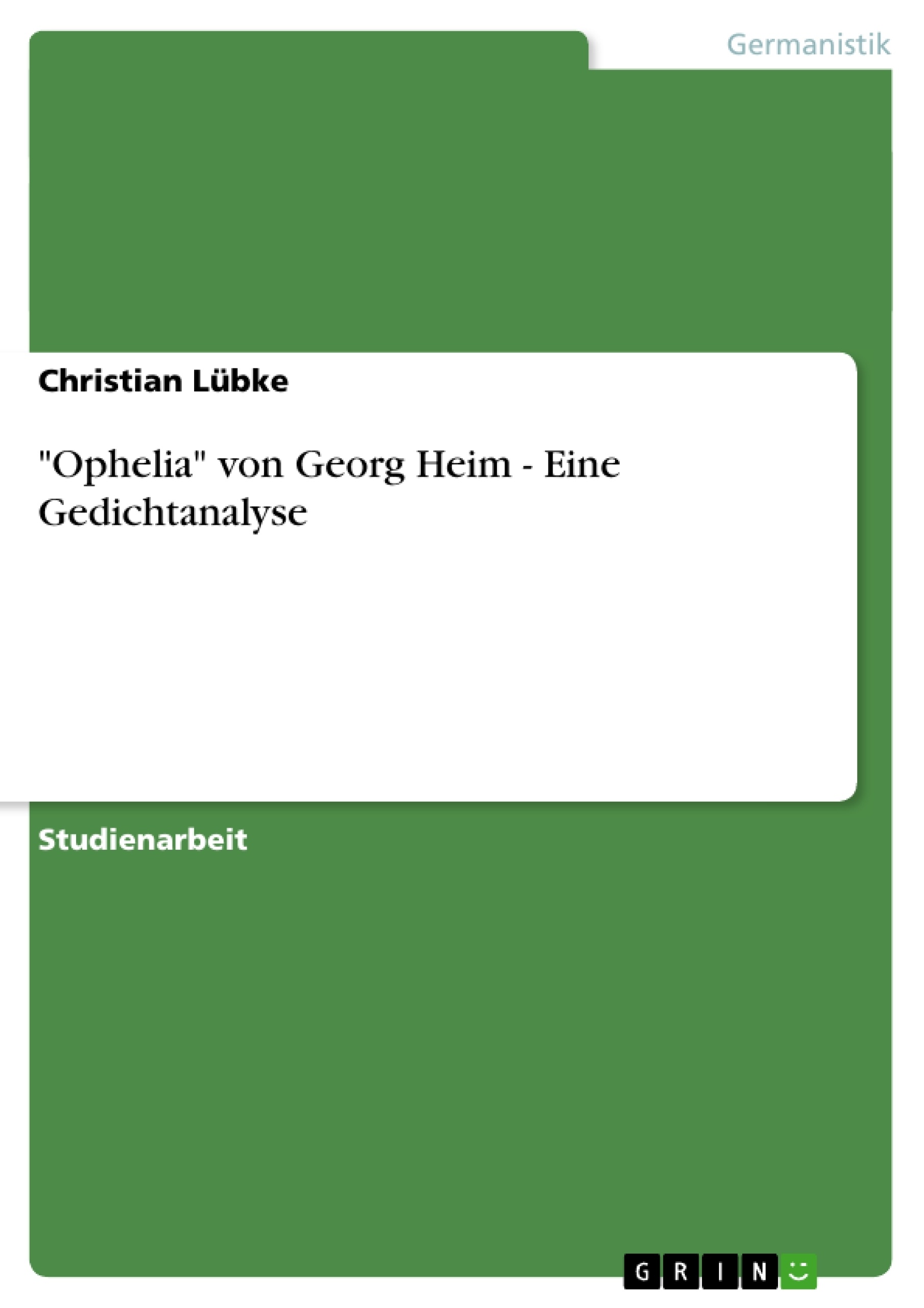„Das Wasser sei das triste, Melancholie weckende Element, das Element der Verzweiflung und des ausgesprochen weiblichen Todes.“ Hier schreibt Gaston Bachelard über den „Complexe d’Ophélie“.
Er geht hierbei auf Shakespeares Ophelia in seinem 1600-1601 verfassten Drama „Hamlet“ ein, die ihren Tod durch Ertrinken findet.
Über 300 Jahre später nimmt unter anderem Georg Heym dieses Thema in seinem Gedicht „Ophelia“, das 1911 in seinem ersten Gedichtband „Der ewige Tag“ erscheint, wieder auf.
Dieses Werk gilt als das erste bedeutsame Zeugnis des lyrischen Expressionismus.
Im Gegensatz zu anderen Gedichten, die sich auf den Ophelia Komplex beziehen, gibt Heym ihr ihre Körperlichkeit zurück und hält sich näher an Shakespeares Original.
Doch Georg Heym verschönt die Situation nicht, er beschreibt zumindest im ersten Teil den schlimmen Zustand der Wasserleiche und nimmt keine Rücksicht auf den Leser. Das Nest von Wasserratten (1), der lange, weiße Aal (13) oder die Fledermäuse (10) lösen Ekel und Schauer bei den Menschen aus.
In der zweiten Strophe wechselt die Beschreibung und es wird die Landschaft, die Ophelias Leiche durchschwimmt, beschrieben.
Hier schließt Heym die Industrialisierung mit ein und gibt dem Gedicht eine apokalyptische, endzeitliche Stimmung, die, neben der häufigen Verwendung von Farben aus dem Gebiet der Malerei, typisch für Heym und den frühen Expressionismus sind.
Doch mit welchen Mitteln Georg Heym dies verwirklicht und mit welchem Ziel er diese moderne Welt mit einbezieht, soll folgende Analyse seines Gedichts „Ophelia“ darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung: Das Ophelia Motiv bei Georg Heym
- B. Hauptteil: Textanalytische Übung
- I. Der Aufbau des Gedichts
- II. Die Kommunikationsstrukturen
- III. Die Metrische Analyse
- a) Die Metrische Analyse von Teil I
- b) Die Metrische Analyse von Teil II
- IV. Die Syntaktische Analyse
- V. Die Rhetorische Analyse
- a) Die Amplifikationsfiguren
- b) Die Bildlichkeitsfiguren
- C. Schluss: Die apokalyptische Weltanschauung von Georg Heym und der frühe Expressionismus im Gedicht „Ophelia“.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die textanalytische Übung von Georg Heyms Gedicht „Ophelia“ verfolgt das Ziel, den Aufbau, die Kommunikationsstrukturen, die metrische, syntaktische und rhetorische Analyse des Gedichts darzulegen. Die Analyse soll aufzeigen, wie Heym die apokalyptische Stimmung des frühen Expressionismus in seinem Werk einfängt.
- Der zweigeteilte Aufbau des Gedichts und die unterschiedlichen Inhalte der beiden Teile
- Die Kommunikationsstruktur des Gedichts und die Rolle des Erzählers
- Die metrische Analyse der beiden Teile des Gedichts
- Die Syntaktische Analyse als Instrument zur Analyse von Satzbau und Wortfolge
- Die Rhetorische Analyse der im Gedicht verwendeten sprachlichen Mittel
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung
Die Einleitung erläutert das Ophelia-Motiv in der Literatur und stellt Georg Heyms Gedicht „Ophelia“ als ein frühes Beispiel des lyrischen Expressionismus vor. Heyms Gedicht beschreibt die Leiche Ophelias und ihre Reise durch eine industrialisierte Landschaft, die eine apokalyptische Stimmung vermittelt.
B. Hauptteil: Textanalytische Übung
I. Der Aufbau des Gedichts
Das Gedicht besteht aus zwei Teilen, wobei Teil I aus vier und Teil II aus acht Strophen besteht. Jede Strophe besteht aus vier Versen, wodurch sich eine isometrische Strophenform ergibt. Während Teil I die Leiche Ophelias detailliert beschreibt, schildert Teil II die Reise der Leiche durch verschiedene Landschaften, einschließlich einer industrialisierten Umgebung.
II. Die Kommunikationsstrukturen
Das Gedicht wird von einem unbekannten Erzähler in der dritten Person vorgetragen, der den Zustand von Ophelias Leiche und deren Weg beschreibt. Die Kommunikation findet ausschließlich auf einer Ebene statt, da der Erzähler weder in das Geschehen eingreift noch eigene Meinungen oder Erlebnisse präsentiert.
- Quote paper
- Christian Lübke (Author), 2005, "Ophelia" von Georg Heim - Eine Gedichtanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41100