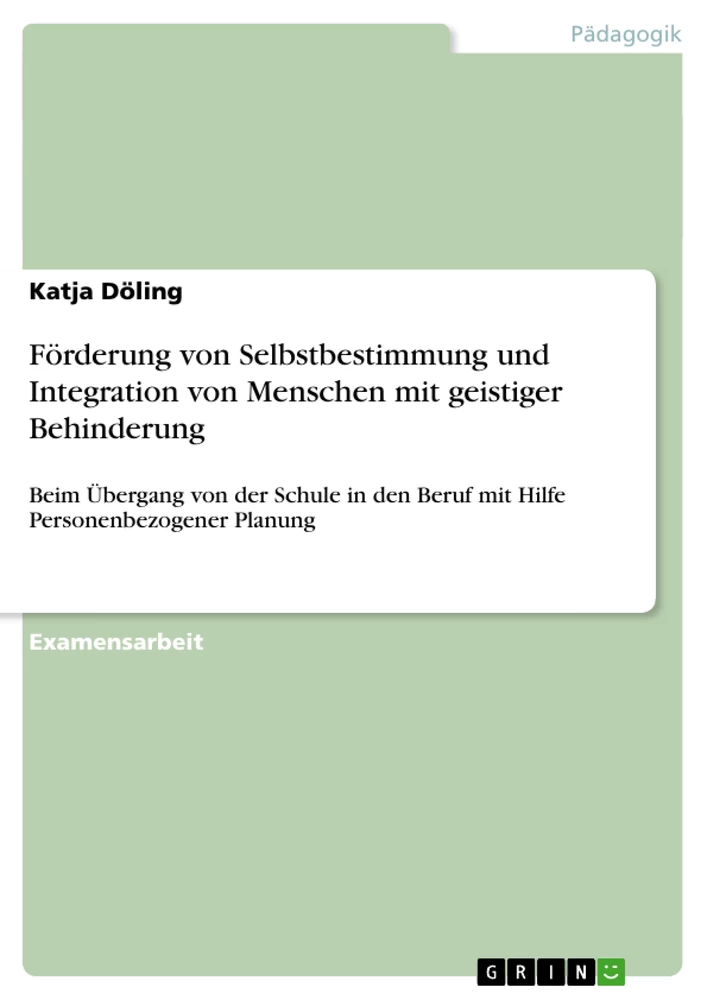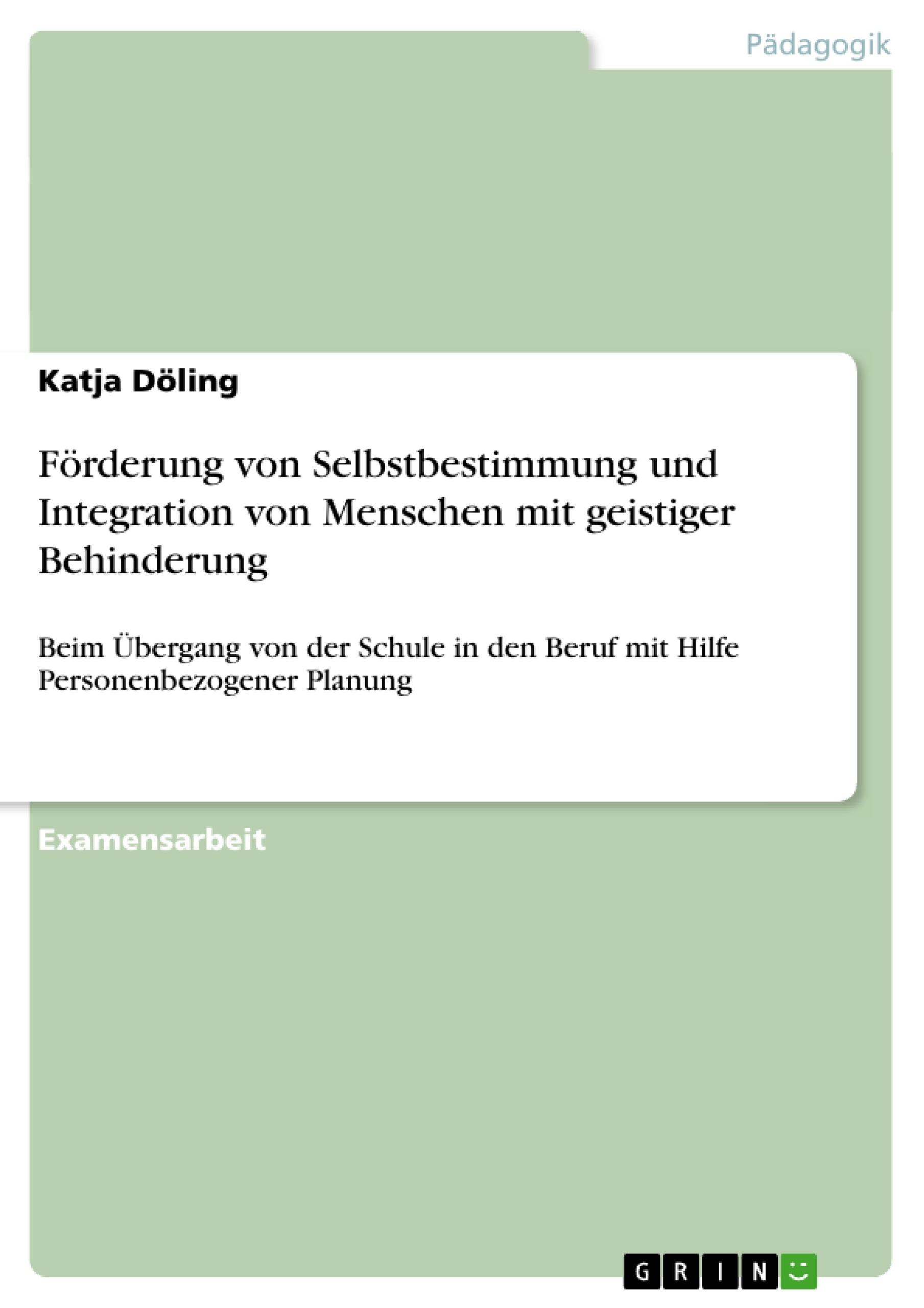Wohin gehe ich und wie sieht der Weg dorthin aus? Dies sind Fragen, die sich jeder Mensch in seinem Leben mehrere Male stellt, und auf die man zunächst häufig noch keine Antwort weiß. Solch existentiellen Fragen tauchen meist zum ersten Mal auf, wenn der Schulabschluss näher rückt. Hiermit geht der Übergang in das Arbeits- und Berufsleben einher und häufig rückt auch der Auszug in die erste eigene Wohnung näher. Die nicht einfache Entscheidung für einen Beruf fällt in eine Zeit des Erwachsenwerdens, die von den meisten Jugendlichen als spannend und aufregend, häufig aber auch als schwierig wahrgenommen wird. Weitreichende Entscheidungen müssen allmählich selber getroffen und die Folgen mehr oder weniger selber getragen werden. Dies trifft allerdings nicht auf alle Jugendlichen zu. Für die meisten jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung war und ist der Lebensweg noch immer recht genau vorgezeichnet. Sie machen ihren Schulabschluss und beginnen dann überwiegend, in einer Werkstatt für behinderte Menschen zu arbeiten. Der Auszug von zu Hause erfolgt auch heute meist nicht in eine selbst ausgesuchte Wohnung, sondern in eine Wohngruppe, in der gerade ein Zimmer frei ist. Sowohl „Integration“ in die Gesellschaft als auch „Selbstbestimmung“ in grundsätzlichen Entscheidungen ist für diese Personengruppe somit noch keine Selbstverständlichkeit. Beide Begriffe sind daher handlungsleitend für die Sonderpädagogik.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
- Geistige Behinderung - Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen
- Der Begriff "Geistige Behinderung"
- Normalisierung der Lebenswelt
- II. Aspekte der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Zum Begriff der Selbstbestimmung
- Zur Realisation von Selbstbestimmung
- Selbstbestimmung als Herausforderung an die Professionellen
- Das Empowerment-Konzept - Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen
- III. Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
- Integration - eine Begriffsbestimmung
- Prinzipien der Integrationspädagogik
- III. Möglichkeiten und Hindernisse von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich von Beruflicher Bildung und Arbeit
- Arbeit und Beruf – Bedeutung und Funktionen
- Begriffsbestimmungen - Arbeit und Beruf
- Funktionen von Arbeit und Beruf
- Stellenwert von Arbeit und Beruf und Erwartungen daran von Menschen mit (geistiger) Behinderung
- Krise des Arbeitsmarktes
- Die Problematik des Übergangs von der Schule in den Beruf - Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt für alle?
- Gesetzliche Grundlagen der Teilhabe am Arbeitsleben - Das Sozialgesetzbuch IX
- Allgemeines
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Beschäftigungspflicht und sonstige Pflichten der Arbeitgeber
- Berufliche Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Berufsvorbereitung in der Schule für geistig Behinderte
- Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit geistiger Behinderung
- Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
- Aufgaben, rechtliche Grundlagen und Ziele der WfbM
- Die WfbM als Sondereinrichtung unter den Aspekten Stigmatisierung, Integration, Normalisierung sowie Selbstbestimmung
- Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt - Grundlagen
- Grundannahmen
- Integrationsfachdienste
- Einstellung von Betrieben gegenüber der Integration von Menschen mit (geistiger) Behinderung
- "supported employment" – Unterstützte Beschäftigung
- Grundlagen
- Prinzipien unterstützter Beschäftigung
- Erfahrungen und Folgerungen aus Unterstützter Beschäftigung
- IV. Förderung von Selbstbestimmung und Integration beim Übergang von der Schule in den Beruf mit Hilfe Personenbezogener Planung - Das Beispiel der Lüneburger Assistenz gGmbH
- Vorstellung der Untersuchung
- Vorüberlegungen
- Annäherung an das Forschungsfeld
- Auswahl der Methode für die Datensammlung
- Zur Durchführung von Interviews mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Gestaltung der problemzentrierten Interviews
- Ablauf der Untersuchung
- Fixierung und Interpretation der erhobenen Daten
- Die Lüneburger Assistenz gGmbH
- Aufbau und Aufgaben der Lüneburger Assistenz gGmbH
- Das Modellprojekt des Arbeitsvorbereitungsjahres
- Personenbezogene Planung - Theoretische Grundlagen
- Grundlagen Personenbezogener Planung
- Kernaspekte Personenbezogener Planung
- Auswirkungen Personenbezogener Planung auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
- Der Unterstützerkreis
- Methoden Personenbezogener Planung
- PATH
- MAP (Making Action Plan)
- Materialien und Durchführung von Persönlichen Zukunftsplanungen im Rahmen des AVJ
- Gesamtauswertung der problemzentrierten Interviews
- Gesamtauswertung der Daten über die derzeitigen Teilnehmerinnen des AVJ
- Gesamtauswertung der Daten über die Absolventinnen des AVJ
- Einzelauswertung der Datensammlung
- Marc: "[...] mein Lehrer von der Berufsschule kannte da irgendwie einen [...]."
- Anja: ",,und dann musste ich nach Lebenshilfe rüber, und das war, fand ich auch gar nicht gut. [...] aber ich bin, jetzt macht mir das auch Spaß."
- Luisa: ",,Doch, macht Spaß. Also ohne rumzuheulen, das mach ich nicht."
- Sergej: Das ",,ist zwar anders, aber das gefällt mir nicht.".
- Alex: ",,Ähm, ich mach mit meinem Vater meistens Wurst, oder helf ihm mit."
- Mirja: ",,Meine Mutter will, dass ich hier arbeite."
- Kai: ",,Muss ich mal sehen, wie das läuft. Genau weiß ich das noch nicht."
- Aimo: ",,Weil das so nette Leute sind [...]."
- Mirco: ",,Gut. Das ist die richtige Arbeit für mich."
- Selbstbestimmung und Integration als zentrale Aspekte der inklusiven Pädagogik
- Die Bedeutung von Arbeit und Beruf für Menschen mit geistiger Behinderung
- Rechtliche Grundlagen und Fördermöglichkeiten im Bereich der beruflichen Bildung und Beschäftigung
- Herausforderungen des Übergangs von der Schule in den Beruf
- Personenbezogene Planung als Instrument zur Förderung von Selbstbestimmung und Integration
- I. Einleitung: Diese Einleitung legt den Fokus auf die Bedeutung von Selbstbestimmung und Integration für Menschen mit geistiger Behinderung und stellt den Themenbereich der Hausarbeit vor. Sie definiert den Begriff der geistigen Behinderung und beschreibt die theoretischen Grundlagen, die der Arbeit zugrunde liegen.
- II. Aspekte der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel erörtert den Begriff der Selbstbestimmung, seine Realisierung in verschiedenen Lebensbereichen und die Herausforderungen, die sich für Fachkräfte ergeben. Es geht auch auf das Empowerment-Konzept und seine Bedeutung für die Förderung von Selbstbestimmung ein.
- III. Integration von Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Integration und beleuchtet die Prinzipien der Integrationspädagogik. Es legt die Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Hindernissen von Integration im Bereich der Beruflichen Bildung und Arbeit.
- III. Möglichkeiten und Hindernisse von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich von Beruflicher Bildung und Arbeit: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung und Funktionen von Arbeit und Beruf im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung. Er beleuchtet die Problematik des Übergangs von der Schule in den Beruf, analysiert die gesetzlichen Grundlagen und die verschiedenen Modelle der beruflichen Bildung und Beschäftigung, wie z.B. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und unterstützte Beschäftigung.
- IV. Förderung von Selbstbestimmung und Integration beim Übergang von der Schule in den Beruf mit Hilfe Personenbezogener Planung - Das Beispiel der Lüneburger Assistenz gGmbH: Dieses Kapitel fokussiert auf die praktische Umsetzung von personenbezogener Planung im Übergang von der Schule in den Beruf. Es stellt die Lüneburger Assistenz gGmbH vor, analysiert die Methoden und Inhalte der personenbezogenen Planung und beleuchtet die Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen des Arbeitsvorbereitungsjahres.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Förderung von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im Übergang von der Schule in den Beruf. Sie untersucht, wie personenbezogene Planung dabei unterstützen kann und welche Herausforderungen und Chancen sich im Prozess der beruflichen Integration ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Selbstbestimmung, Integration, geistige Behinderung, Berufliche Bildung, Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), "supported employment", Personenbezogene Planung, Übergangsmanagement und Inklusion.
- Quote paper
- Katja Döling (Author), 2004, Förderung von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41064