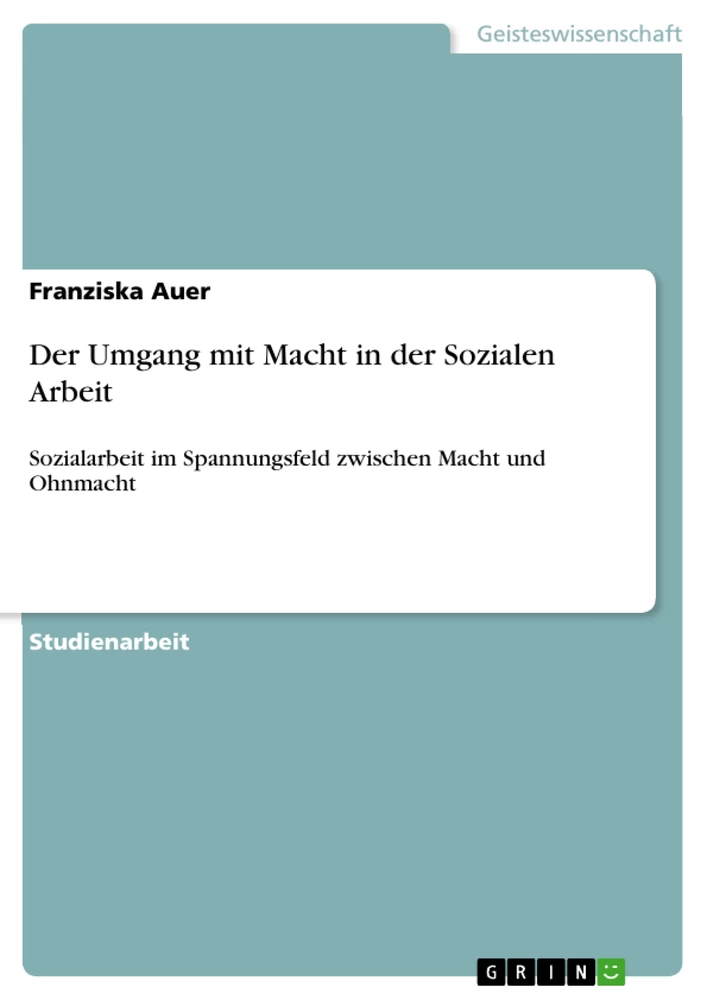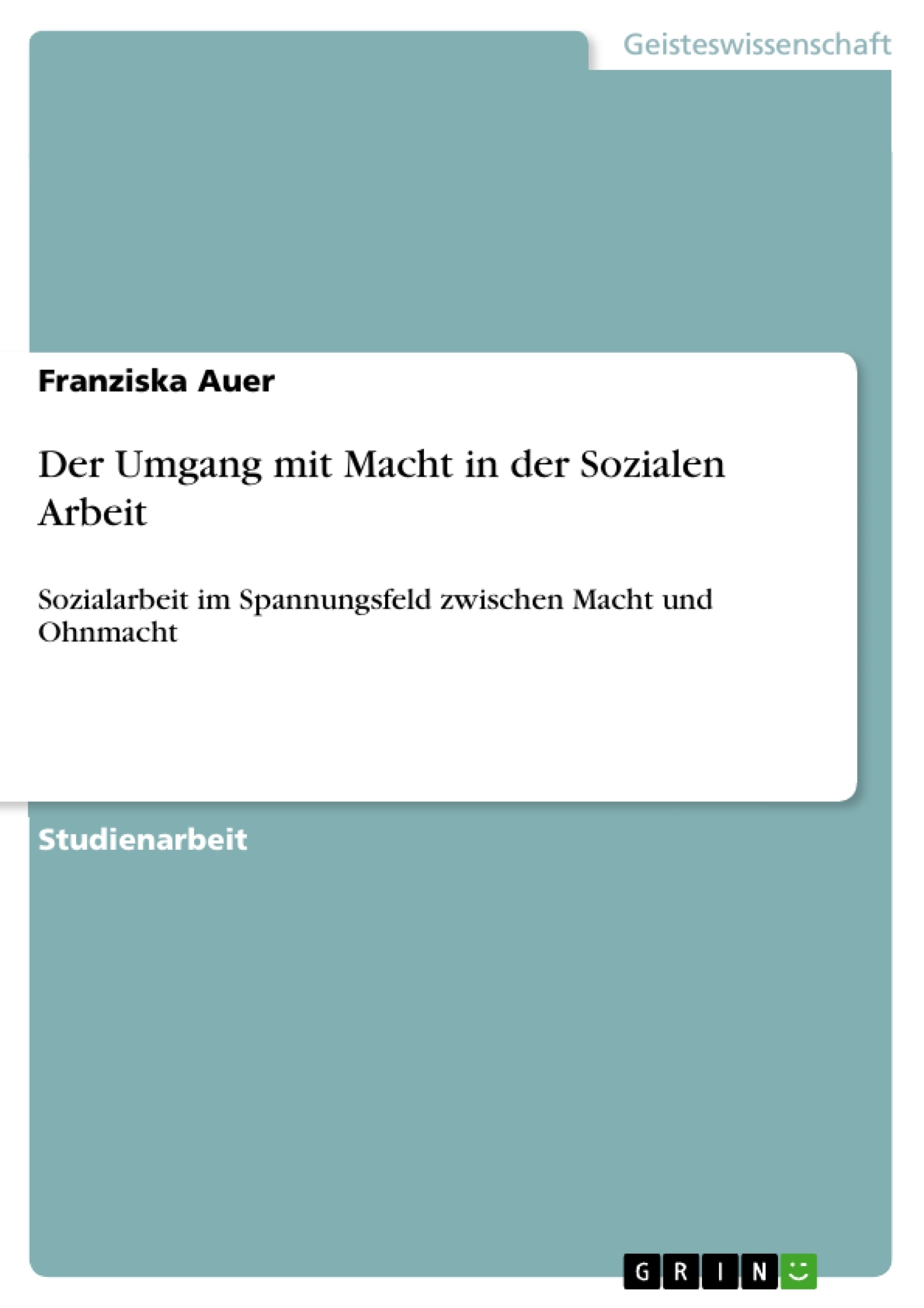Als ich mit der Bearbeitung der Thematik Macht und Ohnmacht in der Sozialen Arbeit begann, stellten sich mir nicht viele Fragen. Es schien selbstverständlich, dass ein Sozialarbeiter sich seiner beruflichen Macht bewusst ist und sie im Sinne einer zielgerichteten Arbeit mit dem Klienten sinnvoll einzusetzen weiß. In der genaueren Auseinandersetzung mit der Literatur stellte sich Macht im Rahmen Sozialer Arbeit jedoch als kontroverse, ja problematische Thematik dar: Über Macht im allgemeinen wird viel gesprochen – über Macht in der Sozialen Arbeit lieber geschwiegen. Hier galt es also nachzuhaken.
Zu der Auseinandersetzung mit Macht gehört, auch den Gegenpart, die Ohnmacht, zu betrachten. Ohnmacht bedeutet dabei immer die Abwesenheit von eigener Macht. Dass sich Angehörige helfender Berufe, in erster Linie aber Klienten ohnmächtig, hilflos fühlen können, ist ein anerkanntes und akzeptiertes Gefühl.
Aufgabe hier muss sein, Wege aus der eigenen Ohnmacht zu finden, um ihr nicht ausgeliefert zu sein, sie auch als eigene Grenzen akzeptieren lernen und dem Klienten Möglichkeiten aufzuzeigen, seine Ohnmacht zu überwinden.
Macht wird wenig thematisiert, wird weggeschoben. Macht im sozialen Arbeitsfeld gilt häufig als etwas Negatives. „So wird „Macht“ sofort mit „Machtmissbrauch“ gleichgesetzt, mit einem Zustand, den es möglichst rasch zu überwinden gilt“ (Stiels – Glenn 1996, S. 16). Macht wird verleugnet.
Die Existenz von Macht in der Sozialen Arbeit, ja deren Berechtigung voraussetzend, wird sich diese Arbeit vordergründig damit beschäftigen, nach dem Warum zu fragen. Nach Definition und Begriffserläuterung setzt sich das 2. Kapitel mit möglichen Ursachen, Gründen, deren Konsequenzen und dem Problem des Machtmissbrauchs auseinander.
Ohnmacht als Gegenpart von Macht und als ein Gefühl, dem von Sozialarbeitern professionell begegnet werden kann, sei es die eigene Ohnmacht oder die des Klienten, wird in Kapitel 3 thematisiert.
Schlussthesen zu Möglichkeiten und Grenzen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der beruflichen Macht beschließen im letzten Kapitel meine Ausführungen.
Um den Kreis dieser einleitenden Bemerkungen zu schließen und in die Diskussion einzusteigen, provoziere ich, frage ich nun: Kann es im Interesse der Profession Sozialarbeit liegen, sich der Machtfrage zu entziehen – oder anders – wie professionell ist Soziale Arbeit, wenn sich der Umgang mit Macht so schwierig gestaltet?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Macht und Soziale Arbeit - (k)ein Widerspruch
- Definition von Macht und begriffliche Erläuterungen
- Macht in der Sozialen Arbeit
- Umgang mit beruflicher Macht
- Macht im Selbstverständnis des Sozialarbeiters
- Macht und Verantwortung
- Machtmissbrauch in der Sozialarbeit
- Ohnmacht in der Sozialen Arbeit
- Die Ohnmacht beim Helfen
- Der Ohnmacht begegnen
- Schlussthesen für einem verantwortungsvollem Umgang mit Macht in der Sozialen Arbeit
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Thematik von Macht und Ohnmacht im Kontext Sozialer Arbeit. Ziel ist es, die oft verdrängte Rolle von Macht in diesem Berufsfeld zu beleuchten und einen verantwortungsvollen Umgang damit zu diskutieren. Dabei werden sowohl die Macht des Sozialarbeiters als auch die Ohnmacht des Klienten betrachtet.
- Definition und Verständnis von Macht in der Sozialen Arbeit
- Die Rolle von Machtstrukturen und Institutionen
- Machtmissbrauch und seine Vermeidung
- Der Umgang mit Ohnmacht bei Sozialarbeitern und Klienten
- Entwicklung von Strategien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung thematisiert die anfängliche Naivität bezüglich der Thematik Macht und Ohnmacht in der Sozialen Arbeit und die überraschende Entdeckung der Kontroverse um Macht im Kontext des Helfens. Sie führt in die Problematik ein, indem sie die Notwendigkeit der Betrachtung von Macht und Ohnmacht als zwei Seiten derselben Medaille betont, und die Notwendigkeit, Wege aus der Ohnmacht zu finden, für sowohl den Sozialarbeiter als auch den Klienten, hervorhebt. Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Professionalität Sozialer Arbeit im Umgang mit Macht.
Macht und Soziale Arbeit - (k)ein Widerspruch: Dieses Kapitel beginnt mit vier zentralen Thesen, die das Verständnis von Macht in der Sozialen Arbeit prägen: falsches Verständnis von Sozialarbeit führt zur Verleugnung beruflicher Macht; Angst vor Verantwortung verhindert die bewusste Anwendung von Macht; Sozialarbeiter definieren sich eher als ohnmächtig; Macht verleitet zu Machtmissbrauch. Es folgt eine differenzierte Betrachtung des Machtbegriffs, unter Einbezug von Definitionen aus der Brockhaus Enzyklopädie, Max Weber und Niklas Luhmann. Die verschiedenen Facetten von Macht (Handlung, Definition, Begrenzung) werden erläutert, bevor die spezifischen Ausprägungen von Macht in der Sozialen Arbeit diskutiert werden.
Ohnmacht in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ohnmacht als Gegenpart zur Macht, sowohl die des Sozialarbeiters als auch die des Klienten. Es analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Ohnmacht im Kontext des Helfens und erörtert Strategien und Möglichkeiten, um der Ohnmacht zu begegnen und sowohl die eigenen Grenzen als auch die des Klienten zu akzeptieren und zu überwinden. Das Kapitel bietet somit einen wichtigen Gegenpol zur Machtperspektive und betont die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Verständnisses des Machtverhältnisses in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Macht, Ohnmacht, Soziale Arbeit, Machtmissbrauch, Verantwortung, Professionalisierung, Hilfsbedürftigkeit, Klient, Sozialarbeiter, Machtstrukturen, Institutionen, professioneller Umgang, Definitionsmacht, Handlungsmacht, Begrenzungsmacht.
Häufig gestellte Fragen zu "Macht und Ohnmacht in der Sozialen Arbeit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die komplexe Thematik von Macht und Ohnmacht im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die oft verdrängte Rolle von Macht in diesem Berufsfeld und diskutiert einen verantwortungsvollen Umgang damit. Dabei werden sowohl die Macht des Sozialarbeiters als auch die Ohnmacht des Klienten betrachtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und das Verständnis von Macht in der Sozialen Arbeit, die Rolle von Machtstrukturen und Institutionen, Machtmissbrauch und dessen Vermeidung, den Umgang mit Ohnmacht bei Sozialarbeitern und Klienten sowie die Entwicklung von Strategien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Macht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik von Macht und Ohnmacht in der Sozialen Arbeit einführt. Das Hauptkapitel behandelt "Macht und Soziale Arbeit - (k)ein Widerspruch", einschließlich einer Definition von Macht und deren Ausprägungen in der Sozialen Arbeit. Ein weiteres Kapitel konzentriert sich auf "Ohnmacht in der Sozialen Arbeit", analysiert deren Ursachen und Auswirkungen und erörtert Strategien zur Bewältigung. Schließlich werden Schlussthese und ein Schlusswort präsentiert.
Welche zentralen Thesen prägen das Verständnis von Macht in der Sozialen Arbeit?
Zentrale Thesen sind: falsches Verständnis von Sozialarbeit führt zur Verleugnung beruflicher Macht; Angst vor Verantwortung verhindert die bewusste Anwendung von Macht; Sozialarbeiter definieren sich eher als ohnmächtig; Macht verleitet zu Machtmissbrauch.
Wie wird der Machtbegriff in der Arbeit definiert und differenziert?
Die Arbeit differenziert den Machtbegriff unter Einbezug von Definitionen aus der Brockhaus Enzyklopädie, Max Weber und Niklas Luhmann. Es werden verschiedene Facetten von Macht (Handlung, Definition, Begrenzung) erläutert.
Wie wird der Umgang mit Ohnmacht in der Sozialen Arbeit behandelt?
Das Kapitel zur Ohnmacht analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Ohnmacht im Kontext des Helfens und erörtert Strategien und Möglichkeiten, um der Ohnmacht zu begegnen und sowohl die eigenen Grenzen als auch die des Klienten zu akzeptieren und zu überwinden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Macht, Ohnmacht, Soziale Arbeit, Machtmissbrauch, Verantwortung, Professionalisierung, Hilfsbedürftigkeit, Klient, Sozialarbeiter, Machtstrukturen, Institutionen, professioneller Umgang, Definitionsmacht, Handlungsmacht, Begrenzungsmacht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die oft verdrängte Rolle von Macht in der Sozialen Arbeit zu beleuchten und einen verantwortungsvollen Umgang damit zu diskutieren.
Welche konkreten Fragen werden in der Einleitung aufgeworfen?
Die Einleitung thematisiert die anfängliche Naivität bezüglich Macht und Ohnmacht in der Sozialen Arbeit und die überraschende Entdeckung der Kontroverse um Macht im Kontext des Helfens. Sie betont die Notwendigkeit der Betrachtung von Macht und Ohnmacht als zwei Seiten derselben Medaille und die Notwendigkeit, Wege aus der Ohnmacht zu finden. Die zentrale Frage ist die nach der Professionalität Sozialer Arbeit im Umgang mit Macht.
- Quote paper
- Franziska Auer (Author), 2005, Der Umgang mit Macht in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41047