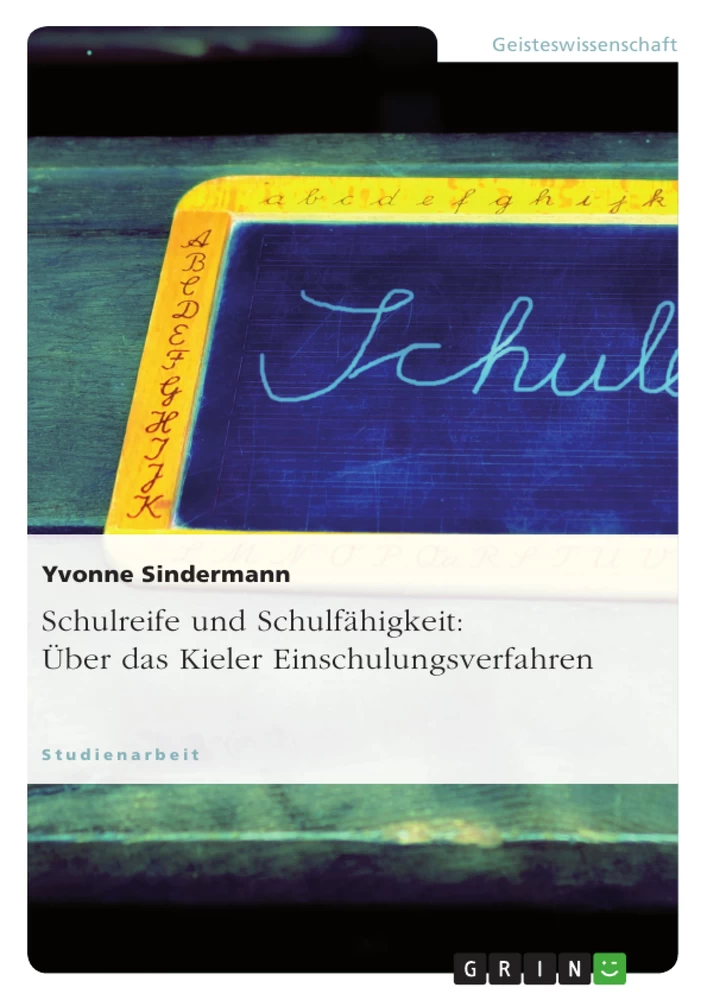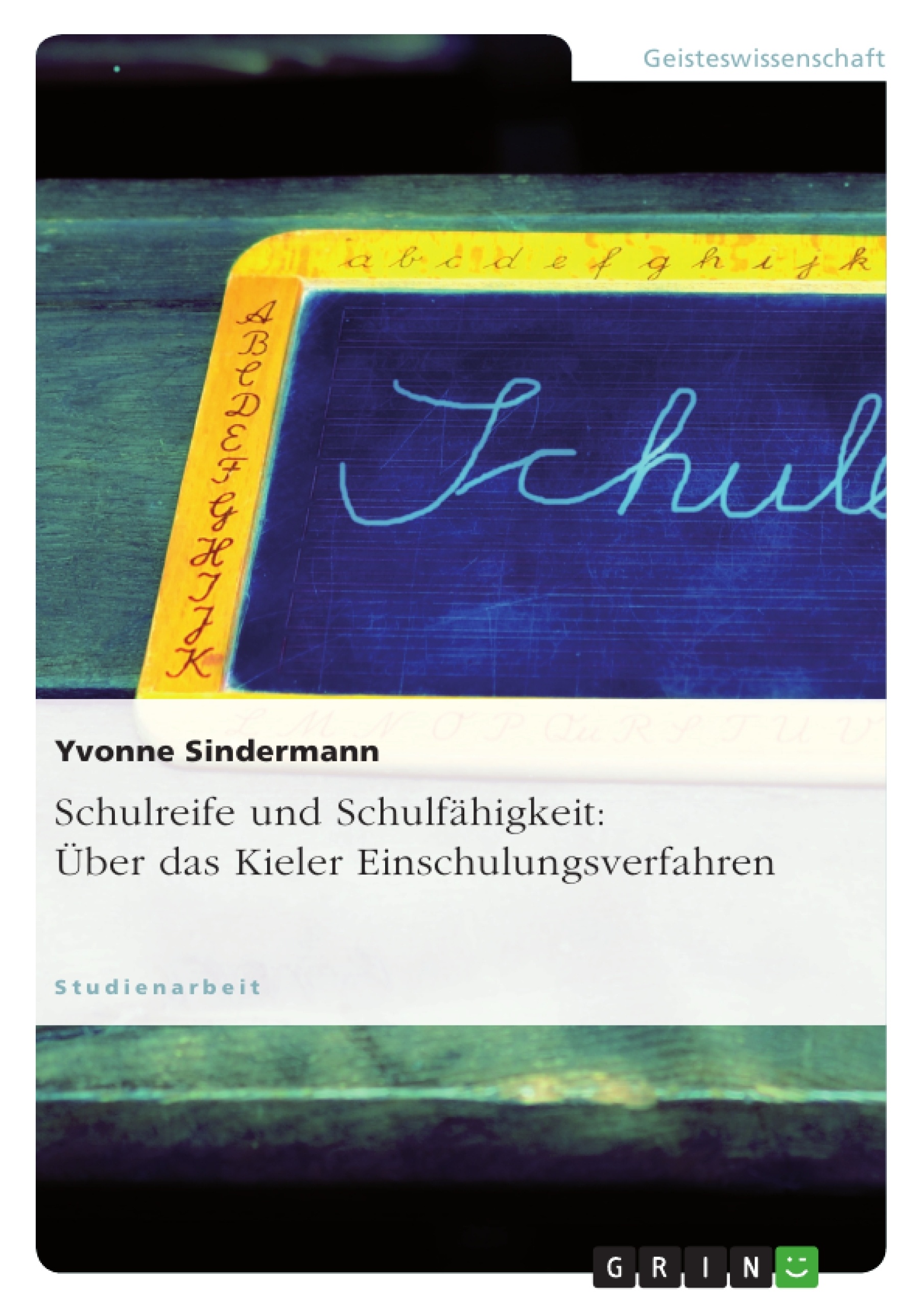Zu einem bestimmtem Termin wird in Deutschland jedes Kind schulpflichtig. Als problematisch erweist sich, dass jährlich ca. 10% der schulpflichtigen Kinder zurückgestellt werden. Sie sind nicht schulfähig, was immer dies auch bedeuten mag.
Faust-Siehl plädiert für eine Abschaffung des Begriffs „Schulfähigkeit“ und fordert einen integrierten Schulanfang. Für Nickel ist der Begriff nicht so entscheidend, sondern das Konstrukt, welches dahintersteht. Richter stellt die „Schulfähigkeit des Kindes“ oder die „Kindfähigkeit der Schule“ zur Diskussion. Kammermeyer, orientiert am Modell Nickels, welches später noch erläutert wird, möchte diesen Begriff beibehalten, denn er beinhaltet ein grundlegendes pädagogisches Ziel: die Zusammenarbeit aller an der Erziehung Beteiligten. Der Begriff von Schenk-Danzinger „Schulbereitschaft“, welcher neben dem Kinde auch weitere Faktoren zu berücksichtigen versucht (Motivation, Lernanregung,...) konnte sich nicht durchsetzen.
Um Verfahren zur Schuleingangsdiagnostik, wie das KEV, bewerten zu können und insgesamt in der Schulfähigkeitsdikussion einen Überblick behalten zu können bedarf es vor einer näheren Betrachtung des Kieler Einschulungsverfahrens (KEV) einer Auseinandersetzung mit dem Wandel der Konzepte von Schulfähigkeit.
Neben der genauen Beschreibung des Wandels der Schulfähigkeitsdikussion wird in meiner Arbeit das KEV in seiner Gesamtheit vorgestellt und auch hinsichtlich der Gütekriterien kritisch betrachtet. Des weiteren werden neuere Ansätze in diesem Bereich aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft
- 1. Allgemeine Problematik
- 2. Der Wandel der Schulfähigkeitsdiskussion
- 2.1. Schulreife
- 2.2. Der Wandel zur Schulfähigkeit
- 2.3. Schulfähigkeit auf der Grundlage der Lerntheorie
- 2.4. Schulfähigkeit aus Ökosystemischer Perspektive
- 2.5. Konstrukt Schulfähigkeit als Entwicklungsaufgabe sowie als soziokulturelles
- II. Das Kieler Einschulungsverfahren
- 1. Hintergrundinformationen
- 1.1. Begründung des Verfahrens
- 1.2. Die Inhaltsbereiche
- 2. Die 3 Bausteine des Verfahrens
- 2.1. Das Elterngespräch
- 2.1.1. Allgemeine Hinweise
- 2.1.2. Durchführung
- 2.2. Das Unterrichtsspiel
- 2.2.1. Allgemeine Hinweise
- 2.2.2. Durchführung
- 2.2.3. Darstellung der Aufgaben
- 2.3. Die Einzeluntersuchung
- 3. Die Auswertung und Entscheidungsfindung
- 4. Betrachtung der Gütekriterien
- 4.1. Objektivität
- 4.2. Reliabilität
- 4.3. Validität
- 5. Kritische Betrachtung
- 5.1. positive Aspekte
- 5.2. negative Aspekte
- 6. Neuere Ansätze zur Diagnose und Förderung von Schulfähigkeit
- III. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Kieler Einschulungsverfahren (KEV) und dessen Einordnung in den Diskurs um Schulreife und Schulfähigkeit. Ziel ist es, das KEV zu beschreiben, zu analysieren und kritisch zu betrachten, indem dessen Entwicklung im Kontext des Wandels des Schulfähigkeitsbegriffs beleuchtet wird.
- Der Wandel des Schulfähigkeitsbegriffs von Schulreife zu einem ökosystemischen Verständnis.
- Beschreibung und Analyse des Kieler Einschulungsverfahrens (KEV).
- Bewertung des KEV anhand von Gütekriterien.
- Kritische Auseinandersetzung mit positiven und negativen Aspekten des KEV.
- Einordnung des KEV in neuere Ansätze zur Diagnose und Förderung von Schulfähigkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft: Dieses Kapitel behandelt die Problematik der Schulfähigkeit und den Wandel des Verständnisses dieses Konstrukts. Es beginnt mit der Diskussion um die Definition von Schulfähigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen, wie z.B. die jährliche Zurückstellung von ca. 10% der schulpflichtigen Kinder. Der Text verfolgt die Entwicklung des Begriffs von der Schulreife nach Kern, die stark auf Reifungsprozesse fokussiert war, bis hin zu einem ökosystemischen Ansatz, der das Kind in seinem gesamten Umfeld betrachtet. Die verschiedenen Ansätze werden kritisch beleuchtet und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen herausgearbeitet, um den komplexen und vielschichtigen Diskurs um die Schulfähigkeit zu veranschaulichen. Die unterschiedlichen Definitionen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Schuleingangsdiagnostik werden detailliert erläutert, wobei die Grenzen und Potenziale der verschiedenen theoretischen Modelle hervorgehoben werden.
II. Das Kieler Einschulungsverfahren: Dieses Kapitel beschreibt das Kieler Einschulungsverfahren (KEV) detailliert. Es beleuchtet die Hintergründe und die Begründung des Verfahrens, sowie die drei zentralen Bausteine: das Elterngespräch, das Unterrichtsspiel und die Einzeluntersuchung. Für jeden Baustein werden Durchführung und Inhalte erklärt, wobei die Aufgaben des Unterrichtsspiels im Detail dargestellt werden. Es wird nicht nur das Verfahren an sich beschrieben, sondern auch auf die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität eingegangen, um die wissenschaftliche Fundiertheit zu beurteilen. Abschließend werden positive und negative Aspekte des KEV kritisch diskutiert und in den Kontext aktueller Ansätze zur Diagnose und Förderung von Schulfähigkeit eingeordnet. Die Kapitelstruktur vermittelt ein umfassendes Verständnis des Verfahrens und seiner Implikationen.
Schlüsselwörter
Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft, Kieler Einschulungsverfahren (KEV), Schuleingangsdiagnostik, Lerntheorie, Ökosystemischer Ansatz, Entwicklungsaufgabe, Gütekriterien, Förderung, Selektionsdiagnostik.
Häufig gestellte Fragen zum Kieler Einschulungsverfahren (KEV)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Kieler Einschulungsverfahren (KEV) und seiner Einordnung in den Diskurs um Schulreife und Schulfähigkeit. Sie beschreibt, analysiert und bewertet das KEV kritisch, unter Berücksichtigung der Entwicklung des Schulfähigkeitsbegriffs.
Welche Aspekte des Schulfähigkeitsbegriffs werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Schulfähigkeitsbegriffs von der traditionellen Schulreife (fokussiert auf Reifungsprozesse) hin zu einem ökosystemischen Verständnis, welches das Kind in seinem gesamten Umfeld betrachtet. Verschiedene Ansätze werden kritisch beleuchtet und ihre Stärken und Schwächen herausgearbeitet.
Wie wird das Kieler Einschulungsverfahren (KEV) beschrieben?
Das KEV wird detailliert beschrieben, inklusive seiner Hintergründe und Begründung. Die drei Hauptbestandteile – Elterngespräch, Unterrichtsspiel und Einzeluntersuchung – werden einzeln erklärt, inklusive Durchführung und Inhalte (insbesondere die Aufgaben des Unterrichtsspiels). Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität werden zur Beurteilung der wissenschaftlichen Fundiertheit des Verfahrens herangezogen.
Welche Gütekriterien werden im Zusammenhang mit dem KEV betrachtet?
Die Arbeit bewertet das KEV anhand der klassischen Gütekriterien der psychologischen Testtheorie: Objektivität, Reliabilität und Validität. Diese Kriterien werden im Detail erläutert und auf ihre Anwendung im KEV bezogen.
Welche Kritikpunkte werden am KEV geäußert?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit positiven und negativen Aspekten des KEV. Sowohl Stärken als auch Schwächen des Verfahrens werden benannt und diskutiert.
Wie wird das KEV in den Kontext aktueller Ansätze eingeordnet?
Das KEV wird in den Kontext neuerer Ansätze zur Diagnose und Förderung von Schulfähigkeit eingeordnet. Die Arbeit vergleicht und kontrastiert das KEV mit aktuellen Entwicklungen im Feld der Schuleingangsdiagnostik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: I. Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft; II. Das Kieler Einschulungsverfahren; III. Resümee. Kapitel I behandelt den Wandel des Schulfähigkeitsbegriffs. Kapitel II beschreibt und analysiert das KEV detailliert, einschließlich der Gütekriterien und einer kritischen Betrachtung. Kapitel III fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft, Kieler Einschulungsverfahren (KEV), Schuleingangsdiagnostik, Lerntheorie, Ökosystemischer Ansatz, Entwicklungsaufgabe, Gütekriterien, Förderung, Selektionsdiagnostik.
- Quote paper
- Yvonne Sindermann (Author), 2004, Schulreife und Schulfähigkeit: Über das Kieler Einschulungsverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41044