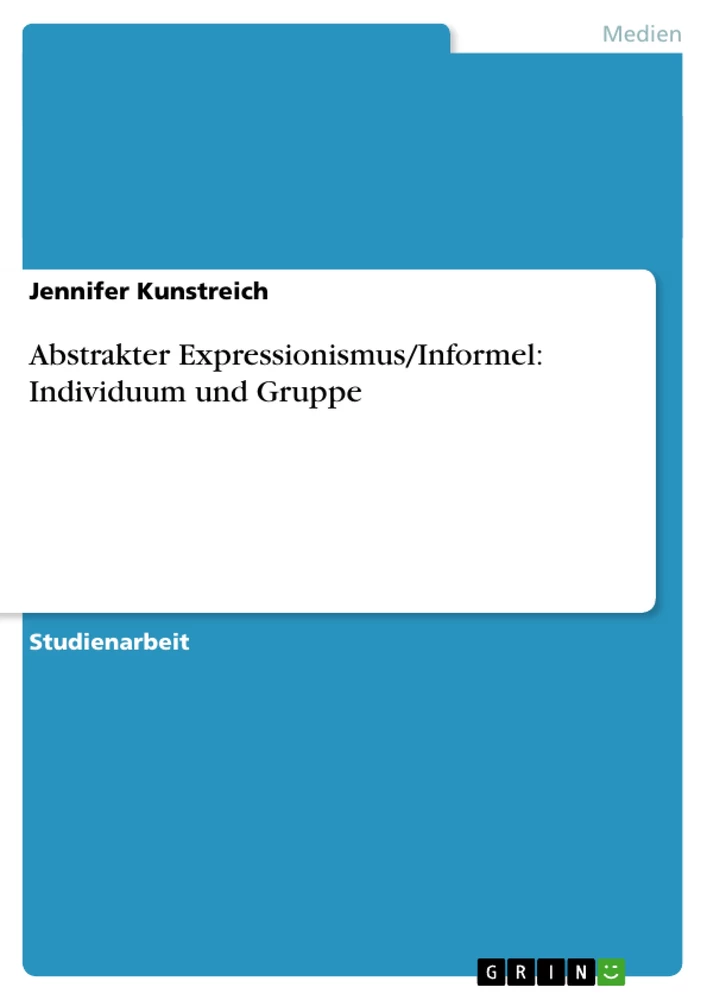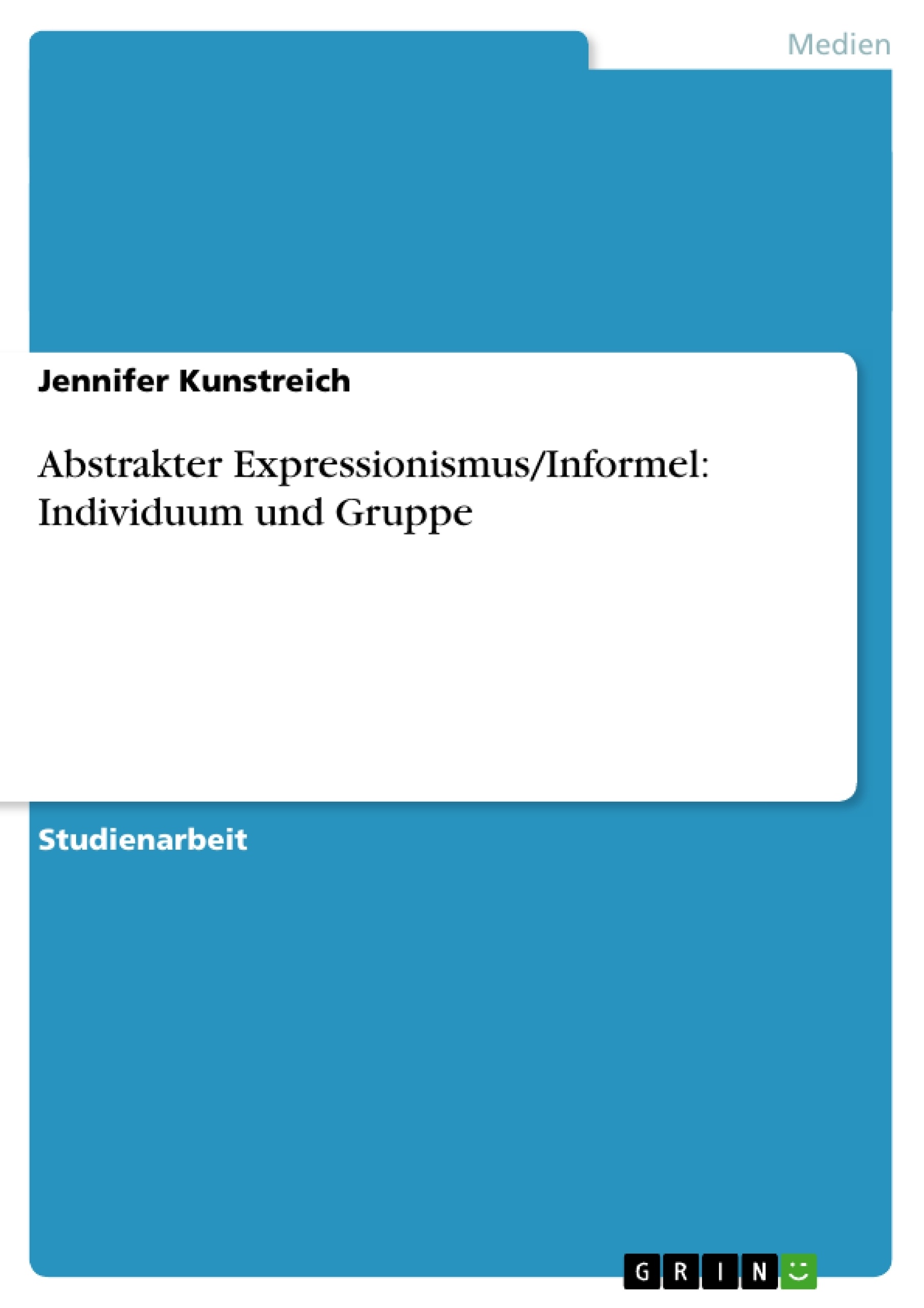“… all modern painting is self-expression”
Die Konstruktion von Individualität in Gruppierungen informel arbeitender Künstler
Die Überbegriffe Abstrakter Expressionismus/Tachismus/Informel bezeichnen weder einen einheitlichen Stil, noch kennzeichnen diese Begriffe deutlich voneinander unterscheidbare Stilrichtungen. Die Zuordnung von Kunstwerken zu diesen Stilbezeichnungen scheint bei näherer Betrachtung eher ein Behelf zur Handhabung verschiedenster künstlerischer Entwicklungslinien, die alle - mehr oder weniger - der nicht-geometrischen, abstrakten Malerei entsprungen sind.
Durch den Vergleich von einzelnen Künstlern aus Amerika, Frankreich und Deutschland kann deutlich werden, dass gerade der gestalterischen Herangehensweise, aber auch dem Ausdruckswillen der Künstler sehr individuelle Methoden und Ideen zu Grunde liegen. Die Werke von Künstlerzusammenschlüssen, wie der „New York School“ sind untereinander kaum vergleichbar.
Ein überwiegender Teil der Überblicksliteratur zu dieser Kunstrichtung beschäftigt sich mit den Ideen und Konstrukten, aus denen die Kunst des Abstrakten Expressionismus hervorgegangen ist. Solche Analysen sprechen vom „Individuum als Wert und Schlüssel“ zur Idee der informellen Kunst. In diesem Klima der Individualisierung schien das Potential zur Bildung von Künstlergruppen nicht angelegt.
Im nachfolgenden Text soll gezeigt werden, mit welchen gesellschaftlichen Konzepten von Individualität die Künstler des Abstrakten Expressionismus in den USA der 40er und 50er Jahre konfrontiert waren und welche kulturellen und ästhetischen Wechselbeziehungen sich daraus ergeben haben. Kunst ist immer Teil gesamtgesellschaftlicher Diskurse, dessen Thema in diesem Fall „die Freiheit des Individuums“ in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg umfasste.
Von dem Beispiel des amerikanischen Abstrakten Expressionismus ausgehend, werden Vergleiche zur informellen Kunst in Deutschland gezogen, um im Bezug auf die Kategorien „Individuum und Gruppe“ herauszufinden, ob es ein vergleichbares geistiges Klima gab, das Parallelen und damit auch Zusammenhänge aufweist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Problem der Kategorien
- 2. „New York School“
- 2.1. Der kulturgeschichtliche Kontext des Abstrakten Expressionismus in Amerika
- 2.1.1. Kunst als Gegenstand politischer Förderprogramme
- 2.1.2. Kunst als Propagandawaffe?
- 2.1.3. Die gesellschaftliche Konstruktion der heroischen Individualität des Künstlers
- 2.1.4. „The Artist Speaks“
- 2.2. Die Suche nach dem Selbst
- 2.1. Der kulturgeschichtliche Kontext des Abstrakten Expressionismus in Amerika
- 3. Die Entwicklung des Informel in Deutschland nach 1945
- 3.1. Gruppen
- 3.2. Konzepte von Individualität und Universalismus in Deutschland
- 3.3. Die „Quadriga“ - Individuen und Gruppe
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Individualität innerhalb von informell arbeitenden Künstlergruppen, insbesondere im Kontext des Abstrakten Expressionismus, des Tachismus und des Informel. Sie hinterfragt die Eignung etablierter Kategorien zur Beschreibung dieser künstlerischen Bewegungen und beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Konzepte von Individualität auf die Kunstproduktion.
- Die Problematik der Kategorien „Abstrakter Expressionismus“, „Tachismus“ und „Informel“
- Der Einfluss gesellschaftlicher Konzepte von Individualität auf die Künstler der „New York School“
- Der Vergleich von individuellen Künstlerwegen im Kontext von Gruppenzugehörigkeit oder -ablehnung
- Die Rezeption der „New York School“ in Deutschland und die Entwicklung des Informel
- Die Rolle von Künstlergruppen und die Betonung von Individualität in der informellen Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Problem der Kategorien: Dieses Kapitel untersucht die Schwierigkeiten, den Abstrakten Expressionismus, den Tachismus und das Informel mit etablierten Kategorien zu erfassen. Es wird argumentiert, dass diese Bezeichnungen eher als behelfsmäßige Mittel zur Beschreibung verschiedener künstlerischer Entwicklungslinien dienen, die alle aus der nicht-geometrischen, abstrakten Malerei hervorgegangen sind. Die Autorin hinterfragt die stilistische Einheitlichkeit und die Abgrenzbarkeit dieser Begriffe und diskutiert die Notwendigkeit, möglicherweise neue Kategorien zu entwickeln, die nationale und zeitliche Grenzen überbrücken und den vermeintlichen Unterschied zwischen dem Abstrakten Expressionismus in Amerika und dem Tachismus/Informel in Europa hinterfragen. Die Frage nach den Kriterien für neue Zuordnungen – seien es die Ideen der Künstler, gemeinsame Traditionszusammenhänge oder formale Kriterien – wird aufgeworfen. Schließlich wird der Schluss gezogen, dass die Künstler die Begriffe „Abstrakter Expressionismus/Tachismus/Informel“ jeweils individuell gefüllt haben, und dass die Betonung von Individualität ein wesentliches Merkmal dieser Kunstrichtung darstellt.
2. „New York School“: Dieses Kapitel analysiert den kulturgeschichtlichen Kontext des Abstrakten Expressionismus in Amerika, untersucht die Rolle der Kunst in politischen Förderprogrammen und deren mögliche Instrumentalisierung als Propagandawaffe. Es befasst sich mit der gesellschaftlichen Konstruktion der heroischen Individualität des Künstlers und der damit verbundenen "The Artist Speaks"-Ästhetik. Die Suche nach dem Selbst als zentrales Motiv wird im Kontext der künstlerischen Produktion und der Herausbildung der "New York School" beleuchtet. Der Abschnitt beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, künstlerischer Produktion und der Konstruktion des individuellen Künstler-Ichs in der Nachkriegszeit. Es wird herausgestellt, wie die Künstler ihre Techniken und Ausdrucksweisen als Ausdruck ihrer eigenen seelischen Befindlichkeit verstanden haben.
3. Die Entwicklung des Informel in Deutschland nach 1945: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des Informel in Deutschland nach 1945. Es untersucht verschiedene Künstlergruppen, die Konzepte von Individualität und Universalismus im deutschen Kontext sowie die Rolle der „Quadriga“ als Beispiel für das Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe in der informellen Kunst. Die Zusammenhänge zwischen der amerikanischen "New York School" und der Entwicklung des Informel in Deutschland werden erörtert, mit dem Fokus auf parallelen geistigen Klimata und Einflüssen. Der Abschnitt beleuchtet die spezifischen Bedingungen und den kulturellen Kontext, die die Entwicklung der informellen Kunst in Deutschland prägten. Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Individualität und Gruppenbildung in diesem spezifischen Kontext steht im Zentrum der Kapitelbetrachtung.
Schlüsselwörter
Abstrakter Expressionismus, Tachismus, Informel, New York School, Individualität, Gruppe, Künstlergruppe, gesellschaftliche Konzepte, Kunst und Politik, kultureller Kontext, Amerika, Deutschland, Malerei, Selbst-Expression.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Konstruktion von Individualität in informellen Künstlergruppen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Individualität innerhalb informell arbeitender Künstlergruppen, insbesondere im Kontext des Abstrakten Expressionismus, des Tachismus und des Informel. Sie hinterfragt dabei die Eignung etablierter Kategorien und beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Konzepte von Individualität auf die Kunstproduktion.
Welche Künstlergruppen und Kunstbewegungen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die „New York School“ des Abstrakten Expressionismus in Amerika und die Entwicklung des Informel in Deutschland nach 1945. Dabei werden auch spezifische Künstlergruppen und deren Einfluss auf die individuelle künstlerische Entwicklung betrachtet, zum Beispiel die „Quadriga“ in Deutschland.
Welche Problematik wird im Hinblick auf die Kategorisierung der Kunstbewegungen aufgeworfen?
Die Arbeit kritisiert die Schwierigkeiten, den Abstrakten Expressionismus, den Tachismus und das Informel mit etablierten Kategorien zu erfassen. Sie argumentiert, dass diese Bezeichnungen eher behelfsmäßige Mittel darstellen und die stilistische Einheitlichkeit sowie die Abgrenzbarkeit dieser Begriffe fragwürdig sind. Die Notwendigkeit, neue, umfassendere Kategorien zu entwickeln, wird diskutiert.
Wie wird der Einfluss gesellschaftlicher Konzepte auf die Kunstproduktion untersucht?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Konzepte von Individualität auf die Künstler der „New York School“, unter anderem durch die Analyse der Rolle der Kunst in politischen Förderprogrammen und der Konstruktion der heroischen Individualität des Künstlers. Der Vergleich von individuellen Künstlerwegen im Kontext von Gruppenzugehörigkeit oder -ablehnung wird ebenfalls analysiert.
Welche Rolle spielen Künstlergruppen in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen Individualität und Gruppenzugehörigkeit. Sie analysiert, wie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe die individuelle künstlerische Entwicklung beeinflusst und wie Künstler gleichzeitig ihre Individualität innerhalb einer Gruppe behaupten oder eben ablehnen.
Wie wird die Rezeption der „New York School“ in Deutschland behandelt?
Die Arbeit erörtert die Rezeption der „New York School“ in Deutschland und deren Einfluss auf die Entwicklung des Informel. Dabei werden Parallelen und Unterschiede in den geistigen Klimata und Einflüssen beider Kunstbewegungen herausgearbeitet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was sind deren Schwerpunkte?
Die Arbeit umfasst vier Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Problematik der Kategorien, Kapitel 2 die „New York School“, Kapitel 3 die Entwicklung des Informel in Deutschland nach 1945, und Kapitel 4 ein Fazit. Jedes Kapitel fokussiert auf spezifische Aspekte der Konstruktion von Individualität im Kontext der jeweiligen Kunstbewegung und des gesellschaftlichen Umfelds.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Abstrakter Expressionismus, Tachismus, Informel, New York School, Individualität, Gruppe, Künstlergruppe, gesellschaftliche Konzepte, Kunst und Politik, kultureller Kontext, Amerika, Deutschland, Malerei, Selbst-Expression.
- Quote paper
- Jennifer Kunstreich (Author), 2005, Abstrakter Expressionismus/Informel: Individuum und Gruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41027