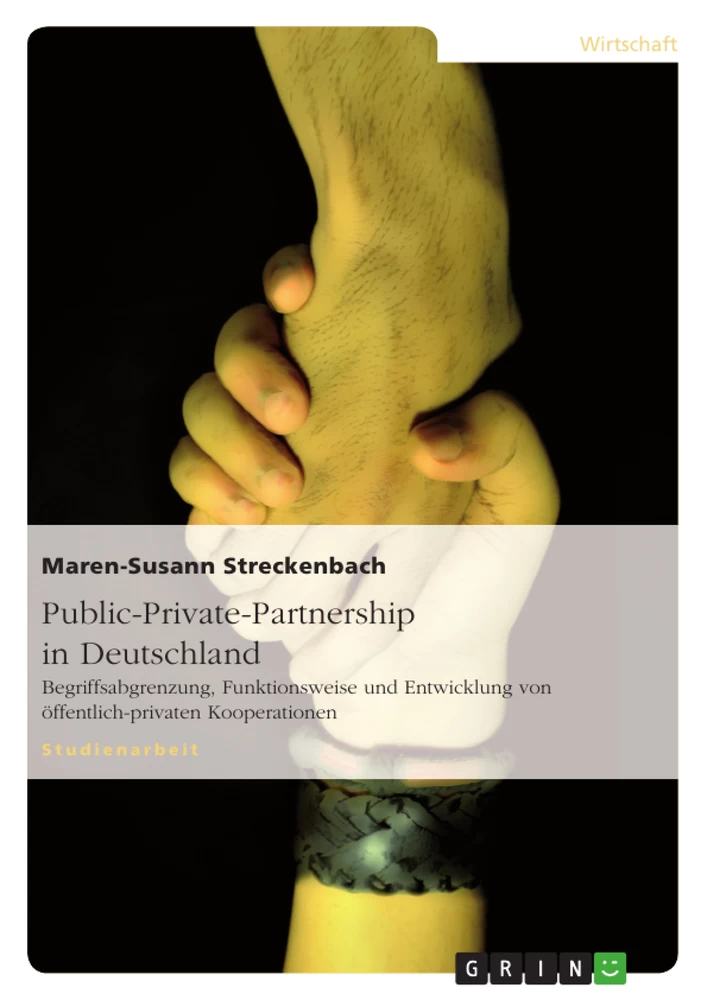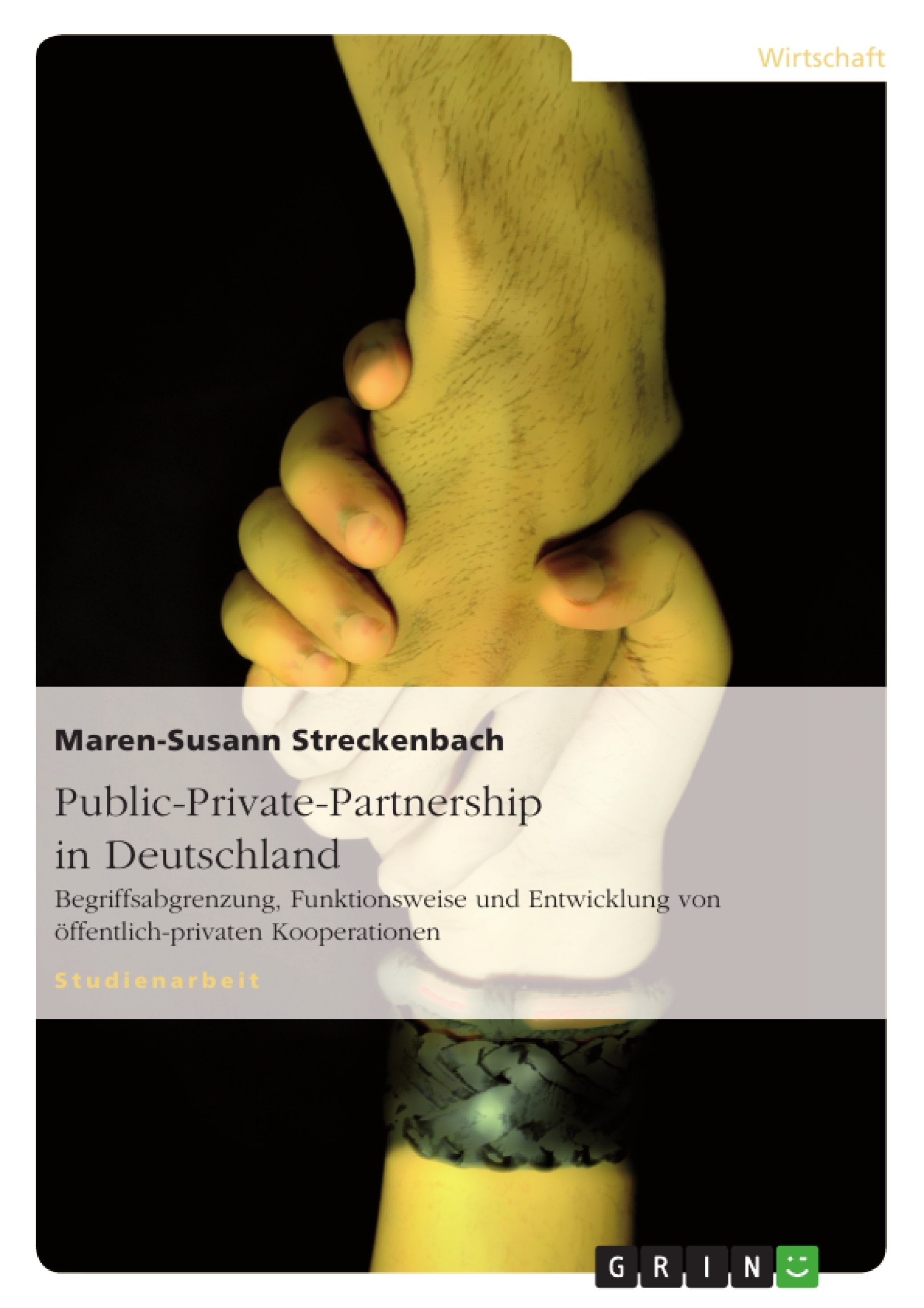Wachsende Haushalts- und Liquiditätsengpässe stellen die herkömmliche Art der öffentlichen Aufgabenerfüllung in Frage. Außerdem führt die angespannte Finanzlage zu erheblichen Einschränkungen der Investitionstätigkeiten, wodurch die Stabilität des privaten Sektors gefährdet wird.
Der Optimierung der öffentlichen Aufgaben und der daraus resultierenden Ausgaben kommt somit eine stetig wachsende Bedeutung zu. Es gilt, sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor, Alternativen zur herkömmlichen Finanzierung und Umsetzung von kurz- und vor allem langfristigen Projekten zu finden, ohne eine überzogene Entstaatlichung zu praktizieren.
Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Arbeit einen Einblick in die Thematik des „Public-Private-Partnership“ (PPP) als Kooperationsform zwischen der öffentlichen Hand einerseits, sowie erwerbswirtschaftlichen und gemeinnützigen Unternehmen andererseits geben.
Im ersten Teil wird vorab auf die angloamerikanische Rezeption des Begriffs „Public-Private-Partnership“ eingegangen, um die Ursprünge der Begriffsbildung und Ausgestaltung dieser Kooperationsform darzustellen. Darauf aufbauend folgt die deutsche Rezeption im weiten sowie im engen Sinne. Eine Begriffsabgrenzung gegenüber anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor wie dem Sponsoring oder auch Betreibermodellen schließt diesen Teil ab.
Im zweiten Abschnitt wird die Funktionsweise von PPP vorgestellt. Hierzu zählt zum einen die Betrachtung der Funktionsfähigkeit einer PPP als Indikator unter Berücksichtigung externer und interner Rahmenbedingungen. Zum anderen werden aus der Zusammenarbeit resultierende Synergieeffekte sowie konkrete Handlungs- und Anwendungsfelder vorgestellt.
Der dritte Teil beleuchtet die geschichtliche und funktionale Entwicklung von Public-Private-Partnership in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis hin zu aktuellen Beispielen aus dem Bereich des E-Governments.
Die Schlußbetrachtung fasst die gewonnen Erkenntnisse zusammen und stellt dabei die Dynamik dieses Kooperationsmodelles in den Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Public-Private-Partnership: Definition und Abgrenzung
- 2.1 Angloamerikanische Begriffsrezeption
- 2.2 Deutsche Rezeption von „Public-Private-Partnership“
- 2.2.1 Public-Private-Partnership im weiten Sinne
- 2.2.2 Public-Private-Partnership im engen Sinne
- 2.3 Abgrenzung von Public-Private-Partnership gegenüber anderen Kooperationsformen
- 3 Funktionsweise von Public-Private-Partnership
- 3.1 Funktionsfähigkeit von Public-Private-Partnerships
- 3.1.1 Externe Rahmenbedingungen
- 3.1.2 Interne Rahmenbedingungen
- 3.2 Synergieeffekte
- 3.3 Handlungs- und Anwendungsfelder
- 3.1 Funktionsfähigkeit von Public-Private-Partnerships
- 4 Funktionale und geschichtliche Entwicklung von PPP in Deutschland
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Public-Private-Partnerships (PPPs) als Kooperationsmodell zwischen öffentlichem und privatem Sektor in Deutschland. Ziel ist es, den Begriff PPP zu definieren, seine Funktionsweise zu erläutern und seine geschichtliche Entwicklung in Deutschland nachzuzeichnen. Dabei werden sowohl die angloamerikanische als auch die deutsche Begriffsrezeption berücksichtigt.
- Definition und Abgrenzung von PPP im Vergleich zu anderen Kooperationsformen
- Funktionsweise von PPPs, einschließlich der Faktoren, die ihre Funktionsfähigkeit beeinflussen
- Synergieeffekte und Anwendungsfelder von PPPs
- Historische Entwicklung von PPPs in Deutschland
- Vergleich der angloamerikanischen und deutschen Begriffsrezeption von PPPs
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Public-Private-Partnerships (PPPs) ein und begründet die Notwendigkeit alternativer Finanzierungs- und Umsetzungsmodelle für öffentliche Projekte angesichts wachsender Haushaltsengpässe und der damit verbundenen Einschränkungen der Investitionstätigkeit. Die Arbeit verspricht einen Einblick in die Definition, Funktionsweise und Entwicklung von PPPs in Deutschland, beginnend mit der angloamerikanischen Begriffsrezeption und gefolgt von einer Analyse der deutschen Begriffsabgrenzung und der Funktionsweise von PPPs, einschließlich Synergieeffekte und Anwendungsfelder. Schließlich wird die geschichtliche Entwicklung von PPPs in Deutschland beleuchtet.
2 Public-Private-Partnership: Definition und Abgrenzung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs „Public-Private-Partnership“. Es wird deutlich, dass es keine einheitliche Definition gibt, da sowohl im englischsprachigen Raum als auch in Deutschland unterschiedliche Verständnisse existieren. Das Kapitel analysiert die angloamerikanische Begriffsrezeption, die ihre Wurzeln im „New Deal“ der USA hat, und vergleicht diese mit der deutschen Rezeption. Es wird herausgestellt, dass PPPs vielgestaltig sind und nicht einfach als eine Art der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu beiderseitigem Nutzen definiert werden können. Der Unterschied zwischen PPPs im weiten und engen Sinne wird beleuchtet, und eine Abgrenzung zu anderen Kooperationsformen wird vorgenommen.
3 Funktionsweise von Public-Private-Partnership: Dieses Kapitel untersucht die Funktionsweise von Public-Private-Partnerships. Es analysiert die interne und externe Rahmenbedingungen, die die Funktionsfähigkeit beeinflussen, und beschreibt die resultierenden Synergieeffekte. Die Bedeutung von Synergien, also der gemeinschaftlichen Wert- und Effizienzsteigerung durch die Kooperation von öffentlichem und privatem Sektor, wird betont. Konkrete Anwendungsbereiche von PPPs werden ebenfalls vorgestellt, um die Vielseitigkeit und den praktischen Einsatz dieser Kooperationsform zu illustrieren.
4 Funktionale und geschichtliche Entwicklung von PPP in Deutschland: Das Kapitel beschreibt die funktionale und geschichtliche Entwicklung von Public-Private-Partnerships in Deutschland. Es zeichnet die Entwicklung von PPPs nach und analysiert die Faktoren, die zu ihrer Verbreitung und Veränderung beigetragen haben. Der Fokus liegt auf der Darstellung der jüngsten Entwicklungen und Tendenzen im Bereich von PPPs, um ein aktuelles Bild dieser Kooperationsform zu geben.
Schlüsselwörter
Public-Private-Partnership, PPP, öffentlich-private Partnerschaft, Kooperationsformen, Finanzierungsmodelle, öffentliche Aufgaben, privater Sektor, Synergieeffekte, Haushaltsengpässe, angloamerikanische Rezeption, deutsche Rezeption, Funktionsfähigkeit, Entwicklung in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zu: Public-Private-Partnerships in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit Public-Private-Partnerships (PPPs) in Deutschland. Sie definiert den Begriff, untersucht seine Funktionsweise, verfolgt seine historische Entwicklung und vergleicht die angloamerikanische und deutsche Begriffsrezeption.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, PPPs als Kooperationsmodell zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu definieren, ihre Funktionsweise zu erläutern und ihre Entwicklung in Deutschland nachzuzeichnen. Dabei wird auch der Vergleich der angloamerikanischen und deutschen Begriffsauffassung berücksichtigt.
Wie wird der Begriff "Public-Private-Partnership" definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit zeigt, dass es keine einheitliche Definition von PPPs gibt. Sie analysiert die angloamerikanische und die deutsche Begriffsrezeption, unterscheidet zwischen PPPs im weiten und engen Sinne und grenzt PPPs von anderen Kooperationsformen ab. Die unterschiedlichen Interpretationen im englischsprachigen Raum und in Deutschland werden herausgestellt.
Wie funktioniert ein Public-Private-Partnership?
Das Kapitel zur Funktionsweise von PPPs beleuchtet die internen und externen Rahmenbedingungen, die deren Erfolg beeinflussen. Es werden die entstehenden Synergieeffekte und konkrete Anwendungsbereiche von PPPs beschrieben, um deren Vielseitigkeit und praktischen Einsatz zu veranschaulichen.
Welche Rolle spielen Synergieeffekte bei PPPs?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Synergieeffekten – der gemeinschaftlichen Wert- und Effizienzsteigerung durch die Kooperation von öffentlichem und privatem Sektor – als zentralen Aspekt für den Erfolg von PPPs.
Welche Anwendungsfelder haben PPPs?
Die Arbeit nennt konkrete Anwendungsfelder von PPPs, um die Vielseitigkeit dieser Kooperationsform zu verdeutlichen. Diese Anwendungsbereiche sind jedoch nicht explizit aufgelistet.
Wie hat sich die Entwicklung von PPPs in Deutschland gestaltet?
Die Arbeit zeichnet die funktionale und geschichtliche Entwicklung von PPPs in Deutschland nach. Sie analysiert die Faktoren, die zu ihrer Verbreitung und Veränderung beigetragen haben, und konzentriert sich auf die jüngsten Entwicklungen und Trends.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Public-Private-Partnership, PPP, öffentlich-private Partnerschaft, Kooperationsformen, Finanzierungsmodelle, öffentliche Aufgaben, privater Sektor, Synergieeffekte, Haushaltsengpässe, angloamerikanische Rezeption, deutsche Rezeption, Funktionsfähigkeit, Entwicklung in Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und Abgrenzung von PPPs, ein Kapitel zur Funktionsweise von PPPs, ein Kapitel zur Entwicklung von PPPs in Deutschland und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlich beschrieben.
- Quote paper
- Dipl.-Ök. Maren-Susann Streckenbach (Author), 2005, Public-Private-Partnership in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41014