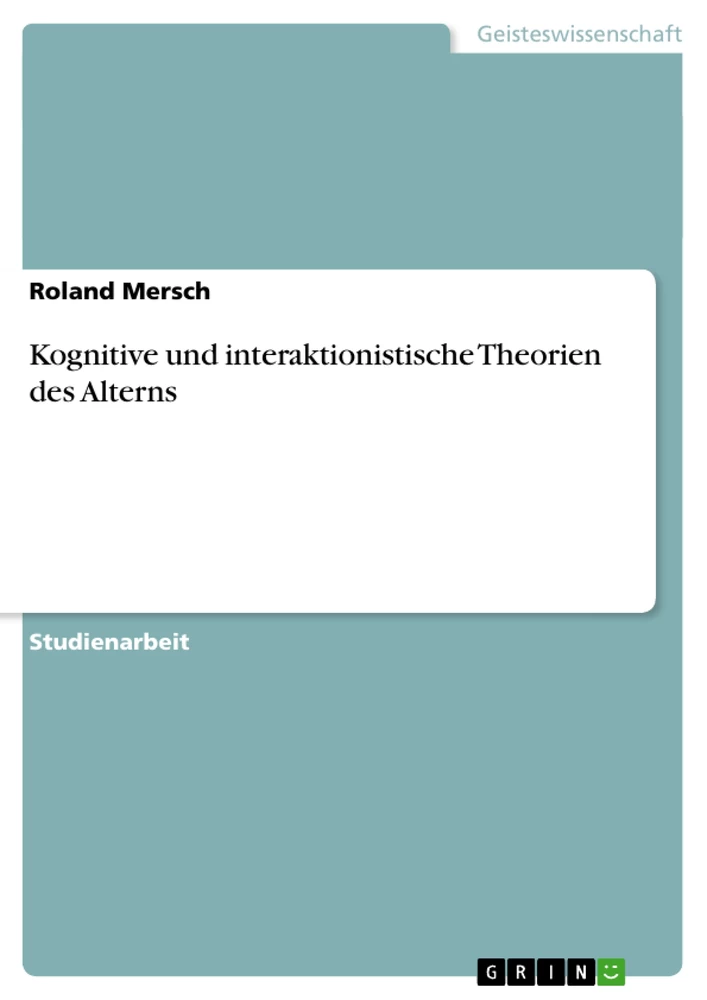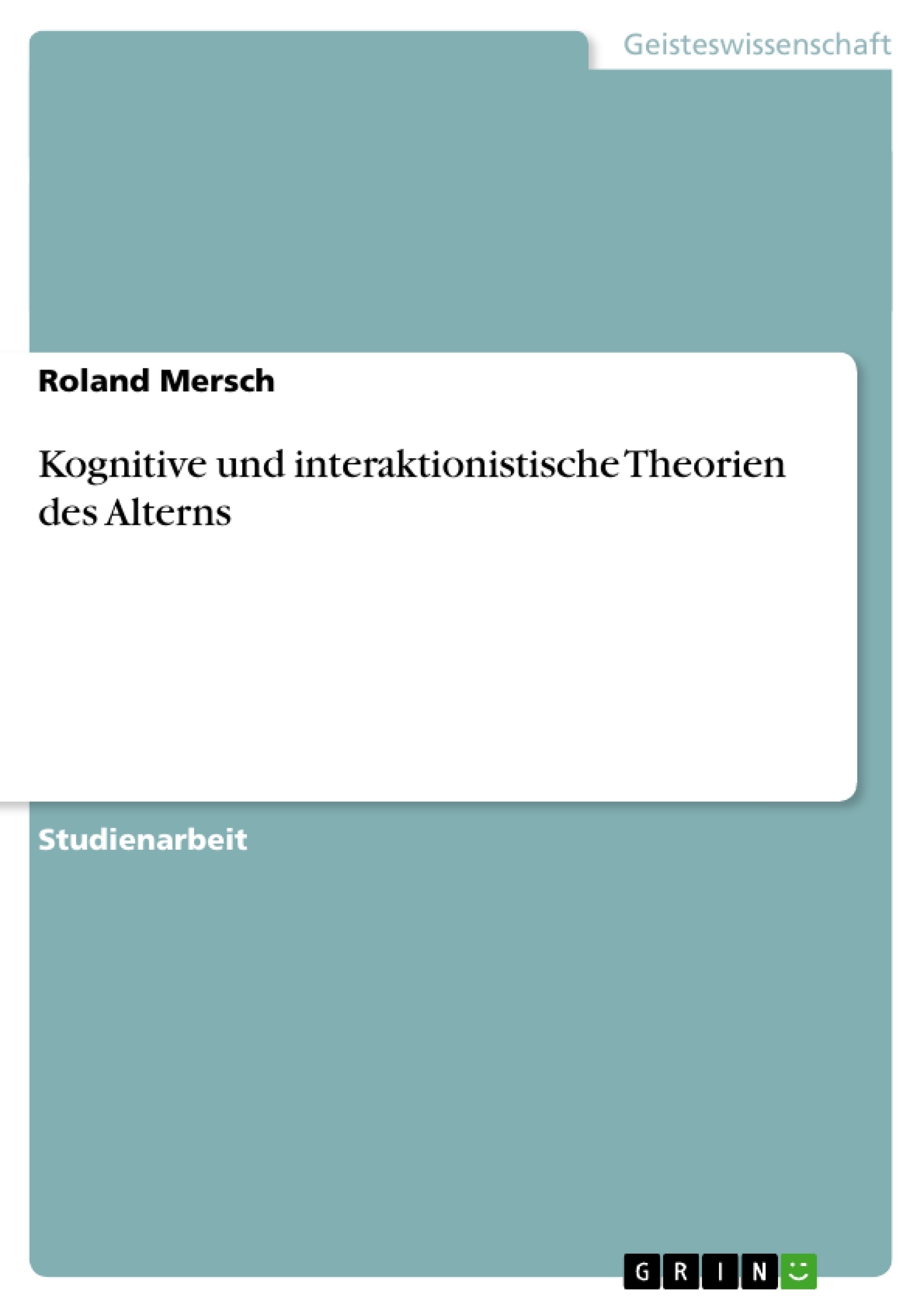Um die Besonderheit von kognitiven und interaktionistischen Theorien he rvorzuheben ist es zunächst sinnvoll, die Theorien von den bisher im Seminarverlauf besprochenen Theorien abzugrenzen. Die sogenannten „Theorie n des erfolgreichen Alterns“ wie die Disengagementtheorie 1 (Cumming/Henry 1961) als auch die Aktivitätstheorie 2 (Tartler 1961 u.a.m.) versuchten, allgemeingültige Merkmale des Alterns im sozial-psychologischen Kontext he rauszustellen. Die Gefahr bei solche n Theorie-Ansätzen besteht darin, dass sehr leicht Altersstereotype gebildet werden, die sich dann wie es gesellschaftlich bis heute noch der Fall ist, in vielen Köpfen manifestieren. Verstärkt wurde dieser Effekt der Stereotypenbildung sicherlich durch empirische Befunde, die fälschlicherweise ein sehr defizitorientiertes Altersbild hinterlassen haben. Der Versuch, allgemeingültige Aussagen über ein erfolgreiches Altern treffen zu können, wurde schließlich noch einmal in der Kontinuitätstheorie 3 (Atchley 1989) verwirklicht, die eine Art Synthese der Aktivitätsund Disengagementtheorie darstellt. Das neue an dieser Theorie war, dass sie den individuellen Lebenslauf stärker berücksichtigt, insofern, als dass sie die Fortführung des bisherigen Lebensstils, ob aktiv oder eher passiv, als Bedingung für erfolgreiches Altern voraussetzt. Neben den besagten Alternstheorien, wurden entwicklungspsychologische Theorien weiterentwickelt, die sich an dem psycho-sozialen Phasenmodell von E.H. Erikson (1950)4 orientieren. So hat schließlich R.J. Havighurst in seinem Konzept der Entwicklungsaufgaben5 gezielt auf soziale, kulturelle und individuelle Einflussfaktoren hingewiesen, aus deren Interaktion sich gewisse entwicklungsabhängige Aufgaben und Thematiken ergeben. Aus den vorangegangenen Schilderungen lässt sich bereits erkennen, dass in der Theoriebildung im Bezug auf das Leben im Alter immer mehr Aspekte und Einflussfaktoren berücksichtigt werden. [...] 1 vgl. Lehr, Ursula 2000: „Psychologie des Alterns“, S. 58 2 vgl. Lehr, Ursula 2000: „Psychologie des Alterns“, S. 56 3 vgl. Lehr, Ursula 2000: „Psychologie des Alterns“, S. 63 4 vgl. Lehr, Ursula 2000: „Psychologie des Alterns“, S. 52 5 vgl. Lehr, Ursula 2000: „Psychologie des Alterns“, S. 52/53
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE KOGNITIVE PERSÖNLICHKEITSTHEORIE VON HANS THOMAE
- GRUNDZÜGE UND BEGRIFFE DER KOGNITIVEN PERSÖNLICHKEITSTHEORIE
- DIE ZENTRALE BEDEUTUNG VON ÜBERZEUGUNGEN
- Mögliche Konsequenzen für den Umgang mit alten Menschen am Beispiel der Heimsituation
- ERLEBEN KÖRPERLICHER VERÄNDERUNGEN IM ALTER
- KOGNITIVE REPRÄSENTATION EINER PHYSISCHEN ERKRANKUNG
- THEMEN UND IHRE KOGNITIVE REPRÄSENTATION
- REAKTIONSFORMEN UND IHRE VERÄNDERUNG BEIM ÜBERGANG INS HÖHERE ALTER
- EIN INTERAKTIONISTISCHES MODELL DER BEDINGUNGEN VON LANGLEBIGKEIT
- ABSCHLIEBENDE WORTE ZUR ZIELSETZUNG VON KOGNITIVEN THEORIEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, kognitive und interaktionistische Theorien des Alterns vorzustellen und ihre Bedeutung für das Verständnis des Lebens im Alter aufzuzeigen. Dabei wird insbesondere auf die Persönlichkeitstheorie von Hans Thomae eingegangen und ein interaktionistisches Modell der Langlebigkeit erläutert.
- Kognitive Prozesse im Alter
- Die Rolle von Überzeugungen und Erwartungen
- Interaktionistische Ansätze des Alterns
- Einflussfaktoren auf die Lebensqualität im Alter
- Das Konzept der Langlebigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Arbeit in den Kontext der bisherigen Theorien des Alterns und hebt die Besonderheiten kognitiver und interaktionistischer Ansätze hervor.
- Kapitel 2 widmet sich der kognitiven Persönlichkeitstheorie von Hans Thomae. Es werden die Grundzüge dieser Theorie erläutert, insbesondere die Rolle von Schemata und Prototypen in der Informationsverarbeitung.
- Kapitel 3 fokussiert auf die zentrale Bedeutung von Überzeugungen und Erwartungen für den Umgang mit alten Menschen. Das Kapitel analysiert die möglichen Konsequenzen dieser Überzeugungen anhand der Heimsituation.
- Kapitel 4 befasst sich mit dem Erleben körperlicher Veränderungen im Alter und deren kognitiver Repräsentation.
- Kapitel 5 präsentiert ein interaktionistisches Modell der Bedingungen von Langlebigkeit, das die vielfältigen Einflussfaktoren auf das Alterungsprozess berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen kognitiver und interaktionistischer Theorien des Alterns, Persönlichkeitstheorie von Hans Thomae, Schemata, Prototypen, Überzeugungen, Erwartungen, Langlebigkeit, körperliche Veränderungen im Alter, interdisziplinäre Ansätze und Lebensqualität im Alter.
- Quote paper
- Roland Mersch (Author), 2002, Kognitive und interaktionistische Theorien des Alterns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40962