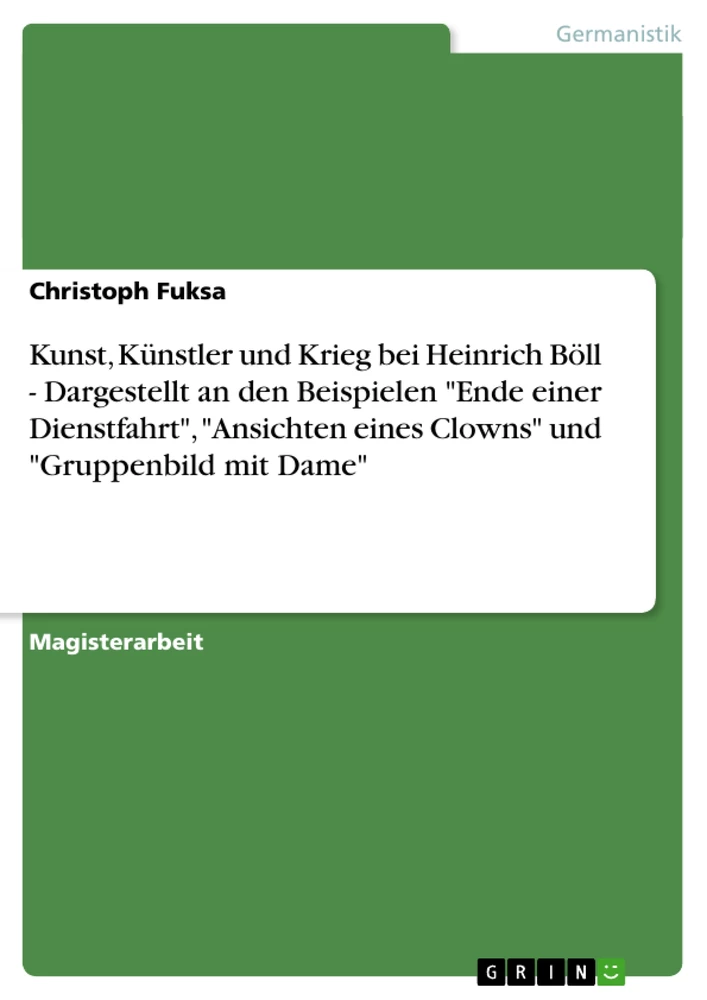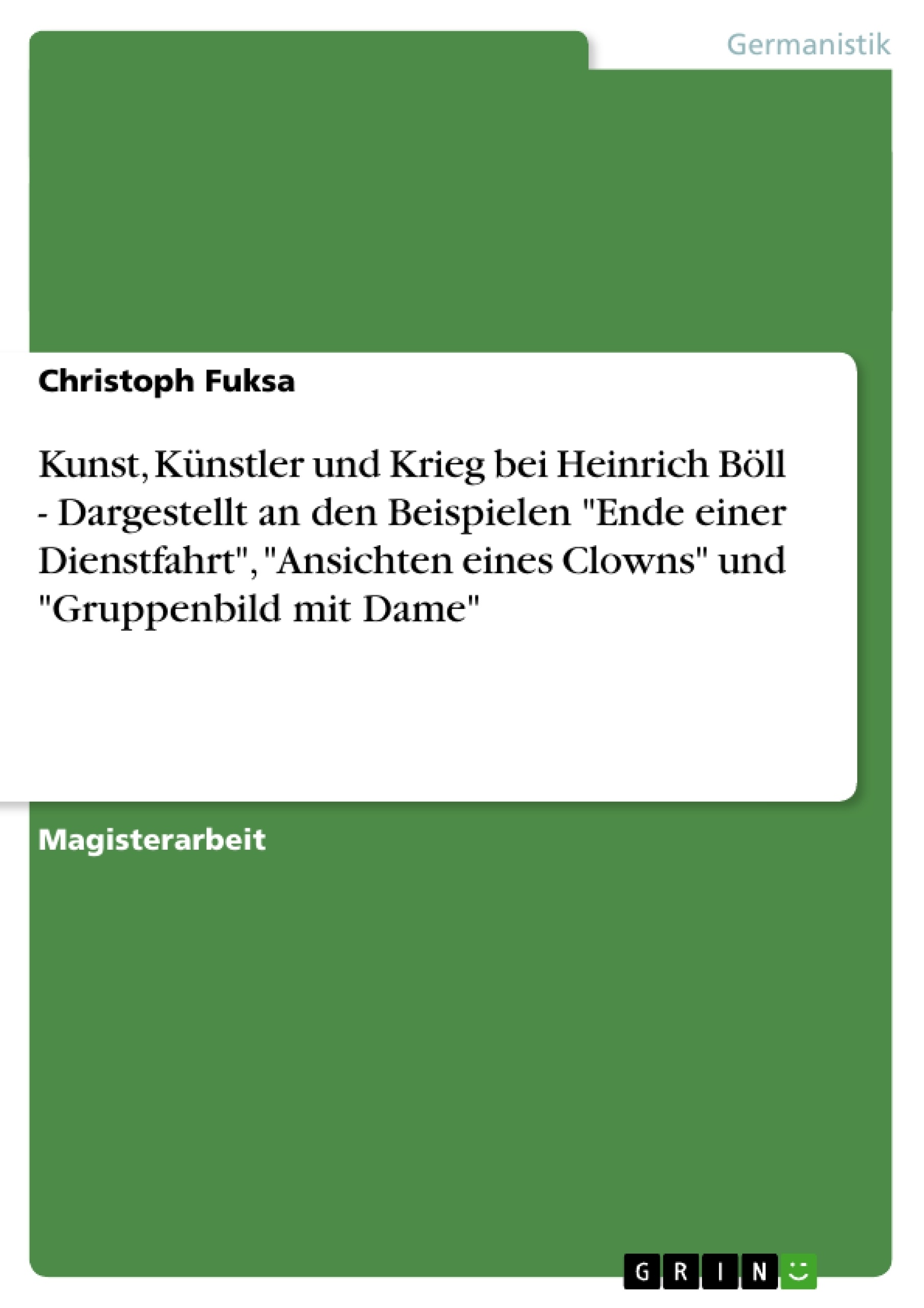Eine Untersuchung von Kunst, Künstler und Krieg in Ende einer Dienstfahrt, Ansichten eines Clowns und Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll, wie sie in dieser Arbeit erfolgt, beinhaltet die Analyse der textimmanenten Funktion und Definition der drei Themenbereiche unter expliziter Berücksichtigung der zwischenthematischen Verflechtungen. Hierbei ist zu beachten, dass gerade aufgrund der aufeinander in Bezug zu setzenden Begründungszusammenhänge von Kunst, Künstler und Krieg zunächst der Versuch einer strikten Abgrenzung eines jeden Themenbereichs notwendig sein muss, um eine adäquate Darstellung der in den Texten vorgegebenen Deutungsweisen der unterschiedlichen Ebenen einer funktionellen Betrachtung gewährleisten zu können.
Somit bietet die zunächst erfolgende Analyse der Funktionalität der Kunst in den drei Werken Bölls Anhaltspunkte dafür, die rahmenbildende und zum Teil -konstituierende Funktion von künstlerischen Werken und deren Urhebern in Gestalt realer, in dieser Arbeit als nicht fiktiv gekennzeichneter, Künstler, deren Namen jeweils emblematisch für das jeweilige Gesamt-, bzw. Teilwerk stehen, zu beleuchten.
In einem zweiten Schritt wird nun anhand der für die Texte und damit für diese Untersuchung relevanten Darstellung des Krieges in Form des zweiten Weltkrieges einerseits die Wechselwirkung mit dem damit einhergehenden Nationalsozialismus, der als ideologisch-totalitäres System den Einfluß eines unfreiheitlichen Extremraumes in Gestalt des Krieges durch seine Wirkung auf die privaten Innenräume verstärkt und innerhalb dieser die ideologischen Polarisierungen expliziert, andererseits die Zerstörung der gesellschaftlichen Strukturen durch den Krieg, verbunden mit einem Ausblick auf vermeintliche moralische Aufgaben und ästhetische Chancen durch die Möglichkeit zu einer neuen Definition nach dem Krieg, analysiert.
Da der Künstler, bzw. die als künstlerisch dargestellten Figuren, notwendigerweise aus einem als allgemeingültig erachteten Regelsystem entstammen muss, kann daraufhin auf diejenigen strukturellen Handlungsmotivationen eingegangen werden, die erklären können, warum und auf welche Weise die Künstler in eben dieser Eigenschaft agieren und fungieren. Hierbei lassen sich die meisten Begründungszusammenhänge in Bezug auf die anderen beiden Themenbereiche vermuten, womit erklärt ist, dass gerade die Strukturierung der Funktionalität in diesem Bereich im Vordergrund stehen muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. KUNST
- 2. 1. Kunst/Kunstwerk - Einleitung - fiction/Non-fiction.
- 2. 2. Kunst für alle vs. für Individuen - nicht fiktive Kunst.
- 2. 2. 1. materielle gesellschaftliche Differenzierung durch nicht fiktive Kunst
- 2. 2. 2. Diskussion über Kunst - Wissen über Kunst als Bildung
- 2. 3. Moralisch-ästhetische Kategorisierung nicht fiktiver Kunst
- 2. 3. 1. Kategorien - Funktion der Intertextualität.
- 2. 3. 2. Semantisierung durch Kanonisierung.
- 2. 4. Kanonisierung: Brecht, Trakl, Hölderlin, Kafka & Co.
- 2. 4. 1. Tolstoi als metaphysische Kulturkritik
- 2. 4. 2. Nicht fiktive Kunst als handlungskonstituierendes Element
- 2. 4. 2. 1. Kafka als sentimentale/gesellschaftlich-ideologische Semantisierung..
- 2. 4. 2. 2. Kleist als geistige und handlungskonsituierende Instanz oder Exkurs über Kunst und Künstler
- 2. 4. 2. 3. Das Nibelungenlied als Verflechtung von Liebe, Leid, Bestimmung und Realität.
- 2. 4. 2. 4. Trakl als ideologische Kulturkritik oder Exkurs über Kunst, Künstler und Krieg.
- 2. 4. 2. 5. „Lenis Liedcollagen“: Trakl, Brecht, Hölderlin
- 2. 4. 3.,,Vorliebe für Irland“ und romantische Musik als sentimentaler Start in eine existenziell-transzendentale Semantisierung.
- 2. 4. 3. 1. Proust vs. Joyce
- 2. 5.,,Symbolllik“ als Literatur in der dargestellten Wirklichkeit.
- 2. 6. Schnittstelle zwischen nicht fiktiver und fiktiver Kunst: Reaktionen auf Kunst
- 2. 7. Ästhetik der Philosophien.
- 2. 7. 1. Hegel Text als Kunst.
- 2. 7. 2. Schopenhauer - Text und Musik.
- 2. 7. 3. Film und Geschmack
- 2. 8. fiktive Kunst
- 2. 8. 1. „Ich bin kein Exeget“ - Ansichten eines Clowns
- 2. 8. 2. Das Happening - Ende einer Dienstfahrt
- 2. 8. 3. Schnittstelle Gutachter
- 2. 8. 4. Die innere Befindlichkeit - Gruppenbild mit Dame
- 3. KRIEG ALS POLITISCH-IDEOLOGISCHER UND MORALISCH-UNFREIHEITLICHER EXTREMRAUM.
- 3. 1. Darstellung.
- 3. 1. 1. Institutionen des Regimes...
- 3. 2. innenpolitische Situation im Nationalsozialismus als nicht fiktiver Rahmen
- 3. 3. Räume im Nationalsozialismus
- 3. 3. 1. Gesellschaftliche Räume - geschlossen oder nicht
- 3. 3. 2. Aktive/passive Öffnung geschlossener Räume führt zum Tod
- 3. 4. Passive vs. aktive Vermischung von Innen- und Außenraum
- 3. 4. 1. Aktive Öffnung als materieller Opportunismus
- 3. 4. 2. materieller und emotionaler Opportunismus
- 3. 4. 3. Integration des Nationalsozialismus in den Innenraum
- 3. 5. Kirche zwischen Krieg und Nicht-Krieg als unveränderter Raum
- 3. 6. Kriegsende als Chaos - der Anfangspunkt aller Kausalitäten
- 3. 7. Kunst im Krieg
- 3. 8. Nachkriegszeit: Sensibilität vs. Materialismus - zu neuer Definition eigener Innenräume - Die ,,Stunde Null"
- 3. 9. Bundeswehr als Nachfolger der Wehrmacht
- 4. KÜNSTLER
- 4. 1. Die Öffnung des Innenraumes als Anlaß für künstlerische Handlung.
- 4. 2. Versuch eines geschlossenen Raumes und semantischen Gleichgewichts.
- 4. 3. Stille.
- 4. 4. Künstler-Sein als Flucht - Kunst als Möglichkeit
- 4. 5. Nochmal Kleist und die Philosophen (Schönes - Wahres - Freiheit)
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verflechtungen von Kunst, Künstler und Krieg in Heinrich Bölls drei Werken "Ende einer Dienstfahrt", "Ansichten eines Clowns" und "Gruppenbild mit Dame". Der Fokus liegt auf der Analyse der textimmanenten Funktion und Definition dieser Themenbereiche, wobei die Wechselwirkungen zwischen ihnen besonders berücksichtigt werden.
- Die Rolle von Kunst und Künstlern im Krieg und die Folgen für die Gesellschaft.
- Die Darstellung von Krieg und Nationalsozialismus als Extremräume, die den privaten und gesellschaftlichen Lebensraum beeinflussen.
- Die Motivationen und Handlungsweisen von Künstlern im Kontext von Krieg und politischer Unterdrückung.
- Die Auseinandersetzung mit dem Konzept der "Freiheit der Kunst" und der Verantwortung von Künstlern im Krieg.
- Die Bedeutung der "Ästhetik des Humanen" in Bölls Werken und deren Verbindung zu Krieg, Kunst und Künstlern.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Funktion von Kunst in Bölls Werken und analysiert die Rolle von realen Künstlern, deren Namen emblematisch für die jeweiligen Kunstformen stehen. Die zweite Analyseebene betrachtet die künstlerischen Handlungen der Figuren und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung des Zweiten Weltkriegs und die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Gesellschaft. Es analysiert die Rolle des Krieges als unfreiheitlicher Extremraum und die Zerstörung gesellschaftlicher Strukturen, gepaart mit einem Ausblick auf die Herausforderungen und Möglichkeiten für eine neue Definition der Gesellschaft nach dem Krieg.
Im vierten Kapitel werden die strukturellen Handlungsmotivationen von Künstlern untersucht, um zu verstehen, warum und auf welche Weise sie in ihrer Rolle agieren. Der Fokus liegt dabei auf der Verflechtung der drei Themenbereiche und deren Einfluss auf die künstlerischen Handlungen.
Schlüsselwörter
Kunst, Künstler, Krieg, Nationalsozialismus, "Ende einer Dienstfahrt", "Ansichten eines Clowns", "Gruppenbild mit Dame", Heinrich Böll, Freiheit der Kunst, Ästhetik des Humanen, Gesellschaft, Totalitarismus, Extremraum, Handlungsmotivation, Kunstformen, Literatur, Musik.
- Quote paper
- M.A. Christoph Fuksa (Author), 2003, Kunst, Künstler und Krieg bei Heinrich Böll - Dargestellt an den Beispielen "Ende einer Dienstfahrt", "Ansichten eines Clowns" und "Gruppenbild mit Dame", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40789