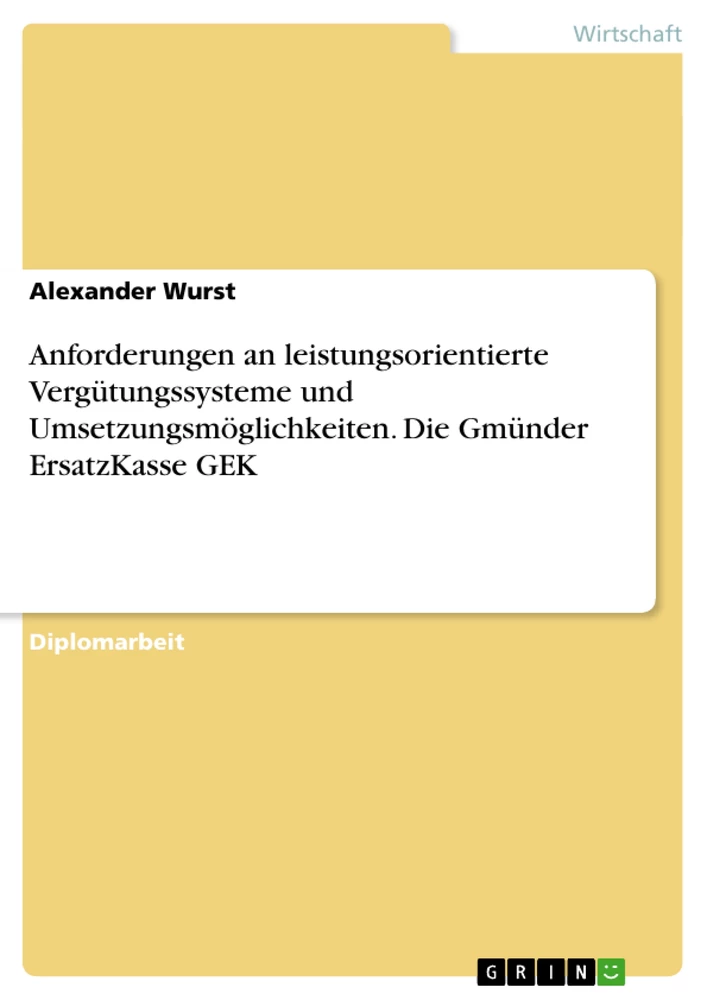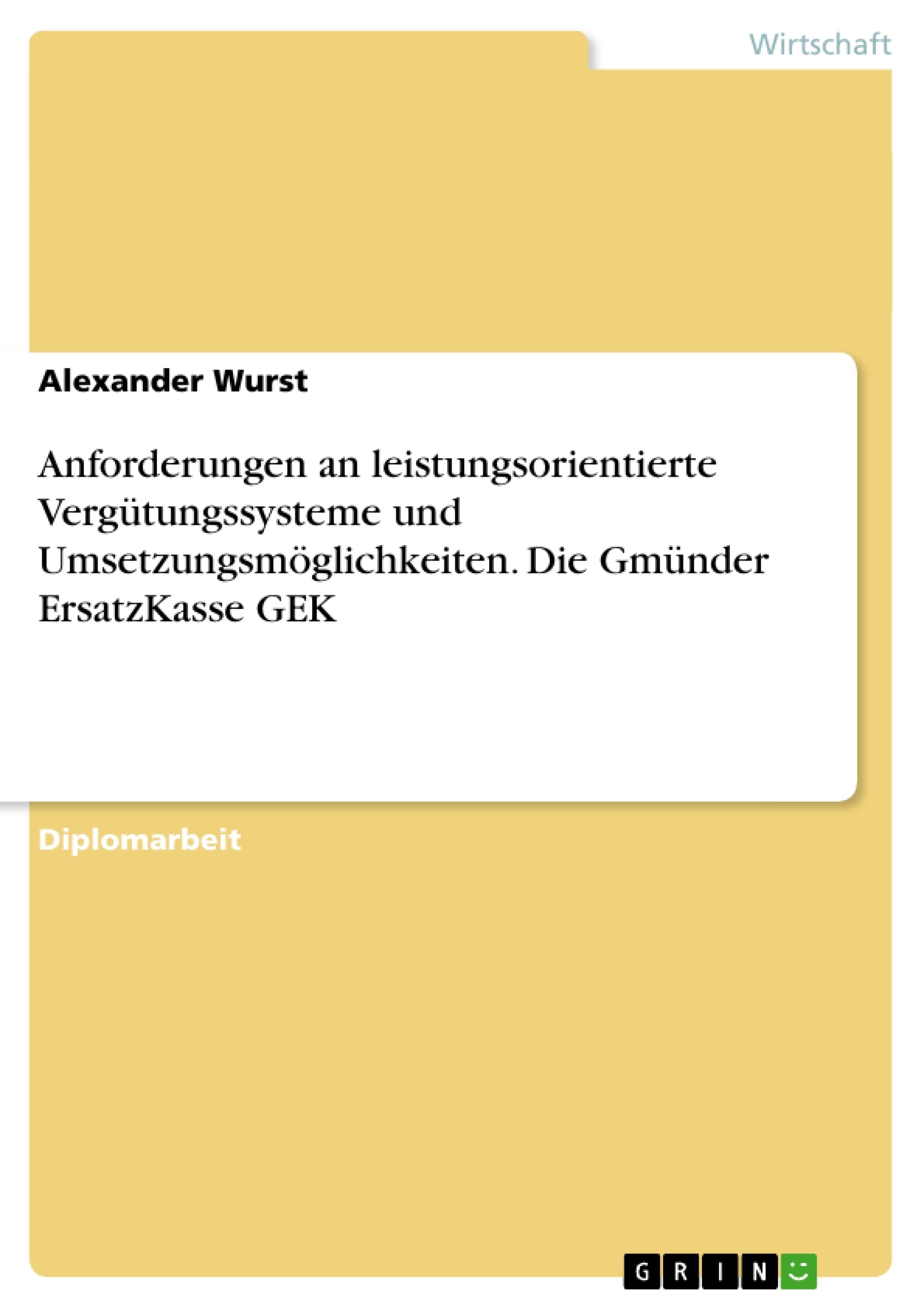Das bestehende Vergütungssystem bei der Gmünder Ersatzkasse (GEK) nach dem Ersatzkassen-Tarifvertrag (EKT) ist nicht mehr zeitgemäß. Durch die Entlohnung über einen Zeitlohn, bei dem es nur auf die Anwesenheit eines Mitarbeiters ankommt, besteht für die Mitarbeiter kein ausreichender Anreiz, gute Leistungen abzuliefern. Außerdem ist das jetzige Vergütungssystem nach dem Senioritätsprinzip organisiert. Das bedeutet, dass, unabhängig von der Leistungserbringung eines Mitarbeiters, das Gehalt mit seinem Alter stetig erhöht wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass einerseits junge Mitarbeiter, die gute Leistungen erbringen, keine angemessene Vergütung für ihre Leistungen erhalten. Andererseits bleiben schlechte Leistungen in der Bemessung der Vergütung unberücksichtigt. Es soll deshalb ein leistungsorientiertes Vergütungssystem eingeführt werden.
Ein solches System soll die Mitarbeiter dazu bewegen, sich im Sinne des Unternehmens zu verhalten und eine höhere Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen. Dadurch kann die Effizienz des Unternehmens gesteigert und damit die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Zudem soll eine gerechtere Vergütung erreicht werden, indem jeder Mitarbeiter die Möglichkeit haben soll, durch seine Leistung direkten Einfluss auf sein Gehalt zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Grundlagen leistungsorientierter Vergütungssysteme
- 2.1 Motivation menschlichen Verhaltens im Unternehmen
- 2.1.1 Grundlagen
- 2.1.2 Theorien
- 2.1.3 Motivation und Unternehmenskultur
- 2.2 Anreizsysteme und leistungsorientierte Vergütung
- 2.2.1 Anreiz und Motivation
- 2.2.2 Anreizklassifikation
- 2.2.3 Anreizwirkung von leistungsorientierter Vergütung
- 2.3 Bedeutung und Notwendigkeit leistungsorientierter Vergütung
- 2.3.1 Mängel traditioneller Systeme
- 2.3.2 Ziele von leistungsorientierter Vergütung
- 2.4 Anforderungen an ein leistungsorientiertes Vergütungssystem
- 3 Möglichkeiten für ein leistungsorientiertes Vergütungssystem
- 3.1 Anforderungsabhängige Komponente
- 3.2 Leitungsabhängige Komponente
- 3.2.1 Prämiensystem
- 3.2.2 Beurteilungsgestütztes Leistungsentgelt
- 3.2.3 Zielvereinbarungssystem
- 3.3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
- 3.4 Betriebliche Zusatzleistungen
- 4 Ausarbeitung eines adäquaten Vergütungssystems für die GEK
- 4.1 Ausgangssituation der GEK
- 4.1.1 Rechtliche Anforderungen
- 4.1.2 Anforderungen der GEK
- 4.2 Bestimmung des Systems für den leistungsbezogenen Vergütungsbestandteil
- 4.3 Spezifizierung der Vergütungskomponenten
- 4.3.1 Anforderungsabhängige Komponente
- 4.3.2 Leistungsabhängige Komponente
- 4.3.3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
- 4.3.4 Betriebliche Zusatzleistungen
- 4.4 Einführung
- 4.4.1 Notwendigkeit eines Pilotprojekts
- 4.4.2 Kommunikation als Voraussetzung für die Einführung
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Anforderungen an leistungsorientierte Vergütungssysteme und deren Umsetzungsmöglichkeiten, anhand des Beispiels der Gmünder Ersatzkasse (GEK). Ziel ist es, ein adäquates Vergütungssystem für die GEK zu entwickeln, welches die Motivation der Mitarbeiter steigert und gleichzeitig die Unternehmensziele unterstützt.
- Motivationstheorien und deren Anwendung im Unternehmenskontext
- Analyse bestehender leistungsorientierter Vergütungssysteme
- Entwicklung eines maßgeschneiderten Vergütungssystems für die GEK
- Einführungsstrategie und Herausforderungen bei der Implementierung
- Rechtliche Rahmenbedingungen für leistungsorientierte Vergütung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik leistungsorientierter Vergütungssysteme ein und beschreibt die Motivation und Zielsetzung der Arbeit. Es skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Untersuchung.
2 Grundlagen leistungsorientierter Vergütungssysteme: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse und Gestaltung eines leistungsorientierten Vergütungssystems. Es werden verschiedene Motivationstheorien erläutert und deren Relevanz für die Gestaltung von Anreizsystemen im Unternehmenskontext dargestellt. Die Bedeutung und Notwendigkeit leistungsorientierter Vergütung wird im Vergleich zu traditionellen Systemen herausgearbeitet, und es werden die Anforderungen an ein solches System definiert. Der Fokus liegt auf der Verbindung von individueller Mitarbeitermotivation und den übergeordneten Zielen des Unternehmens.
3 Möglichkeiten für ein leistungsorientiertes Vergütungssystem: Kapitel 3 präsentiert verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung leistungsorientierter Vergütungssysteme. Es werden unterschiedliche Komponenten wie anforderungsabhängige und leistungsabhängige Anteile, Prämiensysteme, Zielvereinbarungen, der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) und betriebliche Zusatzleistungen detailliert beschrieben. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden kritisch beleuchtet, um eine fundierte Grundlage für die spätere Auswahl eines geeigneten Systems für die GEK zu schaffen.
4 Ausarbeitung eines adäquaten Vergütungssystems für die GEK: Dieses Kapitel wendet die zuvor gewonnenen Erkenntnisse auf die konkrete Situation der GEK an. Es analysiert die Ausgangssituation, die rechtlichen Anforderungen und die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens. Auf dieser Basis wird ein passendes Vergütungssystem entwickelt, welches die einzelnen Komponenten (anforderungsabhängig, leistungsabhängig, KVP, Zusatzleistungen) detailliert spezifiziert. Die Herausforderungen bei der Einführung des Systems, insbesondere die Notwendigkeit eines Pilotprojekts und die Wichtigkeit der Kommunikation, werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Leistungsorientierte Vergütung, Motivation, Anreizsysteme, Gmünder Ersatzkasse (GEK), Mitarbeitermotivation, Zielvereinbarung, Prämiensystem, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), betriebliche Zusatzleistungen, Rechtliche Anforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Diplomarbeit: Leistungsorientierte Vergütungssysteme in der GEK
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Anforderungen an leistungsorientierte Vergütungssysteme und deren Umsetzung anhand der Gmünder Ersatzkasse (GEK). Das Hauptziel ist die Entwicklung eines adäquaten Vergütungssystems für die GEK, das die Mitarbeitermotivation steigert und die Unternehmensziele unterstützt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst verschiedene Themenbereiche, darunter Motivationstheorien und deren Anwendung im Unternehmenskontext, die Analyse bestehender leistungsorientierter Vergütungssysteme, die Entwicklung eines maßgeschneiderten Systems für die GEK, eine detaillierte Einführungsstrategie mit den damit verbundenen Herausforderungen und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen für leistungsorientierte Vergütung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen leistungsorientierter Vergütungssysteme, Möglichkeiten für ein leistungsorientiertes Vergütungssystem, Ausarbeitung eines adäquaten Vergütungssystems für die GEK und Fazit. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten der Thematik, beginnend mit der theoretischen Fundierung über die Analyse verschiedener Systeme bis hin zur konkreten Anwendung auf die GEK.
Welche Motivationstheorien werden behandelt?
Die Arbeit erläutert verschiedene Motivationstheorien, die für die Gestaltung von Anreizsystemen im Unternehmenskontext relevant sind. Diese Theorien dienen als Grundlage für die Analyse und Entwicklung des Vergütungssystems für die GEK.
Welche Arten von leistungsorientierten Vergütungssystemen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Komponenten leistungsorientierter Vergütungssysteme, wie anforderungsabhängige und leistungsabhängige Anteile, Prämiensysteme, Zielvereinbarungen, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) und betriebliche Zusatzleistungen. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze werden kritisch bewertet.
Wie wird das Vergütungssystem für die GEK entwickelt?
Das Vergütungssystem für die GEK wird in mehreren Schritten entwickelt: Zunächst wird die Ausgangssituation der GEK analysiert, inklusive der rechtlichen Anforderungen und der spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens. Auf dieser Basis werden die einzelnen Komponenten des Systems (anforderungsabhängig, leistungsabhängig, KVP, Zusatzleistungen) detailliert spezifiziert. Die Herausforderungen der Einführung, insbesondere die Notwendigkeit eines Pilotprojekts und die Bedeutung der Kommunikation, werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Kommunikation bei der Einführung des neuen Vergütungssystems?
Die Kommunikation spielt eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Einführung des neuen Vergütungssystems. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer klaren und transparenten Kommunikation mit den Mitarbeitern, um Akzeptanz und Unterstützung zu gewährleisten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Leistungsorientierte Vergütung, Motivation, Anreizsysteme, Gmünder Ersatzkasse (GEK), Mitarbeitermotivation, Zielvereinbarung, Prämiensystem, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP), betriebliche Zusatzleistungen und Rechtliche Anforderungen.
- Arbeit zitieren
- Alexander Wurst (Autor:in), 2005, Anforderungen an leistungsorientierte Vergütungssysteme und Umsetzungsmöglichkeiten. Die Gmünder ErsatzKasse GEK, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40779