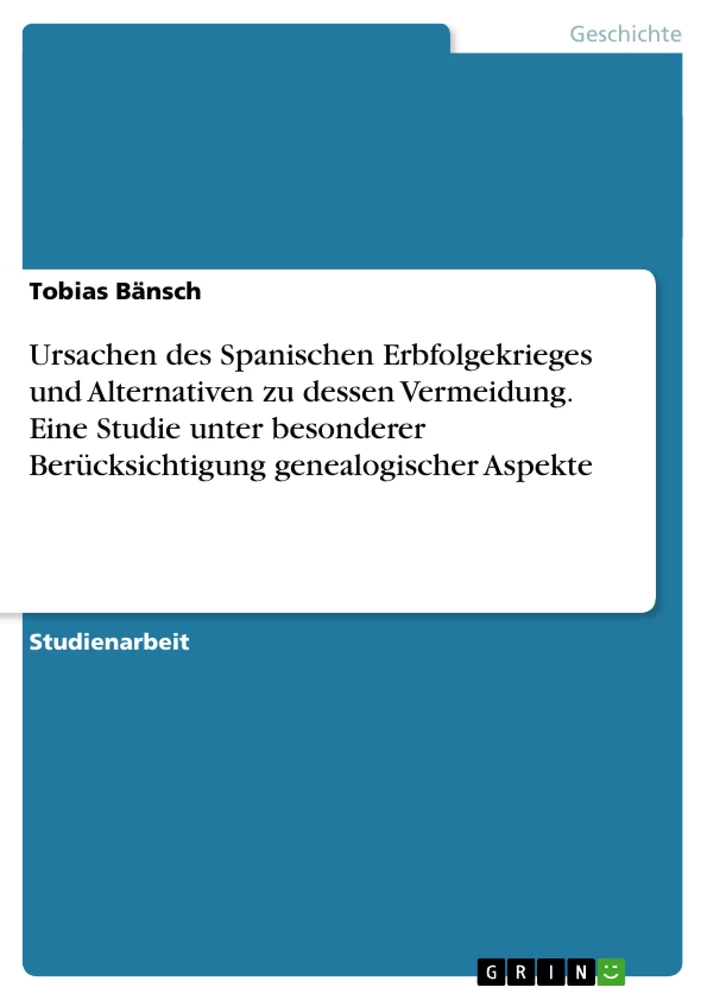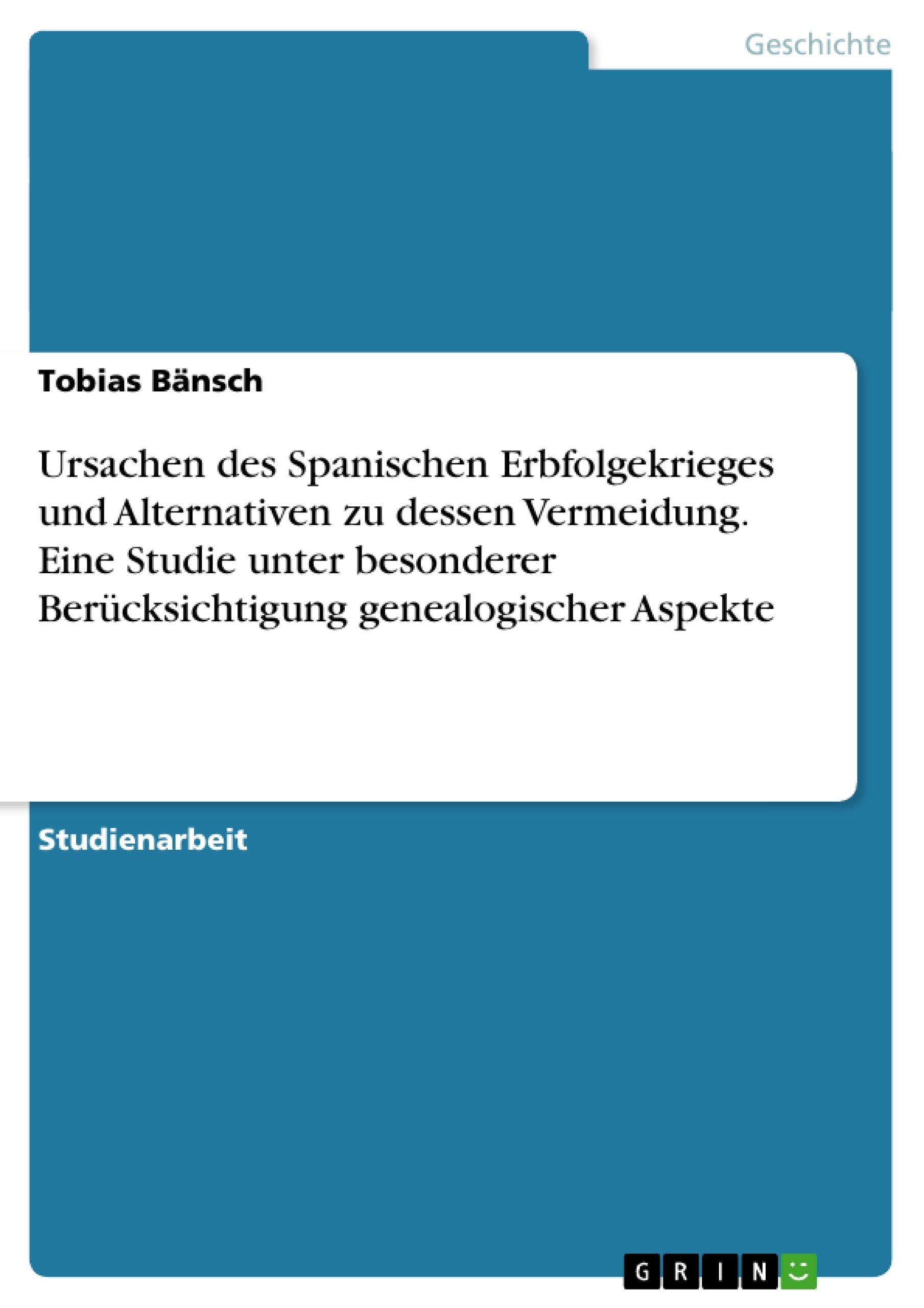[...] Durch das Testament des spanischen Habsburger-Königs Karl II., der kinderlos am 01.11.1700 starb, wurde seinem Schwager Ludwig die Entscheidung überlassen, ob dessen Enkel oder der zweite Sohn von Karls österreichischem Schwager Kaiser Leopold I., Erzherzog Karl aus der jüngeren Habsburger Linie, den vakanten Madrider Thron besteigen sollte. In kontroversen Unterredungen mit seinen Beratern rang sich Ludwig schließlich zur Annahme des letzten Willens Karls zugunsten seines Enkels Philipp durch, was der Kaiser aufgrund der zu befürchtenden Supermacht Frankreich-Spanien weder tolerieren, noch akzeptieren konnte und worauf er 1701 mit dem Einmarsch Eugen von Savoyens in Italien den Krieg begann und in der Haager Allianz Verbündete gewann. Nach langwierigem, verlustreichem und wechselvollem Kriegsgeschehen standen am Ende der Regierungszeit Ludwigs XIV. die Frieden von Utrecht 1713 und Rastatt 1714, die den Spanischen Erbfolgekrieg beendeten und Philipp von Anjou als Philipp V. bestätigten. Ludwig hatte nicht nur seinen Rivalen Leopold überlebt, sondern auch sein wichtigstes Kriegsziel erreicht, allerdings zu einem immens hohen Preis - einem Frankreich, das den Tod des Sonnenkönigs 1715 nicht besiegt, jedoch ökonomisch am Boden erlebte. Die Frage, ob der kriegsmüde Monarch Ludwig diesen seinen letzten großen Konflikt hätte vermeiden können oder ob die Eskalation des Erbstreits zur militärischen Auseinandersetzung unabwendbar geworden war, beschäftigt und fasziniert die historische Forschung schon seit langem. Zudem ist die spanische Frage während der gesamten eigenständigen Regierungszeit des „Sonnenkönigs“ Problem und Leitfaden seiner Außenpolitik gewesen, was ihr eine Dimension verleiht, die es mehr als reizvoll macht, sie mit einer friedensbewahrenden theoretischen Lösung zu beantworten. Das Ziel dieser Hausarbeit ist es deshalb zum einen, die tieferliegenden Ursachen des Erbfolgekrieges darzulegen und zum anderen, eigene Konzepte zur Themenstellung zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf genealogischen Möglichkeiten liegen soll. Um dieses Vorhaben zu erreichen, werde ich zunächst die Grundproblematik vor 1697 analysieren, sodann die Zeitspanne bis Kriegsausbruch besprechen und anschließend vor allem erbrechtliche Eventualitäten erörtern, um im Fazit alle realistischen Alternativmodelle konzentriert wiederzugeben bzw. endgültig die Unvermeidbarkeit dieses Konflikts zu konstatieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die spanische Frage vor 1697
- 3. Letzte Bemühungen für den Frieden
- 3.1 Die Teilungsverträge
- 3.2 Das entscheidende Testament Karls II.
- 4. Alternativkonzepte
- 4.1 Genealogische Möglichkeiten
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen des Spanischen Erbfolgekrieges und erörtert mögliche Alternativen zur Vermeidung des Konflikts. Der Schwerpunkt liegt dabei auf genealogischen Aspekten und erbrechtlichen Eventualitäten. Die Arbeit analysiert die Vorgeschichte des Krieges, insbesondere die „spanische Frage“ vor 1697, und beleuchtet die letzten Bemühungen um eine friedliche Regelung der Nachfolge Karls II. von Spanien.
- Die „spanische Frage“ als zentrales Thema der europäischen Außenpolitik im Zeitalter Ludwigs XIV.
- Analyse der erbrechtlichen Komplexitäten und der Rolle genealogischer Faktoren.
- Bewertung der verschiedenen diplomatischen Versuche, den Konflikt zu vermeiden.
- Entwicklung und Erörterung von Alternativkonzepten zur Lösung des Erbstreits.
- Bewertung der Unvermeidbarkeit des Konflikts.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Spanischen Erbfolgekrieg als zentralen europäischen Konflikt dar und thematisiert die Entscheidung Ludwigs XIV. bezüglich der spanischen Thronfolge. Sie führt die Problematik ein und benennt das Ziel der Arbeit: die Darstellung der Ursachen des Krieges und die Entwicklung von Alternativkonzepten unter besonderer Berücksichtigung genealogischer Aspekte. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Grundproblematik vor 1697, die Zeit bis zum Kriegsausbruch und die Erörterung erbrechtlicher Eventualitäten umfasst.
2. Die spanische Frage vor 1697: Dieses Kapitel analysiert die Situation nach dem Frieden von Rijswijk (1697). Es stellt die Frage, warum trotz der Bemühungen um eine friedliche Regelung der spanischen Thronfolge der Krieg ausbrach. Es untersucht die lange Vorgeschichte der Problematik, beginnend mit der Heirat Ludwigs XIV. und Maria Theresias und den damit verbundenen Erbrechten. Das Kapitel beleuchtet Ludwigs Machtpolitik und den Devolutionskrieg als Ausdruck seines Bestrebens, die Ostgrenze Frankreichs zu sichern, und beschreibt den geheimen Vertrag zwischen Frankreich und Österreich zur Teilung der spanischen Monarchie im Falle des kinderlosen Todes Karls II.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der Spanische Erbfolgekrieg - Ursachen und Alternativen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursachen des Spanischen Erbfolgekriegs und beleuchtet mögliche Alternativen, um den Konflikt zu vermeiden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf genealogischen Aspekten und erbrechtlichen Eventualitäten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Vorgeschichte des Krieges, insbesondere die „spanische Frage“ vor 1697, und die letzten Bemühungen um eine friedliche Regelung der Nachfolge Karls II. von Spanien. Es werden die erbrechtlichen Komplexitäten, die Rolle genealogischer Faktoren, verschiedene diplomatische Versuche zur Konfliktvermeidung und mögliche Alternativkonzepte zur Lösung des Erbstreits untersucht. Die Unvermeidbarkeit des Konflikts wird ebenfalls bewertet.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Krieg und das Ziel der Arbeit dar. Kapitel 2 („Die spanische Frage vor 1697“) analysiert die Situation nach dem Frieden von Rijswijk und die Vorgeschichte der Problematik. Kapitel 3 (Letzte Bemühungen für den Frieden) konzentriert sich auf die Versuche einer friedlichen Regelung, einschließlich der Teilungsverträge und des Testaments Karls II. Kapitel 4 (Alternativkonzepte) erörtert alternative Lösungsansätze. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt die Genealogie in der Hausarbeit?
Genealogische Aspekte und erbrechtliche Eventualitäten bilden einen zentralen Schwerpunkt der Arbeit. Die Analyse der Familienverhältnisse und der damit verbundenen Erbrechte ist essentiell für das Verständnis der Ursachen des Konflikts und der Entwicklung von Alternativen.
Welche konkreten Aspekte der „spanischen Frage“ werden untersucht?
Die Hausarbeit analysiert die „spanische Frage“ als zentrales Thema der europäischen Außenpolitik im Zeitalter Ludwigs XIV., die Machtpolitik Ludwigs XIV., den Devolutionskrieg und die geheimen Verträge zur Teilung der spanischen Monarchie.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert die Grundproblematik vor 1697, die Zeit bis zum Kriegsausbruch und erbrechtliche Eventualitäten. Der methodische Ansatz ist in der Einleitung skizziert.
- Quote paper
- Tobias Bänsch (Author), 2002, Ursachen des Spanischen Erbfolgekrieges und Alternativen zu dessen Vermeidung. Eine Studie unter besonderer Berücksichtigung genealogischer Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40660