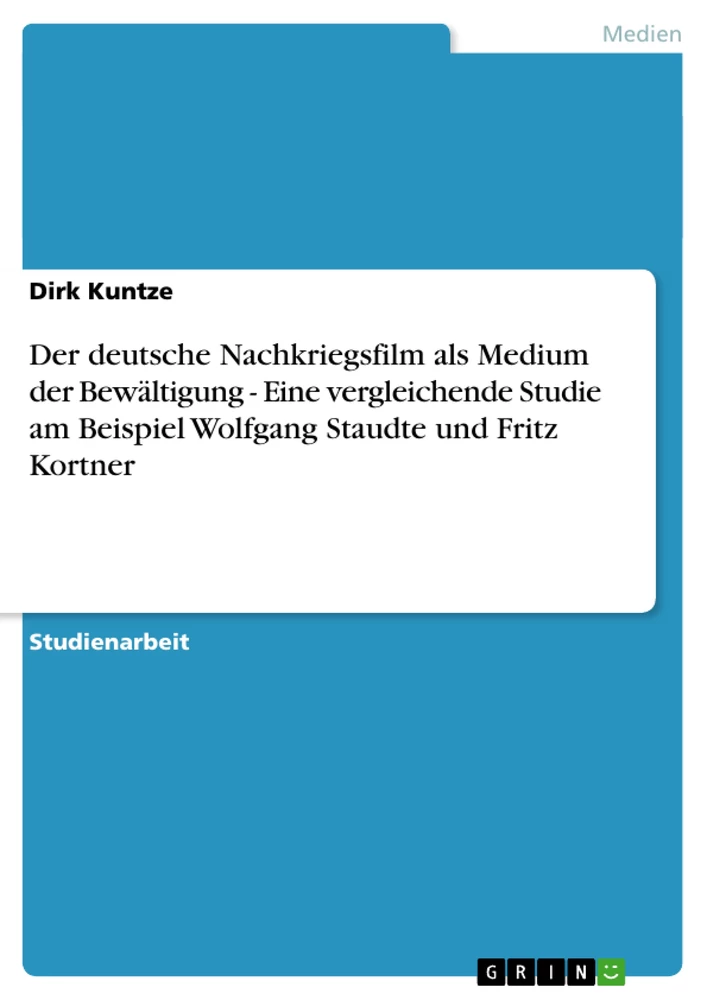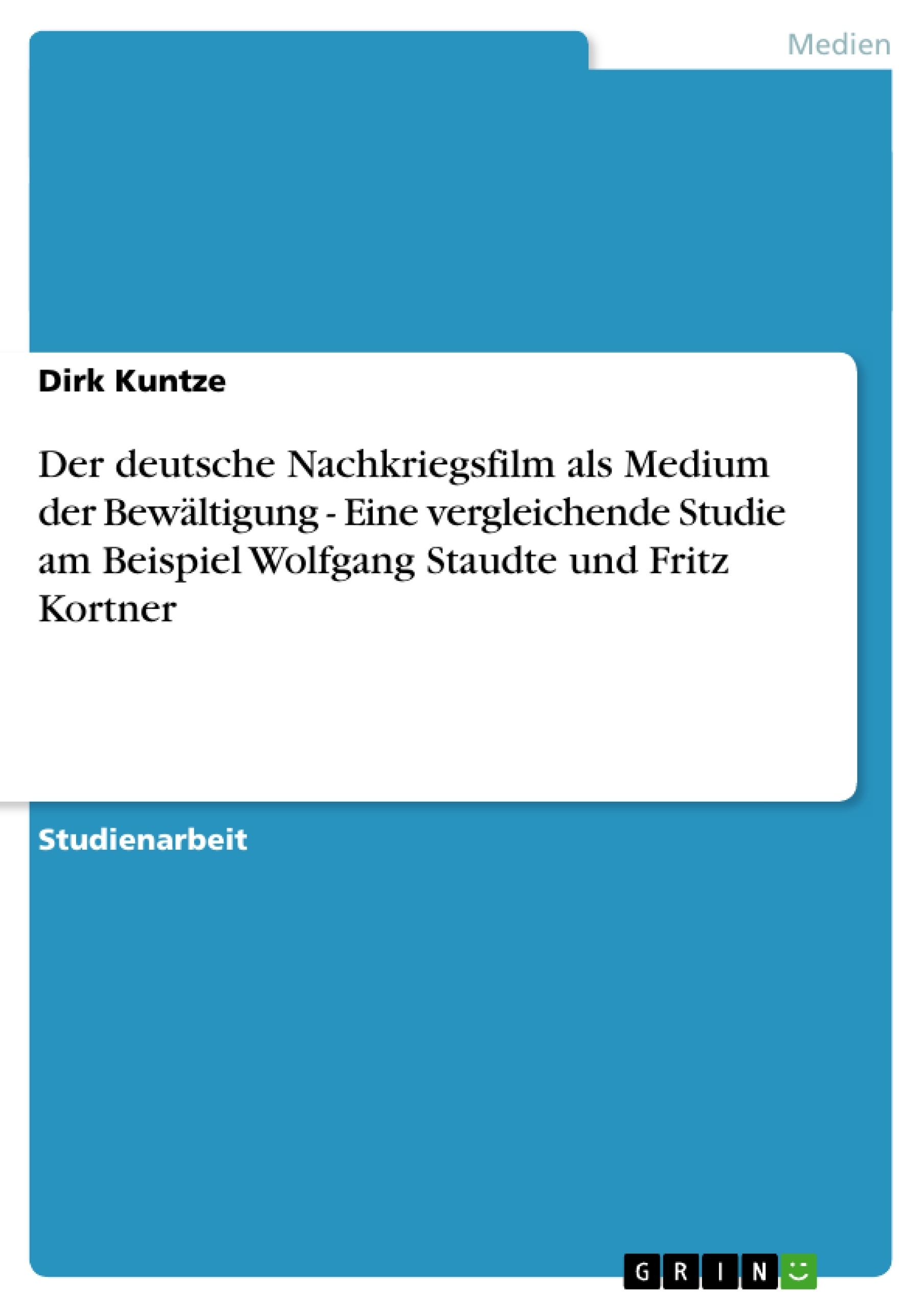Die Besucherzahlen der Lichtspieltheater erreichten in der direkten Nachkriegszeit später so nie wieder erklommene Höhen. Im Jahr 1946 besuchten 450 Millionen und im Folgejahr sogar 600 Millionen Zuschauer die verbliebenen Lichtspieltheater.
Diese Beliebtheit schien auch in den Augen der alliierten Besatzungsmächte den Film, als massenwirksames Medium zur Umerziehung der ideologisierten deutschen Nachkriegsbevölkerung, schmackhaft gemacht zu haben. Dies ist so wichtig, da allein sie in der Nachkriegszeit die entscheidende Instanz darstellten. Die jeweiligen Kulturoffiziere entschieden, welche Filme in die Kinos kamen. Doch stellte sich den für die Lizenzierung zuständigen Kulturoffizieren nun die Frage, wie der Film in den erzieherischen Prozess eingeflochten werden könne? Dass der deutsche Film diese heikle Aufgabe nicht bewältigen konnte war anfangs sehr klar. So heißt es vorerst von oberster Stelle, „ In den nächsten zwanzig Jahren sei für die Deutschen gar nicht an Film zu denken! “ Denn er stand noch, wie unberührbar, im Schatten der propagandistischen und allein dieser Nutzung. Wie konnte die Bevölkerung wieder mit diesem sehr einflussreichen Medium konfrontiert werden? Diesen Fragen begegneten die vier Besatzungszonen auf unterschiedliche Weise. Die Nachzeichnung der Lösungsformen innerhalb der amerikanischen wie auch der sowjetischen Besatzungszone, mittels ausgewählter Beispiele, bildet den Untersuchungsgegenstand dieser Publikation.
In näherer Betrachtung erwachsen aus dem Untersuchungshorizont, über den räumlich-zeitlichen Aspekt hinaus, Fragen an die Rolle des Drehbuchautors. Gerade die hier behandelten Filme, DIE MÖRDER SIND UNTER UNS (Wolfgang Staudte, 1946) und DER RUF (Fritz Kortner, 1948/49), verlangen aufgrund der Biographien ihrer Autoren, geradezu nach dieser speziellen Fragestellung. Ersterer dem Geiste eines auch in der NS-Zeit stets aktiven, doch System ablehnenden Filmschaffenden entstammend und im Fall Kortners die Frucht der Bewältigungsarbeit eines „Heimkehrers“. Die Frage nach autobiographischen Elementen innerhalb ihrer Werke stellt hier die Drehbuchautoren in ein besonderes Licht. Wie gestalteten diese Filmemacher ihre Werke? Natürlich interessiert auf formaler Ebene die künstlerischästhetische Umsetzung der Stoffe, zumal diese wiederum Rückschlüsse auf die ideelle Zielsetzung ermöglicht. So lautet die Frage präziser gestellt, welcher filmischen Mittel bedienten sie sich und mit welcher Wirkung?
[c] Dirk Kuntze
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Über den Untersuchungsgegenstand
- II. Filmische Mittel nach dem Krieg
- III. Zeit und Ort als Einflussgröße
- IV. Autobiographische Kriegsbewältigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bewältigung des Zweiten Weltkriegs im deutschen Nachkriegsfilm anhand der Werke von Wolfgang Staudte und Fritz Kortner. Sie analysiert, wie filmische Mittel eingesetzt wurden, um mit den traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit umzugehen und die deutsche Bevölkerung umzuerziehen. Die Arbeit betrachtet den Einfluss von Zeit und Ort auf die filmische Darstellung und geht der Frage nach autobiographischen Elementen in den Filmen nach.
- Der deutsche Nachkriegsfilm als Medium der Bewältigung
- Vergleichende Analyse von Wolfgang Staudtes und Fritz Kortners Filmen
- Filmische Mittel und ihre Wirkung
- Zeit und Ort als Einflussfaktoren
- Autobiographische Elemente in der Kriegsbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die enorme Popularität des Films in der unmittelbaren Nachkriegszeit und die Rolle der alliierten Besatzungsmächte bei der Nutzung des Films als Werkzeug der Umerziehung. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Bewältigungsstrategien im deutschen Nachkriegsfilm und fokussiert auf die Filme "Die Mörder sind unter uns" (Staudte) und "Der Ruf" (Kortner) aufgrund der Biografien ihrer Autoren. Die Analyse soll die filmischen Mittel untersuchen und deren Wirkung auf die ideelle Zielsetzung beleuchten.
I. Über den Untersuchungsgegenstand: Dieses Kapitel präsentiert detailliert die Fakten zu Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns" (1946), dem ersten deutschen Meisterwerk des Nachkriegsfilms und Begründer des Genres des Trümmerfilms. Es beschreibt den Inhalt des Films, der die Rückkehr einer KZ-Überlebenden und deren Begegnung mit einem traumatisierten Soldaten thematisiert, der mit seiner Vergangenheit im Krieg ringt. Die Handlung konzentriert sich auf die Auseinandersetzung mit Schuld, Trauma und der Suche nach Gerechtigkeit.
II. Filmische Mittel nach dem Krieg: [An dieser Stelle würde eine Zusammenfassung des zweiten Kapitels stehen, die den Fokus auf die filmischen Mittel und deren Wirkung im Kontext der Kriegsbewältigung legt. Da der bereitgestellte Text kein Kapitel II enthält, kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.]
III. Zeit und Ort als Einflussgröße: [An dieser Stelle würde eine Zusammenfassung des dritten Kapitels stehen, die die Bedeutung von Zeit und Ort in der filmischen Darstellung der Kriegsbewältigung erläutert. Da der bereitgestellte Text kein Kapitel III enthält, kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.]
IV. Autobiographische Kriegsbewältigung: [An dieser Stelle würde eine Zusammenfassung des vierten Kapitels stehen, die die autobiographischen Elemente in den Filmen von Staudte und Kortner analysiert und deren Rolle in der individuellen und gesellschaftlichen Verarbeitung der Kriegserfahrungen beleuchtet. Da der bereitgestellte Text kein Kapitel IV enthält, kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.]
Schlüsselwörter
Deutscher Nachkriegsfilm, Kriegsbewältigung, Trümmerfilm, Heimkehrerfilm, Wolfgang Staudte, Fritz Kortner, "Die Mörder sind unter uns", "Der Ruf", Filmische Mittel, Autobiographie, Trauma, Schuld, Umerziehung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des deutschen Nachkriegsfilms
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bewältigung des Zweiten Weltkriegs im deutschen Nachkriegsfilm anhand der Werke von Wolfgang Staudte und Fritz Kortner. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der filmischen Mittel, des Einflusses von Zeit und Ort sowie autobiographischer Elemente in der Darstellung der Kriegsfolgen und der Umerziehung der deutschen Bevölkerung.
Welche Filme werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Filme "Die Mörder sind unter uns" von Wolfgang Staudte und "Der Ruf" von Fritz Kortner. Die Auswahl dieser Filme basiert auf den Biografien der Regisseure und ihrer Bedeutung für den deutschen Nachkriegsfilm.
Welche Aspekte werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Untersuchung verschiedener filmischer Mittel und deren Wirkung, den Einfluss von Zeit und Ort auf die filmische Darstellung, sowie die Identifizierung und Interpretation autobiografischer Elemente in den Filmen. Es wird untersucht, wie diese Elemente zur Bewältigung der Kriegserfahrungen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene beitragen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung und vier Hauptkapitel: I. Über den Untersuchungsgegenstand (detaillierte Betrachtung von "Die Mörder sind unter uns"), II. Filmische Mittel nach dem Krieg, III. Zeit und Ort als Einflussgröße, und IV. Autobiographische Kriegsbewältigung. Leider enthält der bereitgestellte Text nur eine Zusammenfassung der Einleitung und des ersten Kapitels.
Was ist das zentrale Thema der Einleitung?
Die Einleitung beleuchtet die Popularität des Films in der Nachkriegszeit, die Rolle der alliierten Besatzungsmächte bei der Umerziehung durch Film und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Bewältigungsstrategien im deutschen Nachkriegsfilm. Sie begründet die Auswahl der untersuchten Filme.
Was wird im ersten Kapitel behandelt?
Das erste Kapitel ("Über den Untersuchungsgegenstand") beschreibt detailliert Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns" (1946), seinen Inhalt, der die Rückkehr einer KZ-Überlebenden und die Begegnung mit einem traumatisierten Soldaten thematisiert, und die Auseinandersetzung mit Schuld, Trauma und der Suche nach Gerechtigkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Nachkriegsfilm, Kriegsbewältigung, Trümmerfilm, Heimkehrerfilm, Wolfgang Staudte, Fritz Kortner, "Die Mörder sind unter uns", "Der Ruf", Filmische Mittel, Autobiographie, Trauma, Schuld, Umerziehung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Strategien der Kriegsbewältigung im deutschen Nachkriegsfilm zu untersuchen und den Einsatz filmischer Mittel in diesem Kontext zu analysieren. Der Vergleich der Filme von Staudte und Kortner soll dabei Aufschluss über unterschiedliche Herangehensweisen geben.
- Quote paper
- Dirk Kuntze (Author), 2005, Der deutsche Nachkriegsfilm als Medium der Bewältigung - Eine vergleichende Studie am Beispiel Wolfgang Staudte und Fritz Kortner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40536