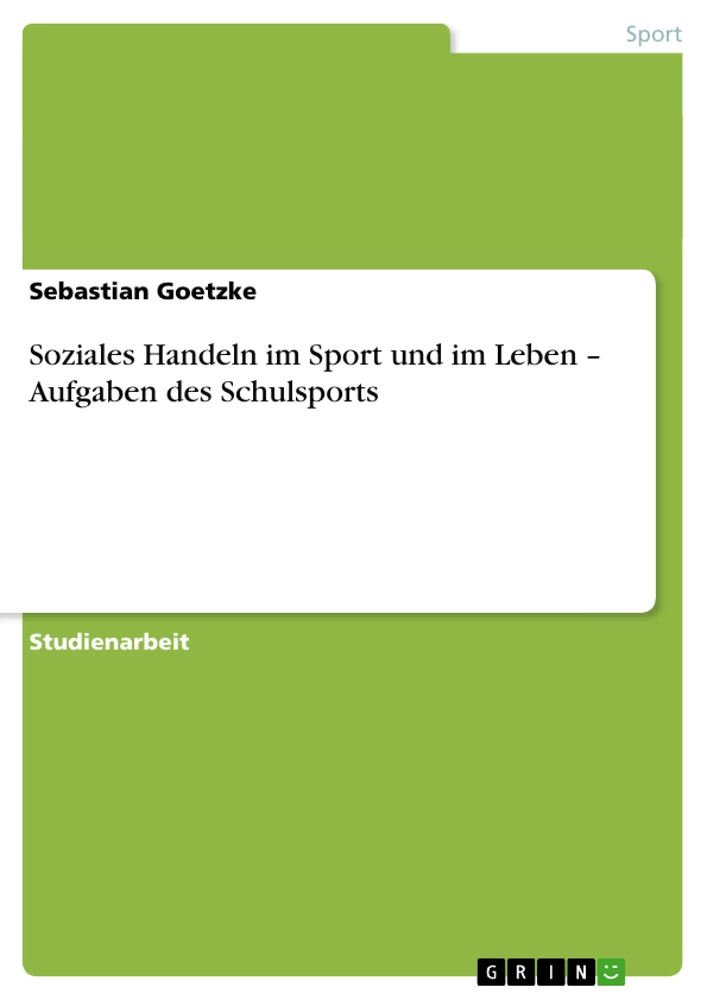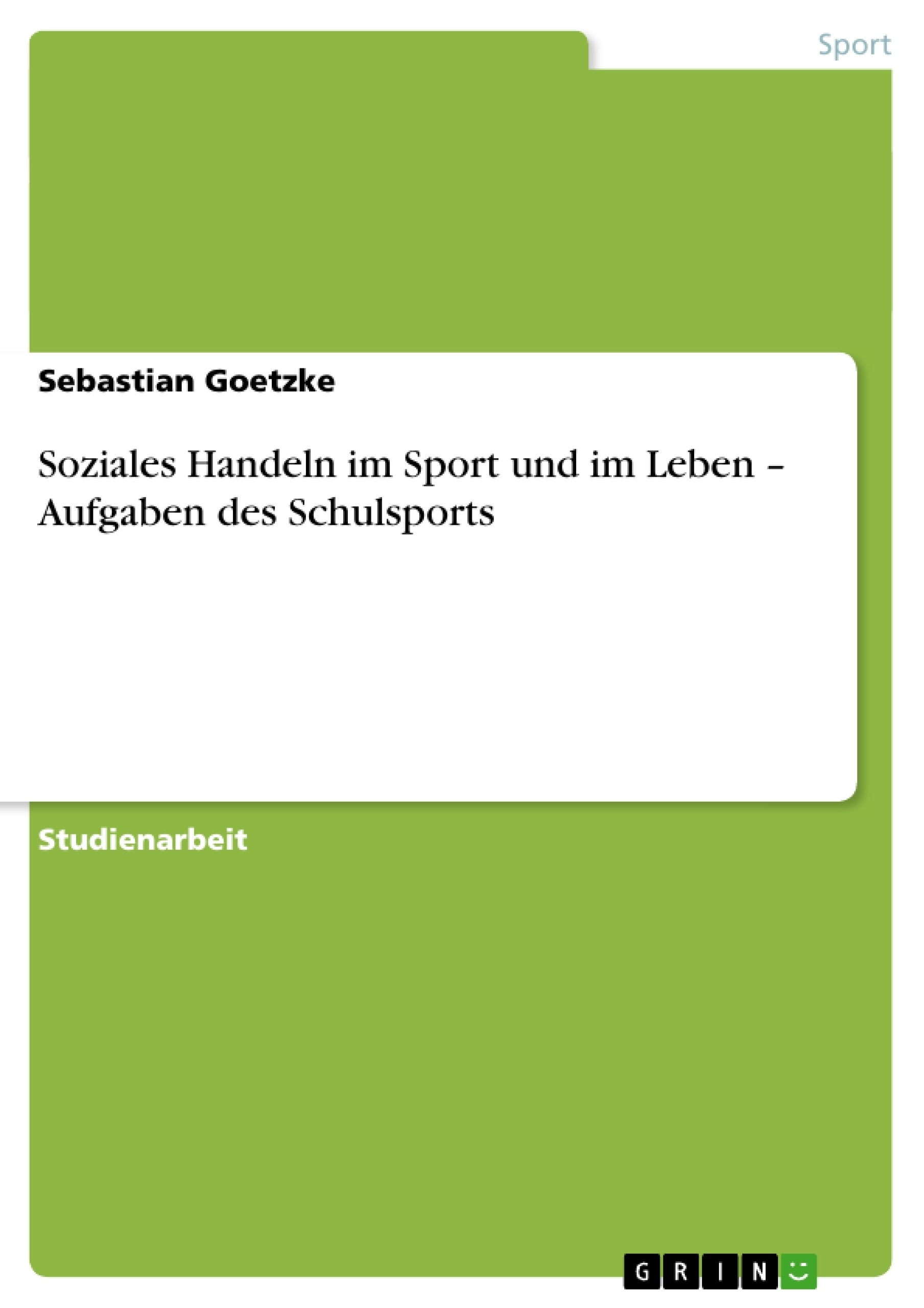Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen...
Dies ist der Wortlaut der fünften pädagogischen Perspektive der neuen Richtlinien in NRW von 1999. Damit verbunden sind vor allem Schlagwörter wie „differenziertes Regelverständnis“, „Regelbewusstsein“, „sozial verträgliche Gestaltung sportlichen Handelns“, „Kompetenz zur Gestaltung von Kooperations- und Konkurrenzsituationen in Bewegungs-, Spiel- und Sportaktivitäten“, „Befähigung zur Übernahme und verantwortlichen Ausübung unterschiedlicher Funktionen im Sport“, „aufgeschlossener Umgang mit gegenwärtig nicht mehr geläufigen oder fremden Bewegungskulturen“.
Da diese Perspektive nicht allein steht, sondern mit den fünf übrigen pädagogischen Perspektiven eine Einheit bildet, sollen die oben angeführten Schlagworte inhaltlich in modernen Sportunterricht integriert werden.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, verschiedene Konzepte darzustellen, wie soziales Lernen und Sportunterricht zusammen passen. Auf theoretischer Ebene soll zunächst ein Überblick über die wichtigsten Ideen gegeben werden. In diesem Teil beziehe ich mich hauptsächlich auf die Arbeiten von Gebken und Pühse, die mit ihren neueren Publikationen einen guten Überblick liefern.
Im zweiten Teil möchte ich dann versuchen, Beispiele zu geben, wie soziales Handeln im Unterricht auf der Mikroebene gestaltet werden kann, um gerade auch den wichtigen praktischen Aspekt in der Sportlehrerausbildung zu betonen. Insbesondere werde ich hierbei untersuchen, ob genügend und ausreichende Literatur für angehende Sportlehrer zur Verfügung steht, um didaktische Konzepte und Ideale zum sozialen Lernen in den Schulalltag umzusetzen. Hierbei werde ich mich hauptsächlich auf die Arbeit von Ungerer-Röhrich beziehen. Nicht zuletzt möchte ich mit dieser Arbeit auch einen Beitrag zur Rechtfertigung des Schulfaches Sport liefern, gerade im Hinblick auf eine Erziehung zum sozialen Handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziales Handeln und Lernen
- Soziales Handeln im Sport - Theoretische Konzeptionen
- Frühere Konzeptionen
- Neuere Konzeptionen
- Der Leistungsaspekt im Schulsport – Konsequenzen für soziales Handeln
- Praxisbeispiele zum Erlernen sozialen Handelns an ausgewählten Sportarten
- Fußball
- Kleine Spiele
- Leichtathletik
- Orientierungslauf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen sozialem Lernen und Sportunterricht. Das Hauptziel ist die Darstellung verschiedener Konzepte, die soziales Lernen in den Sportunterricht integrieren. Die Arbeit beleuchtet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Beispiele auf der Mikroebene des Unterrichts. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verfügbarkeit von Literatur für angehende Sportlehrer, die didaktische Konzepte für soziales Lernen im Schulalltag umsetzen wollen. Schließlich soll ein Beitrag zur Rechtfertigung des Schulfachs Sport im Hinblick auf die Erziehung zum sozialen Handeln geleistet werden.
- Theoretische Konzepte sozialen Lernens im Sport
- Praktische Umsetzung sozialen Handelns im Sportunterricht
- Didaktische Konzepte und Literatur für angehende Sportlehrer
- Bedeutung des Schulfachs Sport für die soziale Erziehung
- Analyse ausgewählter Sportarten im Hinblick auf soziales Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die fünf pädagogischen Perspektiven der neuen Richtlinien in NRW von 1999, die Kooperation, Wettkampf und Verständigung im Sport betonen. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit: die Darstellung von Konzepten, die soziales Lernen und Sportunterricht verbinden, sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene. Die Einleitung erwähnt die zentralen Autoren, auf deren Arbeiten sich die Arbeit stützt, und betont die Bedeutung der praktischen Umsetzung im Sportunterricht und die Notwendigkeit ausreichender Literatur für angehende Sportlehrer.
Soziales Handeln und Lernen: Dieses Kapitel befasst sich mit Definitionen von sozialem Handeln und sozialem Lernen. Es orientiert sich an den Thesen der Wissenschaftler Gebken und Pühse und unterscheidet zwischen „Sozialerziehung“ als normativ geprägter, lehrerinitiierter Förderung positiver sozialer Verhaltensweisen und „Erziehung zum sozialen Handeln“, die das selbstgestaltende Handeln der Schüler im sozialen Kontext anregt. Der gesellschaftliche Wandel und die veränderten Lebenssituationen von Jugendlichen werden als Gründe angeführt, soziale Erziehung wieder stärker in den Mittelpunkt der schulischen und sportpädagogischen Aufgaben zu rücken. Die Kapitel kritisiert den Mangel an praktischer Umsetzung trotz theoretischer Diskussionen in der Sportpädagogik.
Soziales Handeln im Sport - Theoretische Konzeptionen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über theoretische Konzeptionen sozialen Handelns im Sport, unterteilt in frühere und neuere Ansätze. Es analysiert die verschiedenen Perspektiven und Ansätze und untersucht den Einfluss des Leistungsaspekts im Schulsport auf das soziale Handeln. Der Abschnitt bietet einen umfassenden Rahmen für das Verständnis der theoretischen Fundamente der Arbeit und legt die Grundlage für die anschließende Betrachtung praktischer Beispiele.
Praxisbeispiele zum Erlernen sozialen Handelns an ausgewählten Sportarten: Dieses Kapitel präsentiert Praxisbeispiele aus verschiedenen Sportarten (Fußball, Kleine Spiele, Leichtathletik, Orientierungslauf), die das Erlernen sozialen Handelns illustrieren. Es wird detailliert gezeigt, wie in diesen Sportarten soziales Handeln konkret umgesetzt und gefördert werden kann. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der zuvor erörterten theoretischen Konzepte und zeigt die vielseitigen Möglichkeiten, soziales Lernen im Sportunterricht zu fördern.
Schlüsselwörter
Soziales Handeln, soziales Lernen, Sportunterricht, Schulsport, pädagogische Perspektiven, Konkurrenz, Kooperation, Leistungsaspekt, didaktische Konzepte, Sportlehrerausbildung, theoretische Konzeptionen, Praxisbeispiele, Sozialerziehung, Erziehung zum sozialen Handeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziales Handeln und Lernen im Sportunterricht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialem Lernen und Sportunterricht. Ihr Hauptziel ist die Darstellung verschiedener Konzepte, die soziales Lernen in den Sportunterricht integrieren. Sie beleuchtet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Beispiele und richtet sich insbesondere an angehende Sportlehrer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt theoretische Konzepte sozialen Lernens im Sport, die praktische Umsetzung sozialen Handelns im Sportunterricht, didaktische Konzepte und Literatur für angehende Sportlehrer, die Bedeutung des Schulfachs Sport für die soziale Erziehung und eine Analyse ausgewählter Sportarten (Fußball, Kleine Spiele, Leichtathletik, Orientierungslauf) im Hinblick auf soziales Lernen.
Welche theoretischen Konzepte werden diskutiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen „Sozialerziehung“ (normativ geprägte, lehrerinitiierte Förderung) und „Erziehung zum sozialen Handeln“ (selbstgestaltendes Handeln der Schüler). Sie bietet einen Überblick über frühere und neuere Konzeptionen sozialen Handelns im Sport und analysiert den Einfluss des Leistungsaspekts auf das soziale Handeln. Die Arbeit bezieht sich auf die Thesen von Gebken und Pühse.
Welche praktischen Beispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Praxisbeispiele aus Fußball, Kleinen Spielen, Leichtathletik und Orientierungslauf, die zeigen, wie soziales Handeln in diesen Sportarten konkret umgesetzt und gefördert werden kann.
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Die Arbeit richtet sich vor allem an angehende Sportlehrer, indem sie didaktische Konzepte und relevante Literatur für den Schulalltag bereitstellt. Sie soll auch einen Beitrag zur Rechtfertigung des Schulfachs Sport im Hinblick auf die Erziehung zum sozialen Handeln leisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu sozialem Handeln und Lernen, theoretischen Konzeptionen sozialen Handelns im Sport, Praxisbeispielen aus verschiedenen Sportarten und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Soziales Handeln, soziales Lernen, Sportunterricht, Schulsport, pädagogische Perspektiven, Konkurrenz, Kooperation, Leistungsaspekt, didaktische Konzepte, Sportlehrerausbildung, theoretische Konzeptionen, Praxisbeispiele, Sozialerziehung, Erziehung zum sozialen Handeln.
Welche pädagogischen Perspektiven werden berücksichtigt?
Die Einleitung erwähnt die fünf pädagogischen Perspektiven der neuen Richtlinien in NRW von 1999, die Kooperation, Wettkampf und Verständigung im Sport betonen.
Wie wird der Leistungsaspekt im Schulsport behandelt?
Die Arbeit analysiert den Einfluss des Leistungsaspekts im Schulsport auf das soziale Handeln und untersucht dessen Konsequenzen für die Umsetzung von Konzepten sozialen Lernens.
- Quote paper
- Sebastian Goetzke (Author), 2005, Soziales Handeln im Sport und im Leben – Aufgaben des Schulsports, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40521