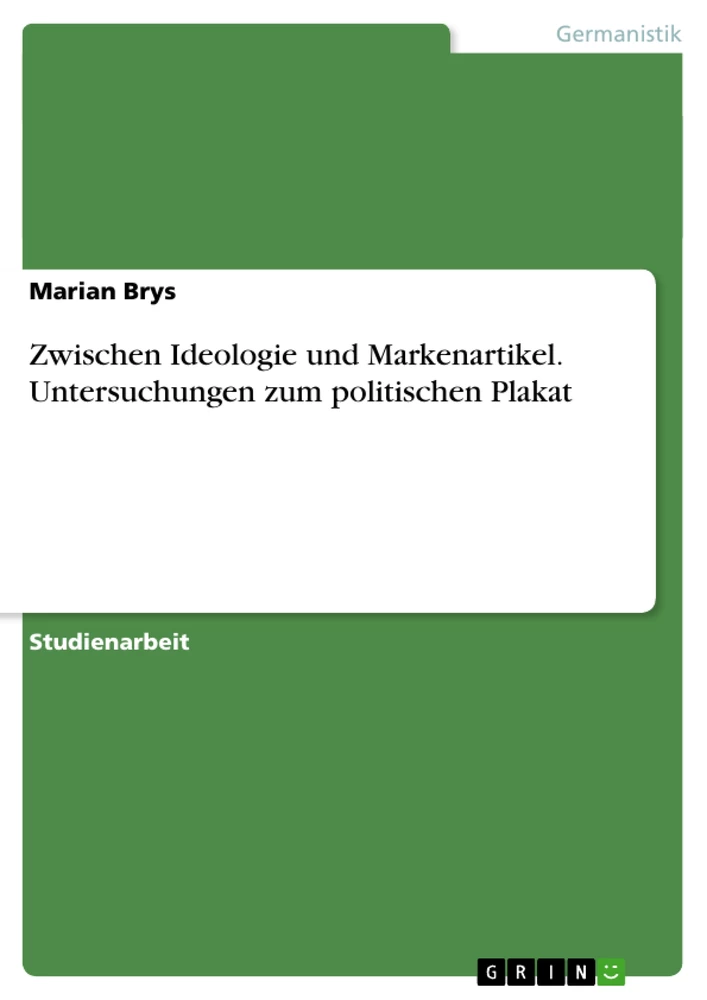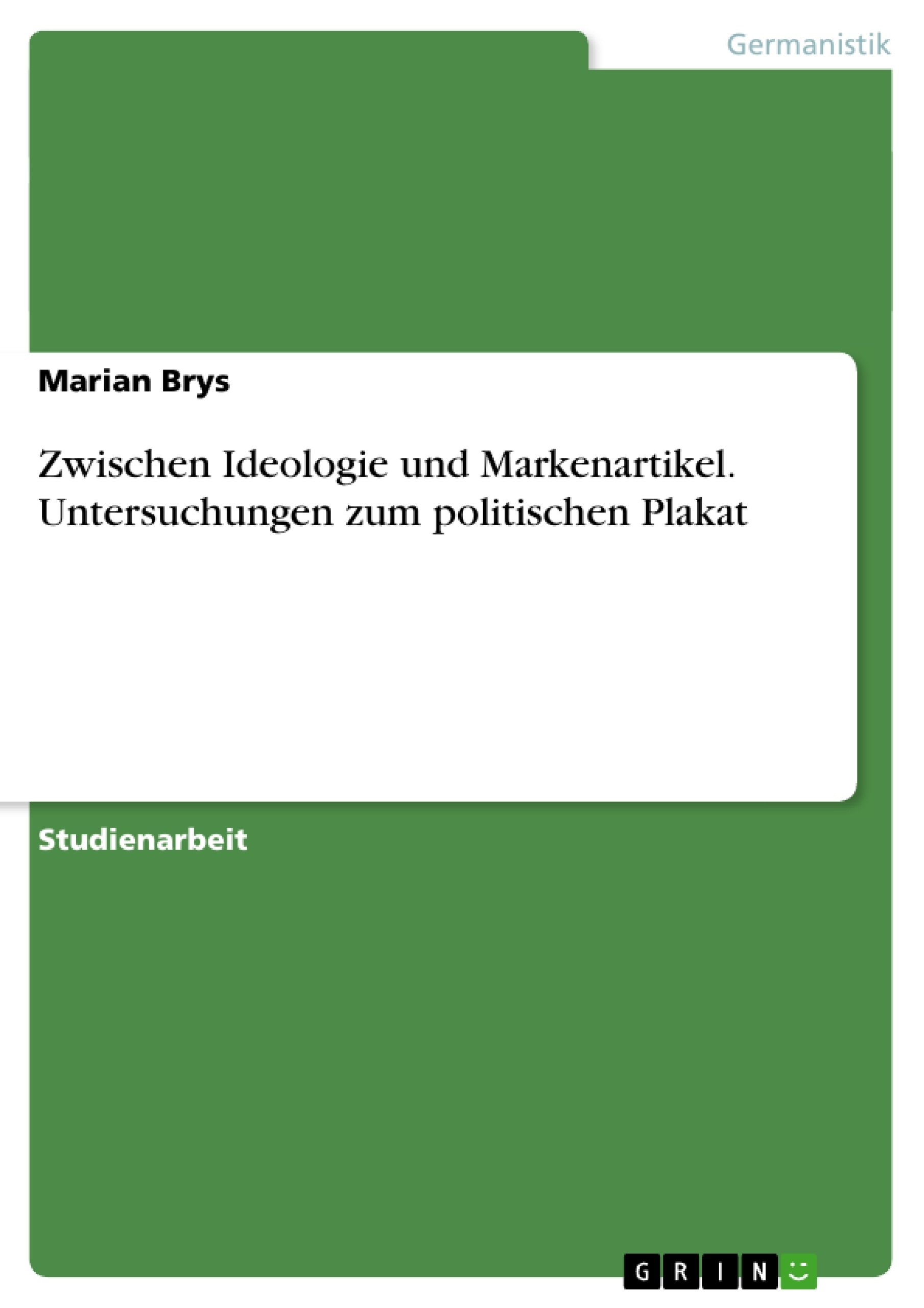Die hier vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Analyse des Sprachgebrauchs in politischen Plakaten leisten und fokussiert gerade in heutigen Zeiten, in denen verfassungsfeindliche Gruppierungen einen gewissen Erfolg bei Landtagswahlen verbuchen, ein brisantes Thema. Indem im ersten Teil, dem der Theorie, eine fundierte Grundlage erarbeitet wird, kann diese im analytischen Kapitel genutzt werden, um die Funktionsweise politischer Plakate zu erklären und so ihren persuasiven Charakter aufdecken. Neben der Analyse des Sprachgebrauchs sowie seiner visuellen Umsetzung soll hier untersucht werden, inwiefern sich politische Werbung mit professionell vermarkteten Wirtschaftsprodukten vergleichen lässt und, wenn dem so ist, inwieweit sich diesbezüglich Entwicklungen abzeichneten bzw. Ursachen aufzudecken sind. Um dem nachzugehen, führe ich bei dem ersten Beispiel eine Analyse durch, die sich weitestgehend an den zuvor ausgearbeiteten Grundlagen orientieren, während im darauf folgenden Komplex wiederkehrende Plakatmotive vorgestellt werden, die meines Erachtens ebenfalls Erklärungsmuster für Entwicklungen in der Wahlwerbung bieten könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Verbaler Kode
- 2.1.1 Schlagwort
- 2.1.2 Fahnenwort und Stigmawort
- 2.1.3 Hochwert-/Unwertwort
- 2.1.4 "Streit um Worte"
- 2.2 Visueller Kode
- 2.2.1 Ikonische Ebene
- 2.2.2 Ikonographische Ebene
- 2.2.3 Tropologische Ebene
- 2.2.4 Topische Ebene
- 2.2.5 Enhymematische Ebene
- 3. Anwendung durch Analyse
- 3.1 1976: CDU vs. SPD
- 3.2 Parteienübergreifende Wiederkehr von Plakatmotiven
- 3.2.1 NSDAP und NPD
- 3.2.2 CDU und NPD
- 4. Schlussbemerkung
- 5. Literatur
- 6. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Sprachgebrauch in politischen Plakaten, insbesondere im Kontext des Erfolgs verfassungsfeindlicher Gruppierungen. Sie untersucht die Funktionsweise politischer Plakate und deren persuasiven Charakter, indem sie theoretische Grundlagen im ersten Teil erarbeitet und diese anschließend in der Analyse anwendet. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Vergleich politischer Werbung mit der Werbung für Wirtschaftsprodukte und der Untersuchung möglicher Entwicklungen und Ursachen.
- Analyse des Sprachgebrauchs in politischen Plakaten
- Untersuchung des persuasiven Charakters politischer Plakate
- Vergleich politischer Werbung mit der Werbung für Wirtschaftsprodukte
- Analyse wiederkehrender Plakatmotive
- Erklärung von Entwicklungen in der Wahlwerbung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Analyse des Sprachgebrauchs in politischen Plakaten, besonders angesichts des Erfolgs verfassungsfeindlicher Parteien. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der aus einem theoretischen und einem analytischen Teil besteht. Die Einleitung benennt die Forschungsfragen: Wie funktioniert politische Werbung auf Plakaten? Lässt sich politische Werbung mit Wirtschaftswerbung vergleichen? Welche Entwicklungen sind erkennbar? Die Einleitung deutet an, dass die Analyse anhand konkreter Beispiele erfolgen wird, um die theoretischen Grundlagen zu illustrieren.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse fest. Es untersucht den verbalen Kode in der politischen Sprache, der sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt, darunter Verwaltungssprache, juristische Sprache und Alltagssprache. Ein wichtiger Aspekt ist das politische Institutionsvokabular. Besondere Bedeutung haben Schlagwörter, die neben ihrer lexikalischen Bedeutung auch emotionale Konnotationen tragen und somit Meinungsbildung beeinflussen. Das Kapitel differenziert zwischen Schlag-, Fahnen- und Stigmawörtern, wobei die jeweiligen Funktionen und Wirkungsweisen erläutert werden. Der polysemantische Charakter von Schlagwörtern und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Definition werden diskutiert. Der Begriff der ideologischen Polysemie wird eingeführt, um die unterschiedliche Bewertung desselben Schlagwortes durch verschiedene Gruppen zu erklären.
3. Anwendung durch Analyse: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen auf konkrete Beispiele angewendet. Die Analyse konzentriert sich auf politische Plakate, wobei zunächst ein Beispiel aus dem Jahr 1976 (CDU vs. SPD) im Detail untersucht wird. Anschließend werden wiederkehrende Plakatmotive vorgestellt und deren mögliche Bedeutung für die Entwicklungen in der Wahlwerbung diskutiert. Die Analyse beleuchtet die strategische Nutzung von Sprache und Bild in politischen Plakaten und deren Wirkung auf die Wähler.
Schlüsselwörter
Politische Plakate, Sprachgebrauch, Werbung, Wahlkampf, Schlagwörter, Fahnenwörter, Stigmawörter, Ideologie, Meinungsbildung, Visueller Kode, Verbaler Kode, Analyse, CDU, SPD, NPD, NSDAP.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von politischem Sprachgebrauch auf Wahlplakaten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Sprachgebrauch auf politischen Plakaten, insbesondere im Hinblick auf den Erfolg verfassungsfeindlicher Parteien. Sie untersucht die Funktionsweise politischer Plakate und deren persuasiven Charakter, vergleicht politische Werbung mit Wirtschaftswerbung und analysiert wiederkehrende Plakatmotive.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit untersucht den verbalen und visuellen Kode in der politischen Sprache. Der verbale Kode umfasst Schlagwörter, Fahnenwörter, Stigmawörter und die Herausforderungen der polysemantischen Interpretation. Der visuelle Kode wird auf verschiedenen Ebenen (ikonisch, ikonographisch, tropologisch, topisch, enhymematisch) analysiert. Die Arbeit berücksichtigt auch das politische Institutionsvokabular und den Begriff der ideologischen Polysemie.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf politische Plakate. Ein detailliertes Beispiel aus dem Jahr 1976 (CDU vs. SPD) wird untersucht. Zusätzlich werden wiederkehrende Plakatmotive, insbesondere im Vergleich zwischen Parteien wie NSDAP, NPD und CDU, analysiert, um Entwicklungen in der Wahlwerbung zu beleuchten.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie politische Werbung auf Plakaten funktioniert, ob politische Werbung mit Wirtschaftswerbung vergleichbar ist und welche Entwicklungen in der politischen Werbung erkennbar sind.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Teil mit theoretischen Grundlagen (verbaler und visueller Kode), einen analytischen Teil mit konkreten Beispielen (1976: CDU vs. SPD, wiederkehrende Plakatmotive), eine Schlussbemerkung, Literaturverzeichnis und Quellenangaben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Politische Plakate, Sprachgebrauch, Werbung, Wahlkampf, Schlagwörter, Fahnenwörter, Stigmawörter, Ideologie, Meinungsbildung, Visueller Kode, Verbaler Kode, Analyse, CDU, SPD, NPD, NSDAP.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Sprachgebrauch in politischen Plakaten, um die Funktionsweise und den persuasiven Charakter dieser Werbung zu verstehen. Ein Fokus liegt auf dem Vergleich mit Wirtschaftswerbung und der Analyse wiederkehrender Motive, insbesondere im Kontext des Erfolgs verfassungsfeindlicher Gruppierungen.
Wie wird der visuelle Kode analysiert?
Der visuelle Kode wird auf verschiedenen Ebenen analysiert: ikonisch (direkte Abbildung), ikonographisch (symbolische Darstellung), tropologisch (metaphorische Darstellung), topisch (räumliche Anordnung) und enhymematisch (rhetorische Figuren).
Welche Rolle spielen Schlagwörter, Fahnenwörter und Stigmawörter?
Schlagwörter, Fahnenwörter und Stigmawörter sind zentrale Elemente des verbalen Kodes. Sie tragen neben ihrer lexikalischen Bedeutung auch emotionale Konnotationen und beeinflussen die Meinungsbildung. Die Arbeit differenziert zwischen diesen Wortarten und untersucht deren Funktionen und Wirkungsweisen.
Wie wird die ideologisch Polysemie behandelt?
Der Begriff der ideologischen Polysemie erklärt, wie dasselbe Schlagwort von verschiedenen Gruppen unterschiedlich bewertet und interpretiert werden kann.
- Quote paper
- Marian Brys (Author), 2005, Zwischen Ideologie und Markenartikel. Untersuchungen zum politischen Plakat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40357