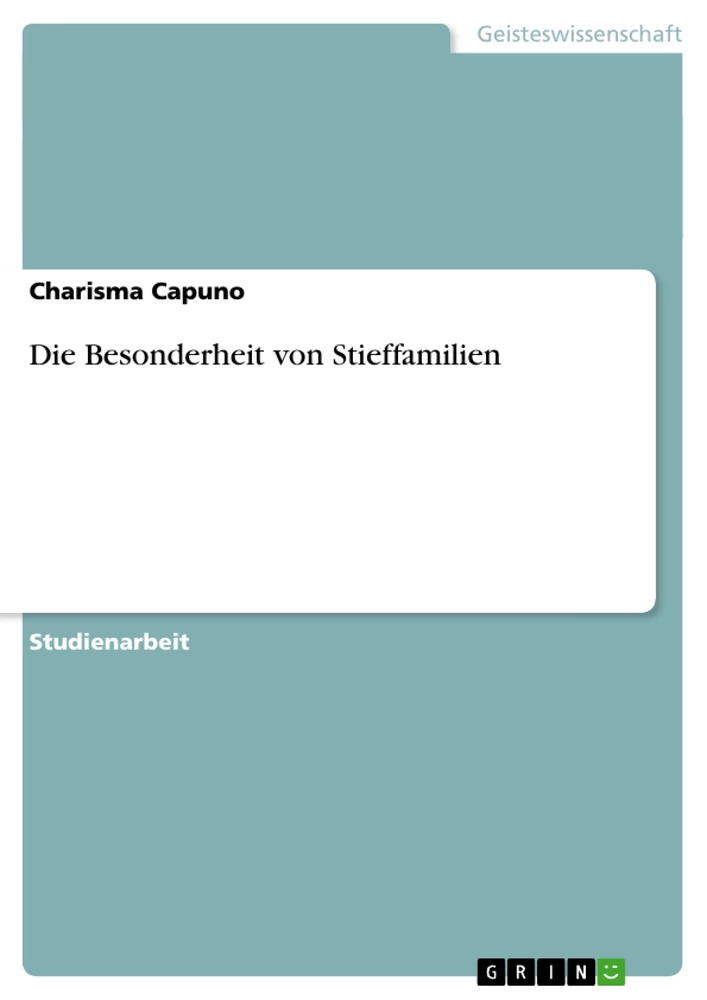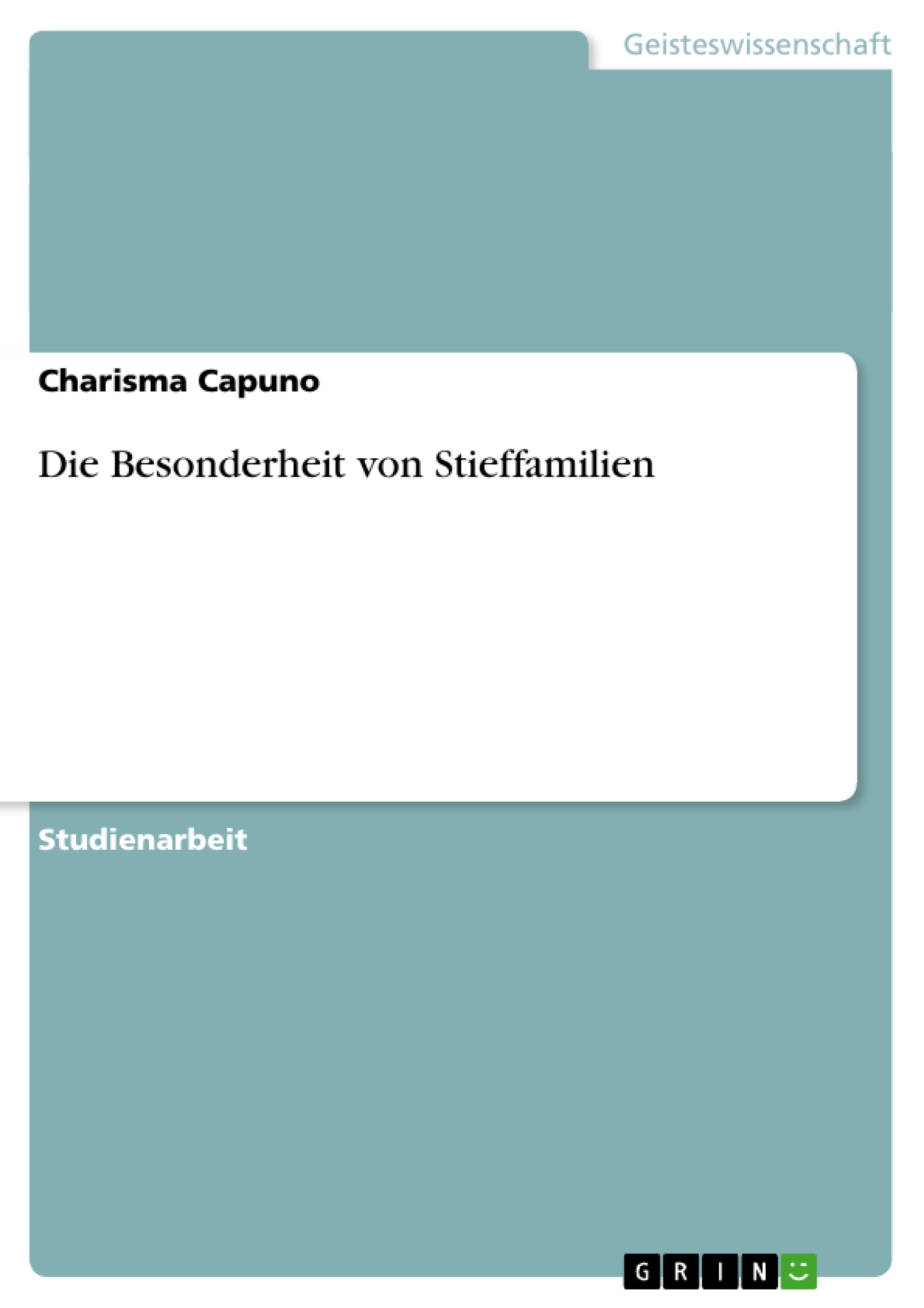Weltweit nimmt die Zahl der Ehescheidungen langsam aber stetig zu. Allein in der Bundesrepublik wird statistisch gesehen jede dritte Ehe wieder geschieden, wobei sich mehr als die Hälfte der geschiedenen Ehepartner wieder neu verheiraten. Etwa 50% aller geschiedenen Ehen haben minderjährige Kinder. Die Hälfte aller Scheidungskinder werden durch eine Wiederheirat des Elternteils, bei dem sie leben, zu Stiefkindern. Von den übrigen Scheidungskindern leben zusätzlich etwa 65% mit ihrem leiblichen Elternteil und dessen Partner, die eine nichteheliche Lebensform praktizieren, zusammen. Stieffamilien gab es schon immer und waren früher sogar verbreiteter als heute. Aufgrund von Geburtskomplikationen, Kindbettfiber u. a. m. hatten Frauen in den vorigen Jahrhunderten nur eine geringe Lebenserwartung, so dass es damals mehr Stiefmutterfamilien gab als Familien mit einem Stiefvater. Heute ist die Verteilung genau umgekehrt. Während Verwitwung und Nichtehelichkeit damals überwiegend der Ursprung einer Stieffamilie war, ist es heute Trennung und Scheidung. In der Regel wird nämlich bei einer elterlichen Trennung das Sorgerecht für die Kinder auf die Mutter übertragen, es sei denn das Wohl des Kindes wird bei ihr als gefährdet angesehen. So bekamen beispielsweise 1995 nach einer Scheidung 73,8% der Mütter das alleinige Sorgerecht und nur 8,3% die Väter. Auf diese Weise bilden sich mehr Stiefvaterfamilien als Familien mit einer Stiefmutter. Von allen Familien in Deutschland sind schätzungsweise knapp 10% davon Stieffamilien – also mehr als zwei Millionen. Die große Zahl der Stieffamilien, die keine eheliche Grundlage haben, ist hier noch nicht mal inbegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Besonderheit von Stieffamilien
- Begriffserklärung
- Die Unterschiede zwischen Kern- und Stieffamilien
- Formen von Stieffamilien
- Stiefmutterfamilien
- Stiefvaterfamilien
- Zusammengesetzte Stieffamilien
- Stieffamilien mit einem gemeinsamen Kind
- Teilzeit-Stieffamilien
- Probleme von Stieffamilien
- Situation der Kinder
- Situation der Erwachsenen
- Die Beziehung
- zum außenstehenden Elternteil
- zum früheren Partner
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Besonderheiten von Stieffamilien im Vergleich zu Kernfamilien. Ziel ist es, die unterschiedlichen Strukturen, Herausforderungen und Beziehungen innerhalb von Stieffamilien zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Stieffamilien
- Vielfalt der Stieffamilienformen
- Herausforderungen und Probleme in Stieffamilien
- Beziehungen zu außenstehenden Elternteilen und früheren Partnern
- Soziologische und statistische Aspekte der Zunahme von Stieffamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Besonderheit von Stieffamilien: Dieses Kapitel beginnt mit der Feststellung des weltweiten Anstiegs von Scheidungen und Wiederverheiratungen, was zur Zunahme von Stieffamilien führt. Es werden statistische Daten zur Häufigkeit von Stieffamilien in Deutschland präsentiert und die historischen Unterschiede im Verhältnis von Stiefmutter- zu Stiefvaterfamilien erläutert, die durch veränderte gesellschaftliche Normen und das Sorgerecht nach Scheidungen beeinflusst werden. Der Fokus liegt auf dem Wandel von den traditionellen Ursachen (Verwitwung, Nichtehelichkeit) zu den heutigen Hauptursachen (Trennung und Scheidung).
Begriffserklärung: Dieser Abschnitt definiert den Begriff "Stieffamilie" und setzt ihn in Relation zu anderen Begriffen wie Patchwork- oder Zweitfamilie. Er betont den eigenständigen Charakter der Stieffamilie als Familiensystem, unabhängig vom ehelichen Status der Partner. Gleichzeitig wird auf die gesellschaftlichen Schwierigkeiten hingewiesen, die Stieffamilien aufgrund des Abweichens vom traditionellen Familienbild erfahren, und der Versuch vieler Stieffamilien, den Schein einer Kernfamilie zu wahren, wird kritisch betrachtet.
Die Unterschiede zwischen Kern- und Stieffamilien: Hier werden die zentralen Unterschiede zwischen Kern- und Stieffamilien herausgearbeitet. Der wichtigste Punkt ist die Offenheit der Systemgrenzen in Stieffamilien, die zu unterschiedlichen Meinungen darüber führt, wer zur Familie gehört. Die räumliche Trennung eines Elternteils und dessen fortdauernder Einfluss auf die neue Familie werden als bedeutsam hervorgehoben, ebenso wie die fehlende gemeinsame Geschichte und die unterschiedliche Bedeutung des Themas Kindererziehung in beiden Familienformen. Die juristische Situation der Stiefeltern und die emotionale Belastung durch vorherige Trennungen werden ebenfalls angesprochen.
Formen von Stieffamilien: Dieses Kapitel beleuchtet die strukturelle Vielfalt von Stieffamilien, die sich sowohl nach ihrer Vorgeschichte (Scheidung, Verwitwung usw.) als auch nach der Zusammensetzung der Partner differenzieren lässt. Die Komplexität der Definition von Stieffamilien wird durch die Vielzahl der möglichen Konstellationen verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Stieffamilie, Patchworkfamilie, Kernfamilie, Scheidung, Wiederverheiratung, Stiefmutter, Stiefvater, Familienstrukturen, Beziehungen, Herausforderungen, gesellschaftliche Probleme, Sorgerecht, Trennung, Verlust, gemeinsame Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Besonderheiten von Stieffamilien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Besonderheiten von Stieffamilien im Vergleich zu Kernfamilien. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Strukturen, Herausforderungen und Beziehungen innerhalb von Stieffamilien und analysiert den Einfluss von Scheidung und Wiederverheiratung auf die Familienstrukturen.
Welche Arten von Stieffamilien werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Formen von Stieffamilien, darunter Stiefmutterfamilien, Stiefvaterfamilien, zusammengesetzte Stieffamilien, Stieffamilien mit einem gemeinsamen Kind und Teilzeit-Stieffamilien. Die Vielfalt der Konstellationen und die Komplexität der Definition werden hervorgehoben.
Welche Probleme und Herausforderungen in Stieffamilien werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen und Probleme, denen sowohl Kinder als auch Erwachsene in Stieffamilien gegenüberstehen. Die Situation der Kinder, die Situation der Erwachsenen, die Beziehungen zu außenstehenden Elternteilen und früheren Partnern werden eingehend betrachtet. Die emotionale Belastung durch vorherige Trennungen und die unterschiedliche Bedeutung des Themas Kindererziehung spielen eine wichtige Rolle.
Wie werden Kernfamilien und Stieffamilien unterschieden?
Ein zentraler Unterschied liegt in der Offenheit der Systemgrenzen in Stieffamilien. Es wird diskutiert, wer zur Familie gehört und der räumliche Einfluss eines getrennt lebenden Elternteils auf die neue Familie wird betont. Die fehlende gemeinsame Geschichte und die unterschiedliche Bedeutung der Kindererziehung in beiden Familienformen werden ebenfalls hervorgehoben. Die juristische Situation der Stiefeltern wird ebenfalls angesprochen.
Welche Bedeutung haben statistische Daten und soziologische Aspekte?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit von Stieffamilien und erläutert historische Unterschiede im Verhältnis von Stiefmutter- zu Stiefvaterfamilien. Der Wandel von traditionellen Ursachen (Verwitwung, Nichtehelichkeit) zu den heutigen Hauptursachen (Trennung und Scheidung) wird analysiert. Soziologische Aspekte der Zunahme von Stieffamilien werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird der Begriff "Stieffamilie" definiert?
Der Begriff "Stieffamilie" wird definiert und in Relation zu anderen Begriffen wie Patchwork- oder Zweitfamilie gesetzt. Der eigenständige Charakter der Stieffamilie als Familiensystem wird betont, unabhängig vom ehelichen Status der Partner. Die gesellschaftlichen Schwierigkeiten, die Stieffamilien aufgrund des Abweichens vom traditionellen Familienbild erfahren, werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stieffamilie, Patchworkfamilie, Kernfamilie, Scheidung, Wiederverheiratung, Stiefmutter, Stiefvater, Familienstrukturen, Beziehungen, Herausforderungen, gesellschaftliche Probleme, Sorgerecht, Trennung, Verlust, gemeinsame Geschichte.
- Quote paper
- Charisma Capuno (Author), 2005, Die Besonderheit von Stieffamilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40333