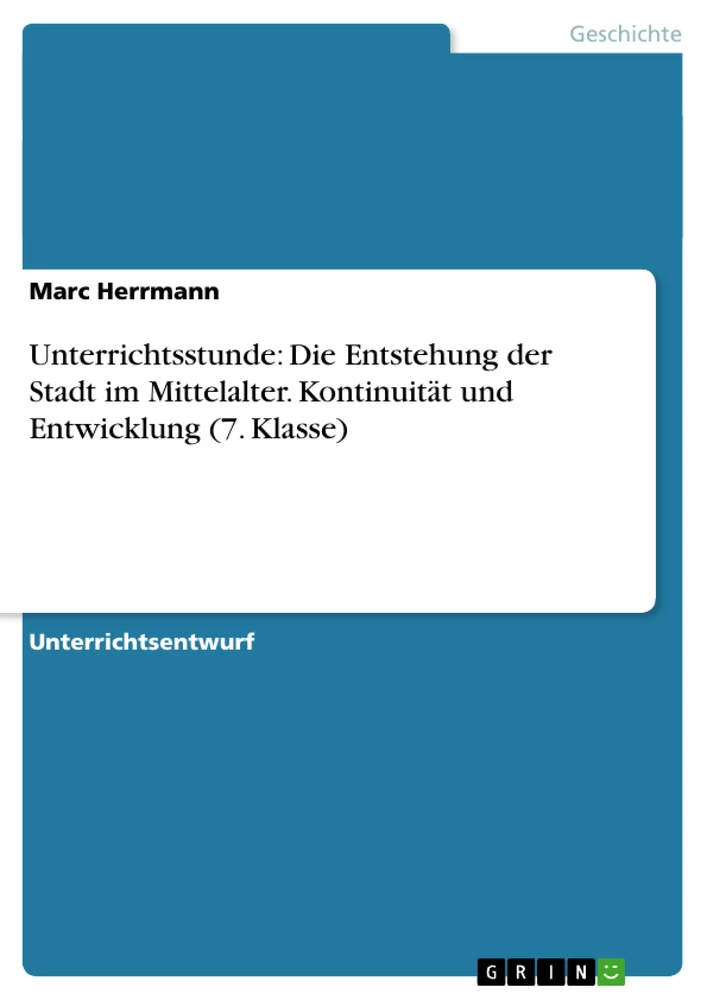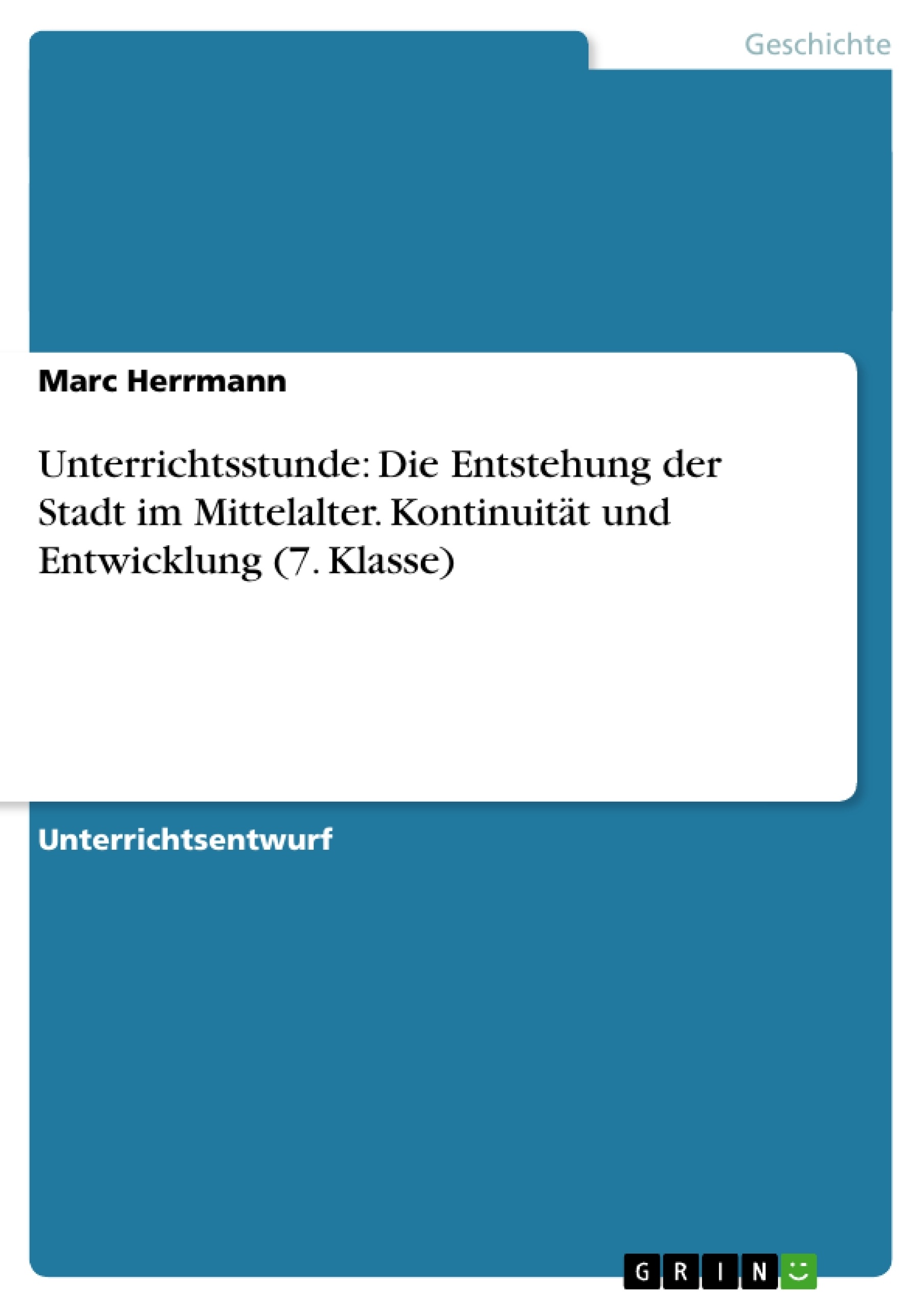Dem Lehrplan für Realschulen des Landes Baden-Württemberg zufolge ist das übergeordnete Ziel des Geschichtsunterrichts das Erkennen des Wertes der demokratischen Grundordnung. Die SchülerInnen erkennen unter anderem „die Notwendigkeit von Macht und Gewalt als legitimes staatliches Gewaltmonopol, und zwar als Mittel zum Erhalt der Demokratie und zur Durchsetzung der Rechtsordnung.“ 1 Das Gewaltmonopol eines demokratischen Staates wird in seiner Rechtmäßigkeit vom Gewaltmonopol in diktatorischen Staaten und von „aggressiver Gewalt gegen Menschen“ 2 unterschieden. Die SchülerInnen sollen den Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart erkennen, sie sollen die Realität aus mehreren Perspektiven betrachten und so lernen, auch Minderheiten anzuerkennen, sie sollen durch den Geschichtsunterricht ein Verantwortungsbewußtsein entwickeln sowie „die Bereitschaft, bei der Gestaltung unserer demokratischen, friedlichen und freiheitlichen Lebensordnung mitzuwirken“ 3 . Um diese Ziele zu erreichen, sollen die SchülerInnen die Arbeitsweisen eines Historikers in ihren Grundzügen erlernen. Weiterhin sollen sie sich mit den Fakten der Geschichtsschreibung vertraut machen, sie sollen Geschehnisse in ihren Zusammenhang einordnen können, sie sollen exemplarisch lernen. Ausdrücklich wird erwähnt, daß nicht alle geschichtlichen Themen behandelt werden sollen, was auch gar nicht möglich wäre. Der Schwerpunkt liegt auf der politischen Geschichte, aber auch „Fragestellungen der wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen, kulturellen und religiösen Entwicklung“ 4 sollen behandelt werden. „Die Lebenssituation von Frauen muß in allen geschichtlichen Zeitabschnitten berücksichtigt werden“ 5 . Doch sind diese Ziele wünschenswert? Sicher sollte eine Akzeptanz einer demokratischen Grundordnung das Ziel des Geschichtsunterrichts sein. Aber heißt dies auch, staatliche Gewalt befürworten zu müssen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- I Konzeption des Unterrichts
- 1. Ziele des Geschichtsunterrichts
- 1.1 Generelle Ziele des Geschichtsunterrichts
- 1.2 Ziele des Geschichtsunterrichts für die 7. Klassenstufe
- 2. Inhalte und Ziele - ein Spannungsfeld
- 3. Stoffverteilung
- 4. Stellung der Stunde im Rahmen der Einheit, Thema der Stunde
- 5. Psychologische Voraussetzungen des Unterrichts
- 6. Besonderheiten der Klasse
- 7. Stundenziel
- 8. Überlegungen zur Strukturierung der Unterrichtsstunde
- 9. Endgültige Struktur der Unterrichtsstunde
- 10. Strukturskizze
- 1. Ziele des Geschichtsunterrichts
- II Literaturverzeichnis
- III Versicherung über selbständige Erarbeitung des Entwurfs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Unterrichtsentwurf befasst sich mit der Entstehung der Stadt im Mittelalter und verfolgt das Ziel, den Schülerinnen und Schülern ein Verständnis für die Kontinuität und Entwicklung städtischer Strukturen in diesem historischen Kontext zu vermitteln.
- Die Bedeutung des Mittelalters für die Entwicklung städtischen Lebens
- Die Rolle von Handel und Handwerk in der Entstehung von Städten
- Die Herausforderungen und Chancen des städtischen Lebens im Mittelalter
- Die Beziehung zwischen Stadt und Land
- Die Entwicklung von städtischen Institutionen und Selbstverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1.1: Generelle Ziele des Geschichtsunterrichts: Dieses Kapitel befasst sich mit den allgemeinen Zielen des Geschichtsunterrichts, insbesondere in Bezug auf die Förderung demokratischer Grundwerte und das Verständnis von Gewaltmonopolen im Kontext verschiedener politischer Systeme.
- Kapitel 1.2: Ziele des Geschichtsunterrichts für die 7. Klassenstufe: Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifischen Ziele des Geschichtsunterrichts für die 7. Klasse, darunter das Interesse an der Geschichte wecken, das gemeinschaftliche Wirken von Menschen in der Auseinandersetzung mit der Natur zu vermitteln, und das Kennenlernen des Römischen Reiches, der Lebensformen und Herrschaftsbedingungen im Mittelalter sowie die Bedeutung der christlichen Religion in Europa.
- Kapitel 2: Inhalte und Ziele - ein Spannungsfeld: Dieses Kapitel beleuchtet die Spannung zwischen den Inhalten des Geschichtsunterrichts und den Zielen der Bildung für eine demokratische Gesellschaft. Es wirft kritische Fragen auf, wie die Akzeptanz staatlicher Gewalt mit der Förderung von Humanismus und Toleranz in Einklang gebracht werden kann.
- Kapitel 3: Stoffverteilung: Dieses Kapitel befasst sich mit der konkreten Stoffverteilung im Rahmen des Geschichtsunterrichts und thematisiert die Auswahl von relevanten Themen, die den Schülerinnen und Schülern ein breites Verständnis historischer Zusammenhänge vermitteln.
- Kapitel 4: Stellung der Stunde im Rahmen der Einheit, Thema der Stunde: Dieses Kapitel ordnet die aktuelle Unterrichtsstunde in den Gesamtzusammenhang der Unterrichtseinheit ein und stellt das Thema der Stunde vor.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte des Unterrichtsentwurfs sind: Mittelalter, Stadtentwicklung, Kontinuität, Entwicklung, Handel, Handwerk, politische Geschichte, soziale Geschichte, Frauengeschichte, Quellenarbeit, historische Arbeitsweisen, Demokratie, Gewaltmonopol, Humanismus, Toleranz.
- Quote paper
- Marc Herrmann (Author), 1998, Unterrichtsstunde: Die Entstehung der Stadt im Mittelalter. Kontinuität und Entwicklung (7. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40304