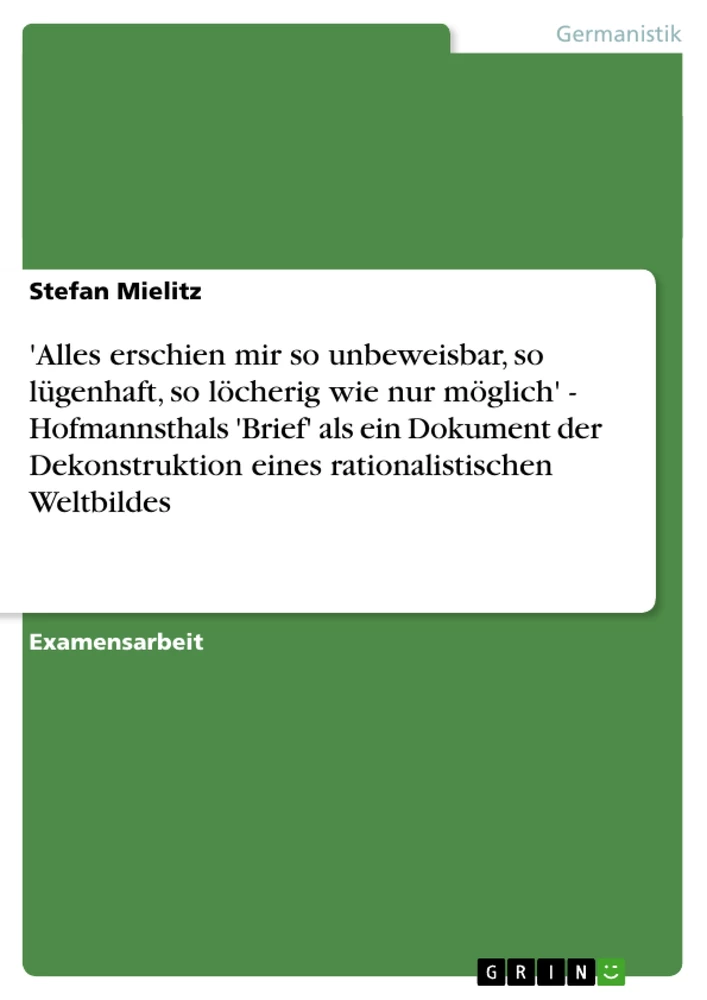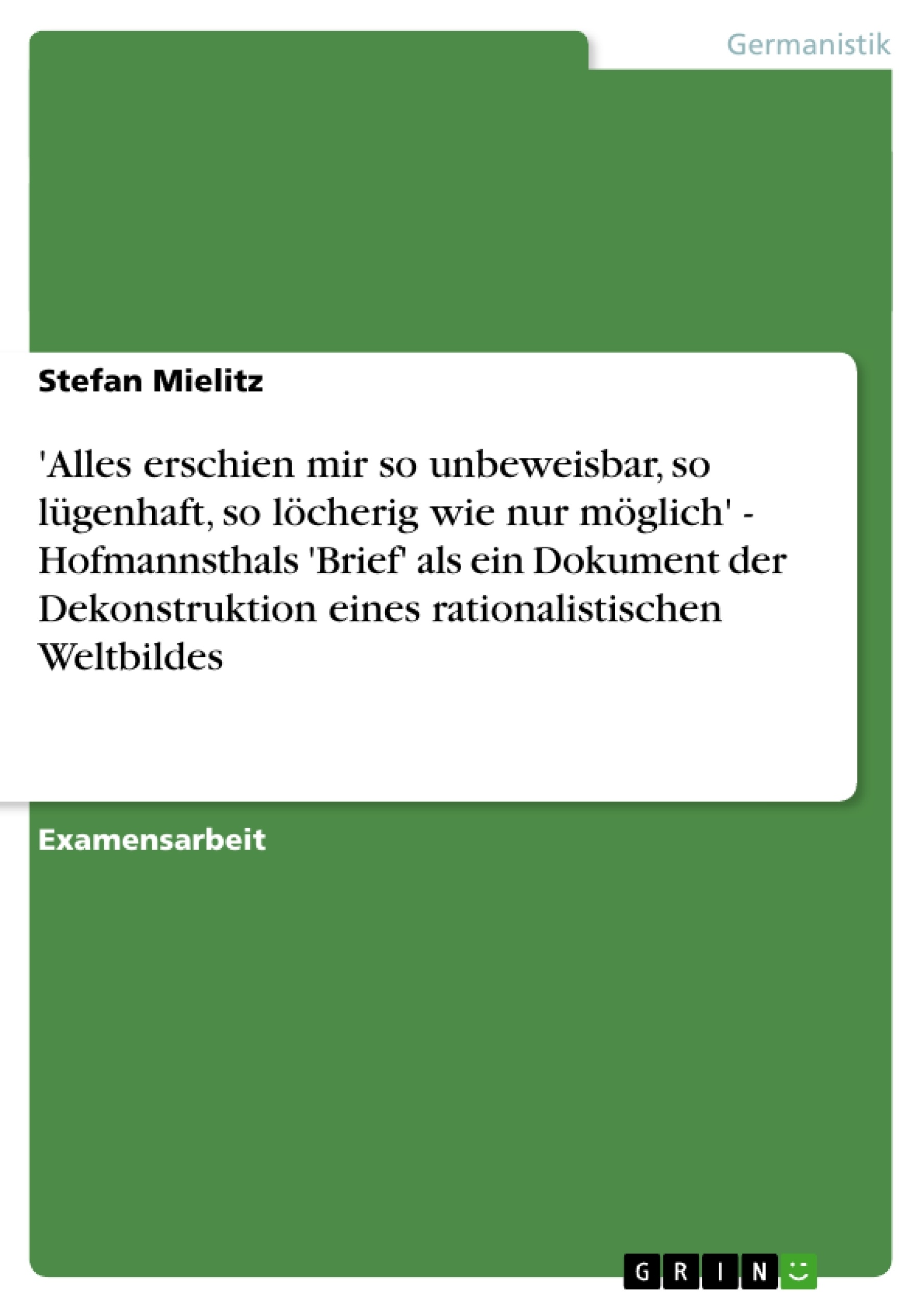Fast 300 Jahre liegen zwischen der Datierung des Briefes, dem 22. August 1603, welchen der Dichter Hugo von Hofmannsthal die fiktive Figur des Philipp Lord Chandos an den Empiriker Francis Bacon schreiben lässt, „um sich bei diesem Freunde wegen des gänzlichen Verzichtes auf literarische Betätigung zu entschuldigen“ (461), und der tatsächlichen Niederschrift des Textes im Jahre 1902. Nur diese zeitliche Diskrepanz von rund 300 Jahren, welche durch die grundlegenden Erfahrungen mit einem durch Rationalismus und Aufklärung bestimmten Weltbild geprägt sind, lässt diesen fiktiven Brief, eine „philos[ophische] Novelle[]“, wie Hofmannsthal schreibt, überhaupt erst möglich erscheinen. Über die Einsicht in die Unmöglichkeit einer Entschlüsselung der Welt und dem Erlangen einer allumfassenden Erkenntnis, welche sein übermächtiger Lehrer, Sir Francis Bacon, für möglich erachtete, stürzt Chandos in eine Krise, welcher er in jenem Brief Ausdruck verleiht. Und tatsächlich muss es sich um einen besonderen, bedeutsamen Brief handeln, betrachtet man die einleitenden Zeilen genau. Der Text bestätigt, dass es zwischen Chandos und Bacon in fernerer Vergangenheit eine intensive Korrespondenz gegeben haben muss, welche durch eine Veränderung im Erleben der Welt durch den Lord, ohne dass dies bis dato thematisiert wurde, abgerissen ist. Nun entschließt sich Chandos noch einmal zu schreiben. Seine ersten Worte verdeutlichen sogleich die Bedeutung, die er den folgenden Zeilen und seinem Adressaten beimisst. Er schreibt, dass dies „der Brief“ sei, den er „diesem Freunde“(461) sende. Durch die sprachliche Schaffung einer endgültigen Singularität des Ereignisses des Schreibens und der eindeutigen Bestimmtheit in Bezug auf den Adressaten, Francis Bacon, wird den Zeilen „dieses voraussichtlich letzten Briefes“ (472) eine für das Leben des Chandos grundlegende Relevanz eingeräumt. Der Brief wird damit Rück- und Ausblick zugleich. Hofmannsthal lässt Chandos, und man sollte sich hüten, wie dies oft geschehen ist, beide in Eins zu setzen und die Krise des Lords zu einer Krise des Dichters zu stilisieren, von einem verloren gegangenen Totalitätsgefühl berichten. Chandos erlebte „das ganze Dasein als eine große Einheit“ (463f.), in der er eine bruchlose Identität und unbezweifelte Erkenntnis fühlte. [...]
Inhaltsverzeichnis
-
- Der große Lehrmeister: Francis Bacon
- Die Pläne der Optimisten
- Die Methode der Optimisten
- Der Geist als ein Spiegel der Welt
- Das Gedächtnis als ein statischer Speicher der Welt
- Werkzeuge der Erkenntnis - Sprache und Rhetorik
- Der Nutzen verdammungswürdiger Metaphorik
-
- Das Bewusstwerden des Irrtums der Erkennbarkeit der Welt
- Das Eigenleben des Gedächtnis als Voraussetzung der Individuation
- Der Zerfall des versprachlichten Bewusstseins
- Eine sich ankündigende Krise
- (Nicht)-Möglichkeiten von Sprache und des menschlichen Erkenntnisvermögens
- Sprache als ein widerspruchsvolles Unding - Nietzsche
- Die Dekonstruktion des sprachlichen Individuums - Mauthner
- Zerfall der Kongruenz von Sprache und Welt in Ein Brief
- Verweigerung der Prämissen der Sprachkritik bei Hofmannsthal
- Das Scheitern der Pläne und der Methode
-
- Neue Wege der Erkenntnis
- Die Sprache der guten Augenblicke
- Das Besondere im Allgemeinen – Die Synthesekraft des Mythos
- Die Gestaltungskraft der Metaphorik jenseits des wissenschaftlichen Diskurses
- Rück- und Ausblick
- Der Segen des Bildlichen - Hamann
- Die hitzige Flüssigkeit der Bildermasse - Nietzsche
- Beständig das Fremdeste paarend - Hofmannsthal
- Die Vergangenheit als Schlüssel zur Gegenwart und Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Hugo von Hofmannsthals „Brief“ als ein Dokument der Dekonstruktion eines rationalistischen Weltbildes. Der Text untersucht die Krise des Protagonisten, Philipp Lord Chandos, der an der Unmöglichkeit einer adäquaten sprachlichen Abbildung der Welt zweifelt. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen dieser Zweifel auf Chandos' Denken und die damit verbundene Dekonstruktion seiner ursprünglichen Weltanschauung.
- Die Dekonstruktion eines rationalistischen Weltbildes
- Die Krise der Sprache und ihre Fähigkeit zur Abbildung der Welt
- Der Einfluss der sprachlichen Krise auf das menschliche Denken und Erleben
- Die Rolle des Gedächtnisses und der Metaphorik in der Erkenntnisgewinnung
- Die Suche nach neuen Wegen der Erkenntnis jenseits des wissenschaftlichen Diskurses
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: „Die „gemeinsamen Tage schöner Begeisterung“ – Das Erleben der Einheit der Welt bei Bacon und Chandos“: Dieses Kapitel beleuchtet die gemeinsame Weltanschauung von Francis Bacon und Philipp Lord Chandos, die in ihrer frühen Zusammenarbeit von einer Einheit der Welt und der Möglichkeit ihrer vollständigen Erfassung überzeugt waren. Es wird die Methode und der Ansatz der Optimisten, wie Bacon und Chandos sich selbst nannten, anhand ihrer Theorien und Werke erläutert.
- Kapitel II: „Es zerfiel mir alles in Teile“ – Der Verlust der Einheit eines konsistenten Weltbildes“: Dieses Kapitel beschreibt die Krise, in die Chandos stürzt, als er die Unmöglichkeit der vollständigen sprachlichen Abbildung der Welt erkennt. Der Zerfall seines ursprünglichen Weltbildes wird anhand seiner Zweifel an der Sprache, des Gedächtnisses und des menschlichen Erkenntnisvermögens dargestellt. Dieser Abschnitt beleuchtet die Ansätze von Nietzsche und Mauthner zur Kritik an der Sprache und analysiert Hofmannsthals Reaktion auf diese Kritik im „Brief“.
- Kapitel III: „Ein Fluidum des Lebens und Todes, des Traumes und Wachens\" - Das Erahnen des Doppelsinns“: In diesem Kapitel erkundet Chandos neue Wege der Erkenntnis, die jenseits der Grenzen der Sprache liegen. Er konzentriert sich auf die Bedeutung von Metaphorik und Mythos, die das Denken und Erleben bereichern und neue Perspektiven eröffnen können. Der Abschnitt analysiert die Ansätze von Hamann, Nietzsche und Hofmannsthal zur Bedeutung des Bildlichen und des Mythischen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter des Textes sind: Dekonstruktion, Rationalismus, Weltbild, Sprache, Erkenntnis, Gedächtnis, Metaphorik, Mythos, Krise, Individuation, Einheit, Zweifel, Sprachkritik, Nietzsche, Mauthner, Hamann, Hofmannsthal.
- Quote paper
- Stefan Mielitz (Author), 2005, 'Alles erschien mir so unbeweisbar, so lügenhaft, so löcherig wie nur möglich' - Hofmannsthals 'Brief' als ein Dokument der Dekonstruktion eines rationalistischen Weltbildes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40192