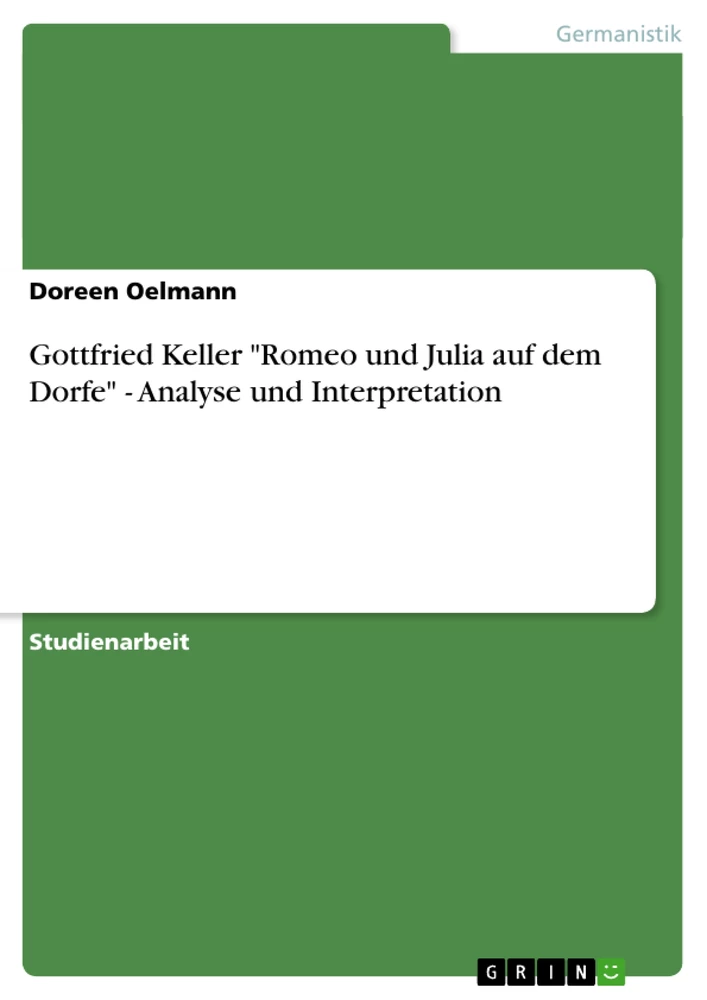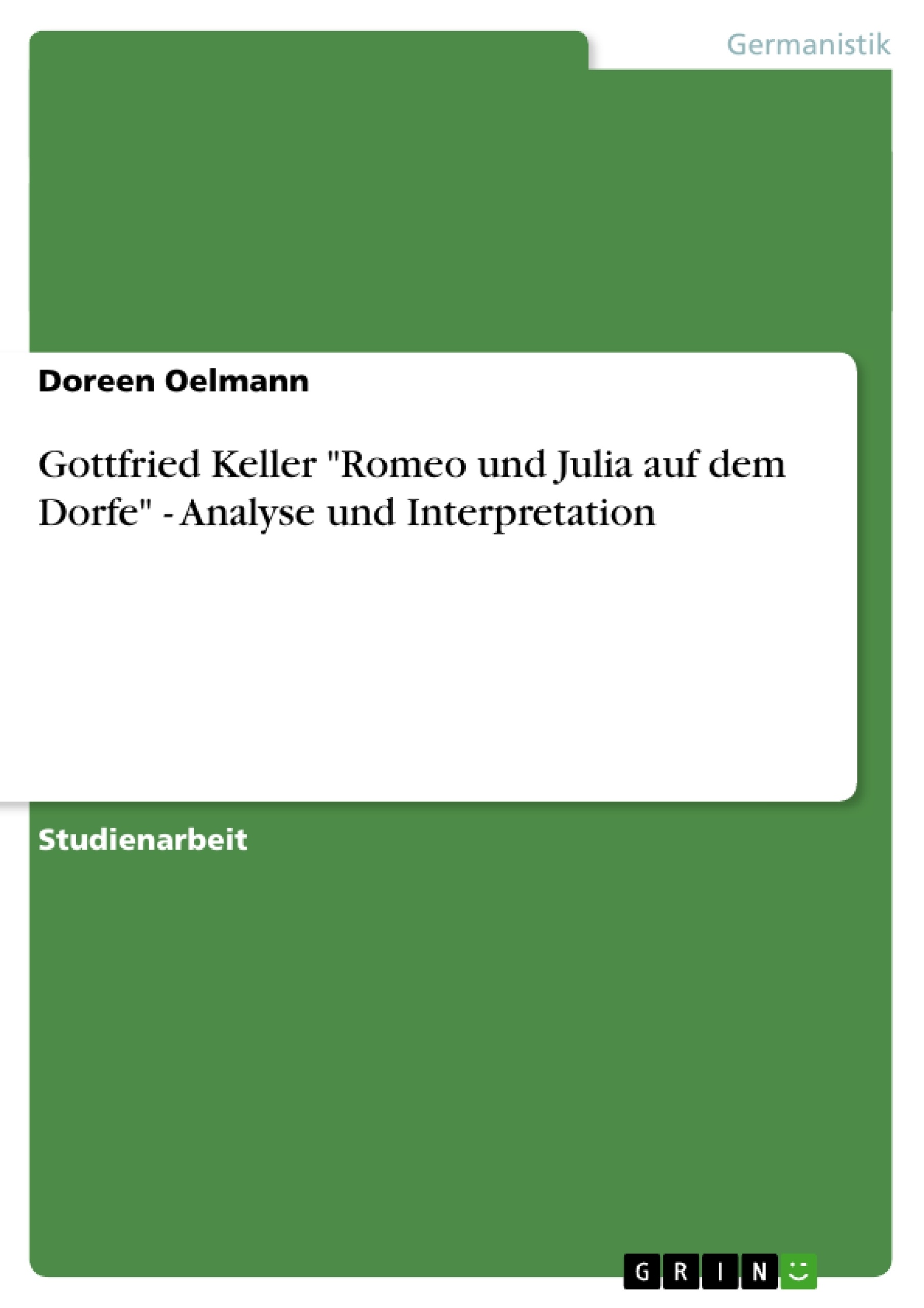Die Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe" von Gottfried Keller (1819-1890) 1
ist 1856 innerhalb der Sammlung „Die Leute von Seldwyla" erschienen.2
Zunächst wollte Keller den Stoff dieser Novelle als Gedicht verarbeiten,
entschloss sich jedoch später dazu, ihn in Prosaform zu fassen.3
Obwohl er sich mit seiner Erzählung an Shakespeares Drama anlehnt, geht er auf
ein tatsächliches Ereignis zurück, dass er aus der "Züricher Freitagszeitung" vom
3. 9. 1847 entnahm.
Sachsen. - Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren
und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer Leute, die aber in einer tödlichen
Feindschaft lebten, und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten. Am 15.
August begaben sich die Verliebten in eine Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügten,
tanzten daselbst bis nachts 1 Uhr und entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man die
Leichen beider Liebenden auf dem Felde liegen; sie hatten sich durch den Kopf
geschossen.4
Trotz dieses Zeitungsartikels begründet Keller, in seinem Vorwort, warum er
diesen Stoff verwendet hat, obwohl dieser schon oftmals in der Literatur
verarbeitet wurde.
Diese Geschichte zu erzählen würde eine müßige Nachahmung sein, wenn sie nicht auf
einem wirklichen Vorfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede jener
Fabeln wurzelt, auf welche die großen alten Werke gebaut sind. Die Zahl solcher Fabeln ist
mäßig; aber stets treten sie in neuem Gewande wieder in Erscheinung und zwingen alsdann
die Hand, sie festzuhalten. (Seite 3)5
Mit dem "neuen Gewande" meint er die bäuerlichkleinbürgerliche Lebensform in
seiner Zeit des 19. Jahrhunderts, deren Werte und Normen, und nicht der bloße
Irrtum wie in Shakespeares „Romeo und Julia", zum Tode der beiden
Hauptfiguren führen.
Ob Keller seinem eigenen Anspruch gerecht wird, soll in der vorliegenden
Hausarbeit dargestellt werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Anthropologische der Novelle
- Kellers Gesellschaftskritik
- Die Manipulation des Lesers
- Die Etappen der Dekadenz
- Illusion und Desillusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ im Hinblick auf ihre anthropologischen Aspekte, die Gesellschaftskritik und die manipulative Erzähltechnik. Die Arbeit untersucht, wie Keller die Geschichte als ein universelles menschliches Schicksal darstellt und wie er die sozialen Bedingungen und Machtstrukturen seiner Zeit kritisiert.
- Das Anthropologische: Die Darstellung des menschlichen Schicksals als universelles Muster.
- Gesellschaftskritik: Kritik an den sozialen Ungleichheiten und Machtstrukturen des 19. Jahrhunderts.
- Erzähltechnik: Die Manipulation des Lesers durch die Erzählperspektive und die Auswahl der Details.
- Dekadenz: Die Darstellung des Verfalls traditioneller Werte und Normen.
- Illusion und Desillusion: Der Kontrast zwischen den romantischen Idealen und der harten Realität.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Entstehungsgeschichte von Kellers Novelle ein, beleuchtet die literarischen Vorbilder und den Bezug zu einem realen Ereignis. Sie umreißt die Intention der Arbeit, Kellers Anspruch, ein universelles menschliches Schicksal im Kontext des 19. Jahrhunderts darzustellen, zu überprüfen.
Das Anthropologische der Novelle: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des menschlichen Schicksals in der Novelle. Keller betont die Übertragbarkeit der Geschichte auf alle Menschen und Zeiten, indem er die Protagonisten nicht als Individuen, sondern als Typen darstellt. Die Namen Romeo und Julia werden zwar verwendet, doch die Figuren Sali und Vreni verkörpern ein archetypisches Schicksal jenseits konkreter Namen. Das Motiv des universellen Schicksals wird durch die Beschreibung der Figuren als Typen einer Gesellschaft weitergeführt, ihr Handeln wird als stellvertretend für die Mehrzahl der Gesellschaft präsentiert. Der "Schwarze Geiger" fungiert ebenfalls als austauschbare Figur, repräsentativ für alle Heimatlosen.
Kellers Gesellschaftskritik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gesellschaftskritik in der Novelle. Obwohl die Handlung außerhalb von Seldwyla spielt, beeinflussen die Bewohner und Institutionen von Seldwyla das Geschehen. Keller lenkt den Leser durch sein Vorwort zunächst in die Irre. Das Kapitel würde detailliert die soziale Ungleichheit und Machtstrukturen des 19. Jahrhunderts analysieren, die zum tragischen Ende der Protagonisten beitragen.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe, Novelle, Anthropologie, Gesellschaftskritik, Erzähltechnik, Manipulation, Dekadenz, Illusion, Desillusion, 19. Jahrhundert, Bauerngesellschaft, sozialer Konflikt.
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried Kellers "Romeo und Julia auf dem Dorfe"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit zu Gottfried Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert Kellers Novelle unter verschiedenen Aspekten: die anthropologischen Aspekte (Darstellung des menschlichen Schicksals), die Gesellschaftskritik (soziale Ungleichheiten und Machtstrukturen des 19. Jahrhunderts), die manipulative Erzähltechnik, die Darstellung von Dekadenz und den Kontrast zwischen Illusion und Desillusion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung (Kontextualisierung der Novelle), zur anthropologischen Betrachtung (universelle Gültigkeit des Schicksals), zur Gesellschaftskritik Kellers (soziale Ungleichheiten als Ursache des tragischen Ausgangs), und weitere Kapitel die sich mit der Erzähltechnik, Dekadenz und Illusion/Desillusion auseinandersetzen.
Wie wird die Erzähltechnik in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht, wie Keller durch die Erzählperspektive und die Auswahl von Details den Leser manipuliert und seine Wahrnehmung der Geschichte beeinflusst. Das Vorwort Kellers, welches den Leser in die Irre führt, wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe, Novelle, Anthropologie, Gesellschaftskritik, Erzähltechnik, Manipulation, Dekadenz, Illusion, Desillusion, 19. Jahrhundert, Bauerngesellschaft, sozialer Konflikt.
Was ist das Hauptanliegen der wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" im Hinblick auf ihre anthropologischen Aspekte, ihre Gesellschaftskritik und ihre manipulative Erzähltechnik zu analysieren und den Anspruch Kellers auf ein universelles menschliches Schicksal zu überprüfen.
Wie wird das "universelle menschliche Schicksal" in der Novelle dargestellt?
Die Arbeit argumentiert, dass Keller das menschliche Schicksal als universelles Muster darstellt, indem er die Protagonisten nicht als individuelle Personen, sondern als archetypische Typen darstellt, deren Handeln stellvertretend für eine ganze Gesellschaft steht. Die Verwendung der Namen "Romeo" und "Julia" wird in diesem Zusammenhang kritisch betrachtet.
Welche Rolle spielt die Gesellschaftskritik in der Novelle?
Die Gesellschaftskritik befasst sich mit den sozialen Ungleichheiten und Machtstrukturen des 19. Jahrhunderts, die zum tragischen Ende der Protagonisten beitragen. Die Bewohner und Institutionen von Seldwyla, obwohl die Handlung außerhalb stattfindet, beeinflussen das Geschehen und werden in der Analyse berücksichtigt.
- Quote paper
- Doreen Oelmann (Author), 2003, Gottfried Keller "Romeo und Julia auf dem Dorfe" - Analyse und Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40103