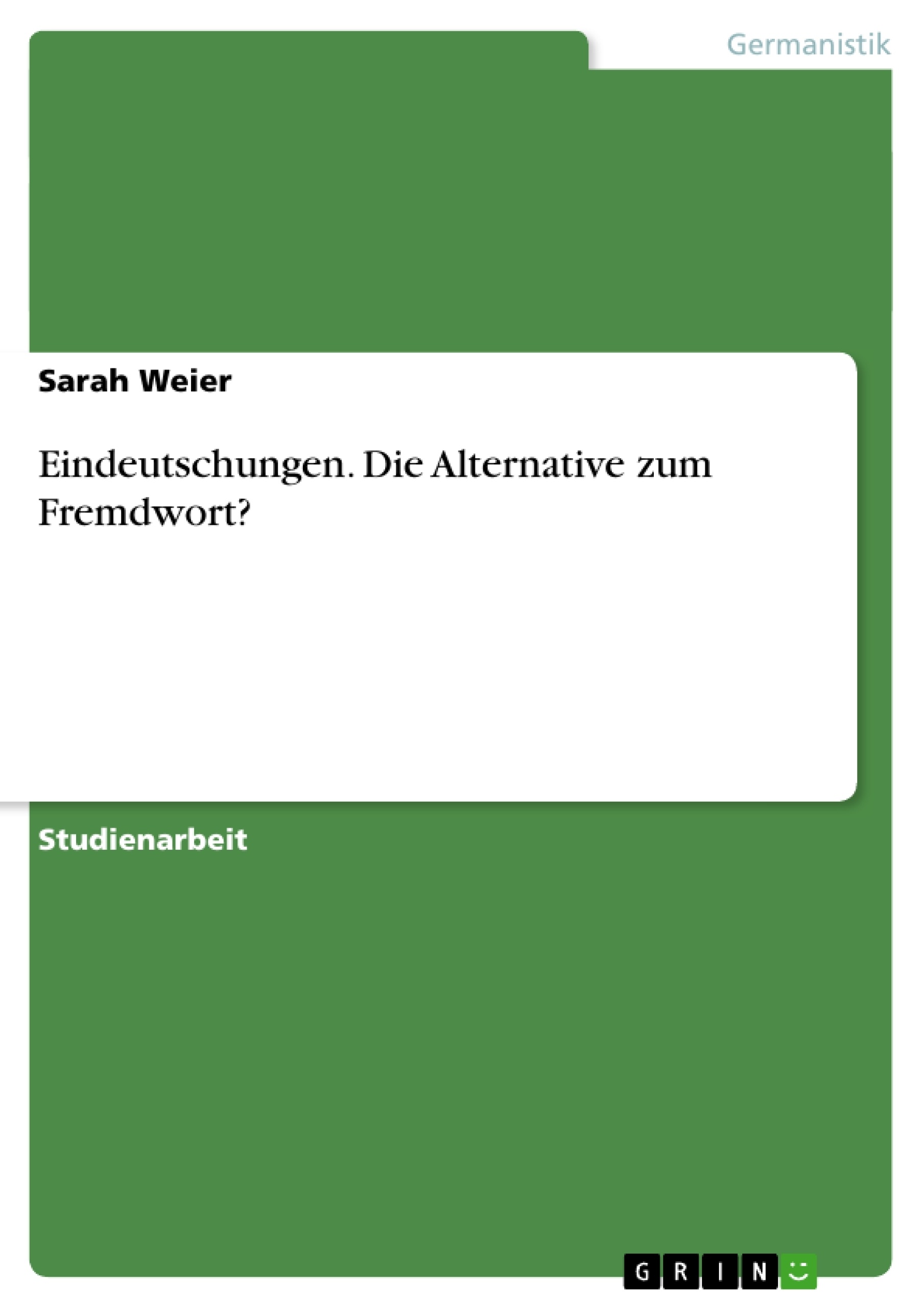So beklagt man einerseits, das Deutsche passe sich etwa in der Computerterminologie zu sehr dem Englischen an. Ihm sei die Kraft zur Integration von Anglizismen verlorengegangen, und eine Sprache ohne Integrationskraft sei eine tote Sprache [...]. Andererseits wird nach Internationalität gerufen und dem Deutschen seine Eigenbrötelei vorgehalten.“ 1 Dieses Zitat pointiert die Diskussion um die Eindeutschung von Fremdworten 2 .
Damit ist auch das Thema dieser Arbeit benannt: Die Eindeutschung von Fremdworten aus historischer, linguistischer und sprachpraktischer Perspektive. Die Arbeit basiert auf einem zuvor gehaltenen Referat. Die Gliederung wird dabei im Großen und Ganzen beibehalten; Anregungen aus der Diskussion fließen in die nochmalige Beschäftigung mit dem Thema ein.
Es wird im Laufe dieser Arbeit deutlich werden, dass die Eindeutschung kein rein linguistisches Problem darstellt.. Es spielen neben sprachwissenschaftlichen auch kulturelle und gesellschaftliche Aspekte in diese Thematik mit hinein. Der folgende Abschnitt zur historischen Entwicklung der Purismus- Bewegung in Deutschland bietet einen Einstieg in die Thematik. Die Tendenzen zur Sprachreinigung werden dabei für drei Zeitabschnitte, d.h. für das 17./ 18. Jahrhundert, das 19./ 20. Jahrhundert und die Gegenwart betrachtet.
Im dritten Abschnitt werden die linguistischen Methoden zu Bildung von Eindeutschungen mit erläuternden Beispielen vorgestellt.
Der vierte Abschnitt stellt schließlich die Frage: Warum sich manche Eindeutschungen nicht durchsetzen? Und andere eben doch. Nach Schwerpunkten geordnet sollen hier die verschiedenen Gründe für den Gebrauch von Fremdworten und die Notwendigkeit von Eindeutschungen vorgetragen werden.
Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse kurz zusammengefaßt. Damit wenden wir uns dem ersten thematischen Schwerpunkt, dem historischen Überblick über den Sprachpurismus zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Purismus-Bewegungen in Deutschland
- Sprachreinigung im 17. und 18. Jahrhundert
- Völkischer Purismus im 19. und 20. Jahrhundert
- Träger der Sprachpflege in der Gegenwart
- Entlehnungsprozesse
- Lehnprägung
- Lehnbedeutung
- Lehnübersetzung
- Lehnübertragung
- Lehnschöpfung
- Warum sich manche Eindeutschungen nicht durchsetzen?
- Das Prestige der Quellsprache
- Praktikabilität des Purismus
- Mehrwert der fremdsprachlichen Bezeichnung
- treffende Bildlichkeit
- Integration ins Flexionssystem
- Zusammenfassung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eindeutschung von Fremdwörtern aus historischer, linguistischer und sprachpraktischer Perspektive. Sie beleuchtet die Entwicklung des Sprachpurismus in Deutschland und analysiert die linguistischen Methoden der Eindeutschung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Gründen für den Erfolg oder Misserfolg von Eindeutschungen.
- Historische Entwicklung des Sprachpurismus in Deutschland
- Linguistische Methoden der Eindeutschung
- Faktoren, die den Erfolg von Eindeutschungen beeinflussen
- Der Einfluss kultureller und gesellschaftlicher Aspekte auf die Sprachentwicklung
- Die Rolle des Sprachpurismus in der nationalen Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Problematik der Arbeit vor: den Konflikt zwischen der Anpassung des Deutschen an internationale Einflüsse und dem Bestreben nach sprachlicher Eigenständigkeit, verdeutlicht durch die Diskussion um die Eindeutschung von Fremdwörtern. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und betont den interdisziplinären Charakter des Themas, welches linguistische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte umfasst. Die Einleitung dient als Einführung in die Thematik und umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit.
Purismus-Bewegungen in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Geschichte des Sprachpurismus in Deutschland in drei Phasen: das 17. und 18. Jahrhundert, das 19. und 20. Jahrhundert und die Gegenwart. Es zeigt, wie der Sprachpurismus zunächst primär der Etablierung einer hochsprachlichen Norm des Deutschen diente, während er im 19. und 20. Jahrhundert zunehmend mit nationalistischen und ideologischen Zielen verbunden wurde. Der Einfluss von Sprachgesellschaften und Vereinen wie der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ und dem „Allgemeinen Deutschen Sprachverein“ wird beleuchtet, sowie die Rolle des Sprachpurismus im Nationalsozialismus. Die Kapitel beschreibt, wie sich die Ziele und die Methoden des Sprachpurismus im Laufe der Zeit gewandelt haben.
Entlehnungsprozesse: Dieser Abschnitt befasst sich mit den linguistischen Methoden der Eindeutschung. Es werden verschiedene Verfahren der Wortbildung erläutert, wie Lehnprägung, Lehnbedeutung, Lehnübersetzung, Lehnübertragung und Lehnschöpfung, jeweils anhand konkreter Beispiele. Das Kapitel analysiert, wie Fremdwörter in die deutsche Sprache integriert werden oder wie versucht wird, sie durch deutsche Entsprechungen zu ersetzen, und differenziert dabei zwischen verschiedenen Integrations- und Anpassungsprozessen.
Warum sich manche Eindeutschungen nicht durchsetzen?: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für den unterschiedlichen Erfolg von Eindeutschungen. Es werden verschiedene Faktoren analysiert, wie z.B. das Prestige der Quellsprache, die Praktikabilität des Neubildungs, der Mehrwert der fremdsprachigen Bezeichnung, die Bildlichkeit des Ausdrucks und die Integration in das deutsche Flexionssystem. Das Kapitel beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen linguistischen, pragmatischen und soziokulturellen Aspekten, die den Erfolg oder Misserfolg einer Eindeutschung beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Eindeutschung, Sprachpurismus, Fremdwörter, Lehnwörter, Sprachpflege, Sprachreinigung, nationale Identität, Linguistik, Wortbildung, Entlehnungsprozesse, Sprachgeschichte, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachpurismus und Eindeutschung von Fremdwörtern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Eindeutschung von Fremdwörtern aus historischer, linguistischer und sprachpraktischer Perspektive. Sie beleuchtet die Entwicklung des Sprachpurismus in Deutschland und analysiert die linguistischen Methoden der Eindeutschung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Gründen für den Erfolg oder Misserfolg von Eindeutschungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Sprachpurismus in Deutschland, die linguistischen Methoden der Eindeutschung, die Faktoren, die den Erfolg von Eindeutschungen beeinflussen, den Einfluss kultureller und gesellschaftlicher Aspekte auf die Sprachentwicklung und die Rolle des Sprachpurismus in der nationalen Identitätsbildung.
Welche Phasen des Sprachpurismus in Deutschland werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Phasen des Sprachpurismus in Deutschland: das 17. und 18. Jahrhundert, das 19. und 20. Jahrhundert und die Gegenwart. Dabei wird der Wandel der Ziele und Methoden des Sprachpurismus im Laufe der Zeit gezeigt.
Welche linguistischen Methoden der Eindeutschung werden erläutert?
Die Arbeit erläutert verschiedene Verfahren der Wortbildung wie Lehnprägung, Lehnbedeutung, Lehnübersetzung, Lehnübertragung und Lehnschöpfung, jeweils anhand konkreter Beispiele. Es wird analysiert, wie Fremdwörter in die deutsche Sprache integriert werden oder wie versucht wird, sie durch deutsche Entsprechungen zu ersetzen.
Warum setzen sich manche Eindeutschungen nicht durch?
Die Arbeit untersucht verschiedene Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg von Eindeutschungen beeinflussen, wie z.B. das Prestige der Quellsprache, die Praktikabilität der Neubildung, der Mehrwert der fremdsprachigen Bezeichnung, die Bildlichkeit des Ausdrucks und die Integration in das deutsche Flexionssystem. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen linguistischen, pragmatischen und soziokulturellen Aspekten werden beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Purismus-Bewegungen in Deutschland, ein Kapitel zu Entlehnungsprozessen, ein Kapitel zu den Gründen für den unterschiedlichen Erfolg von Eindeutschungen und einen Schluss.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eindeutschung, Sprachpurismus, Fremdwörter, Lehnwörter, Sprachpflege, Sprachreinigung, nationale Identität, Linguistik, Wortbildung, Entlehnungsprozesse, Sprachgeschichte, Deutschland.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Die Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der linguistische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte umfasst. Die Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz genauer.
- Quote paper
- Sarah Weier (Author), 2005, Eindeutschungen. Die Alternative zum Fremdwort?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40077