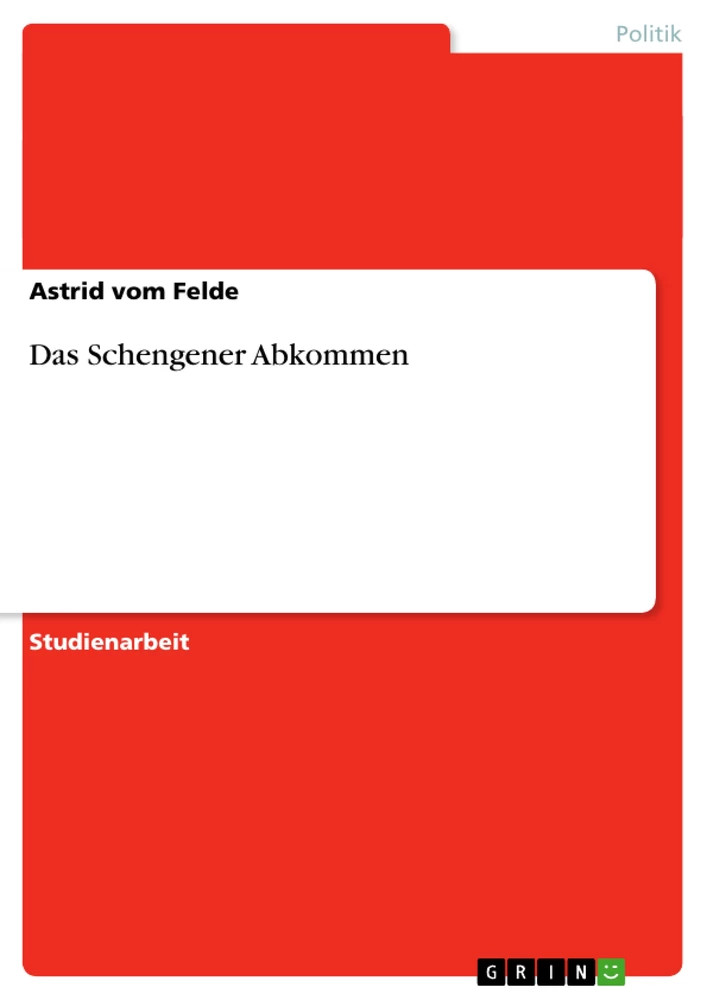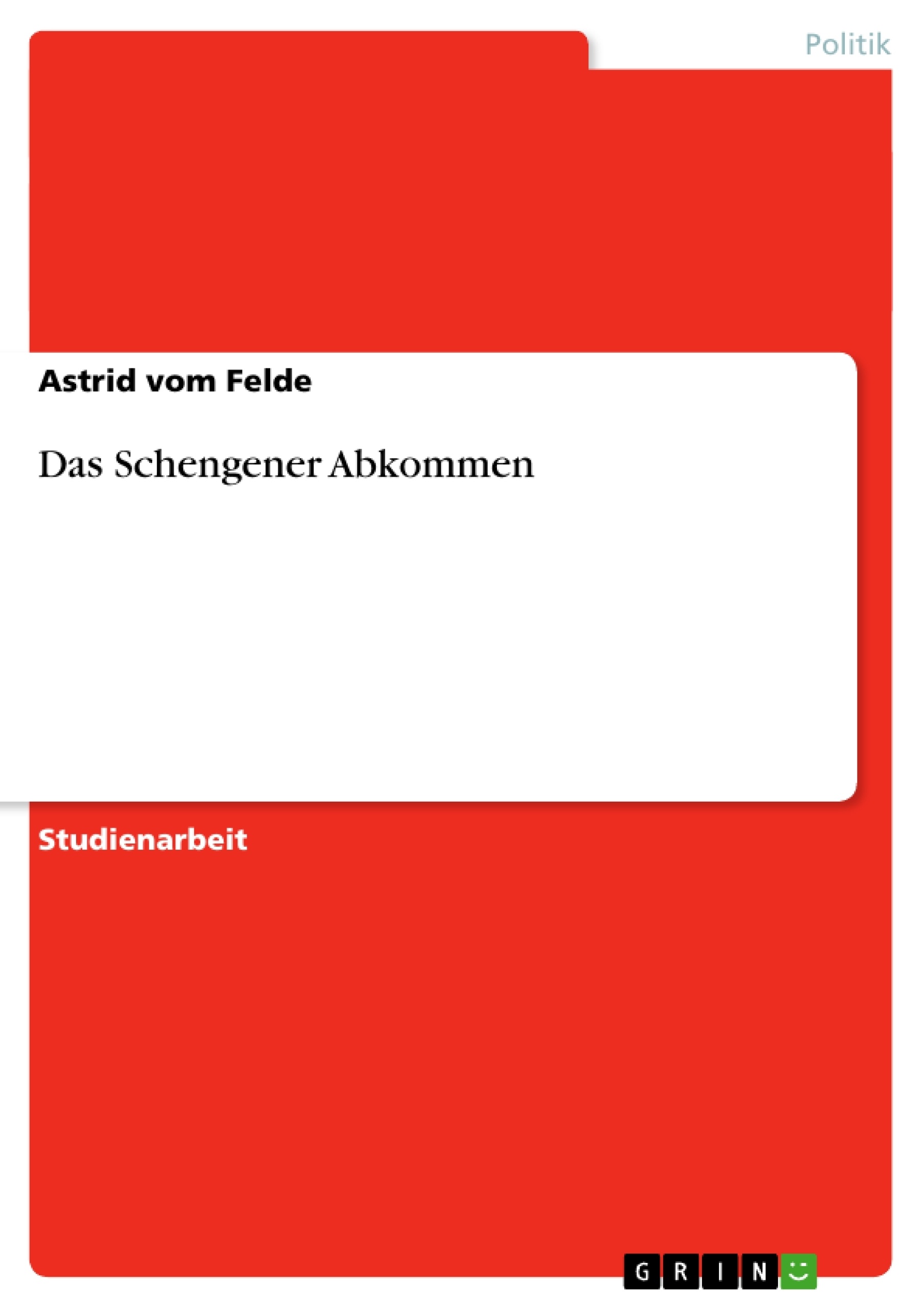Die 25 Staaten der Europäischen Union befinden sich momentan in einem Prozess der Transformation vom jeweiligen Nationalstaat zu einem EUStaatenverbund. Wer in München am Flughafen ankommt, findet einen eigenen Eingang für Reisende aus den EU-Staaten sowie Island, Norwegen und Liechtenstein und einen zweiten für Reisende aus Drittstaaten vor.1 Hier wird die Entwicklung zu neuen Außengrenzen offensichtlich. Dieser neue Grenzziehungsprozess hatte 1985 seinen Anfang. Er entstand aus dem Wunsch heraus, eine europäische Identität durch den freien Personenverkehr zu fördern.2 Gleichzeitig jedoch sollte die innere Sicherheit unter anderem durch Schutz der gemeinsamen Außengrenzen gewährleistet bleiben. Damals unterschrieben die Innen- und Justizminister der Niederlande, Belgiens, Luxemburgs, Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland in Schengen/Luxemburg das „Schengener Abkommen“. Dieses Abkommen sollte die Einführung des Binnenmarktes begleiten: nicht nur der grenzenlos freie Austausch von Waren und Kapital, auch die EG-Bürger sollten im neu geschaffenen Markt ohne Zollkontrollen reisen können. Das zwischenstaatliche Abkommen sieht den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den Binnengrenzen der Mitgliedstaaten vor. Ein Zusatzabkommen regelt die Behandlung von Asylanträgen und die Zusammenarbeit der Polizeibehörden über die Grenzen hinaus. Der ursprünglich veranschlagte Zeitpunkt der Grenzöffnung für den Personenreiseverkehr (1990) musste mehrfach verschoben werden. 1995 trat das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens (Schengener Durchführungsübereinkommen – SDÜ) dann aber in Kraft. Vorab jedoch musste das „Schengener Informationssystem“ (SIS), welches schengenweite Personen- und Sachdaten umfasst, eingerichtet werden. Es erleichtert die grenzüberschreitende Verbrechensbekämpfung. Es stellt sich nunmehr die Frage, fast 10 Jahre nach Inkrafttreten des SDÜ, ob die Erwartungen an „Schengen“ tatsächlich erfüllt wurden oder ob gar die Befürchtungen der „Schengen“-Gegner, dass die Binnengrenzöffnung den Verlusts der inneren Sicherheit zur Folge haben werde, Realität geworden sind. 1 http://www.munich-airport.de/DE/Areas/StandardSeiten/Drucken/index.jsp 2 http://zoom.mediaweb.at/zoom_697/schengen.html
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schengen-Mitgliedstaaten
- Anfänge
- Neuere Beitritte
- Geschichtlicher Hintergrund
- Entstehungsgeschichte
- Entwicklung
- Inhalt des Schengener Durchführungsübereinkommens
- Schengen und das Verhältnis zum EG-/EU-Recht
- Schengen-Besitzstand
- Sonderstellung Dänemarks, des Verein. Königreichs und Irlands
- Institutionelle Veränderung
- Sicherheitsaspekt
- Binnengrenzkontrollen in Ausnahmefällen
- SIS
- Polizeiliche Zusammenarbeit
- Weitere Ausgleichsmaßnahmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Schengener Abkommen und seine Auswirkungen auf die Europäische Union. Sie untersucht die historische Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die praktischen Implikationen des Abkommens sowie die Herausforderungen, die sich aus der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen ergeben.
- Die Entstehung und Entwicklung des Schengener Abkommens
- Der Inhalt und die Umsetzung des Schengener Durchführungsübereinkommens
- Die Auswirkungen von Schengen auf das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und die europäische Integration
- Die Bedeutung des Sicherheitsaspekts und die Herausforderungen, die sich aus dem freien Personenverkehr ergeben
- Die zukünftige Entwicklung von Schengen und die Erweiterung auf neue Mitgliedstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Schengener Abkommens ein und beschreibt die Transformation der Europäischen Union hin zu einem Staatenverbund. Das zweite Kapitel beleuchtet die Mitglieder des Schengener Abkommens, beginnend mit den Gründungsstaaten und den Beitritten neuer Mitglieder, einschließlich der EU-Erweiterung von 2004.
Kapitel 3 behandelt den historischen Hintergrund des Schengener Abkommens und seine Entwicklung von der Idee einer Passunion bis zum Saarbrückener Abkommen und schließlich zum Schengener Übereinkommen. Kapitel 4 erläutert den Inhalt des Schengener Durchführungsübereinkommens, das den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Mitgliedstaaten regelt.
Kapitel 5 untersucht die Beziehung zwischen Schengen und dem EG-/EU-Recht, einschließlich des Schengen-Besitzstands, der Sonderstellung Dänemarks, des Vereinigten Königreichs und Irlands sowie der institutionellen Veränderungen. Schließlich befasst sich Kapitel 6 mit dem Sicherheitsaspekt von Schengen, den Binnengrenzkontrollen in Ausnahmefällen, dem SIS, der polizeilichen Zusammenarbeit und weiteren Ausgleichsmaßnahmen.
Schlüsselwörter
Schengener Abkommen, Schengen-Mitgliedstaaten, freier Personenverkehr, Binnengrenzkontrollen, innere Sicherheit, europäische Integration, EU-Erweiterung, SIS (Schengener Informationssystem), Durchführungsübereinkommen, EG-Recht, EU-Recht.
- Quote paper
- Astrid vom Felde (Author), 2005, Das Schengener Abkommen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39915