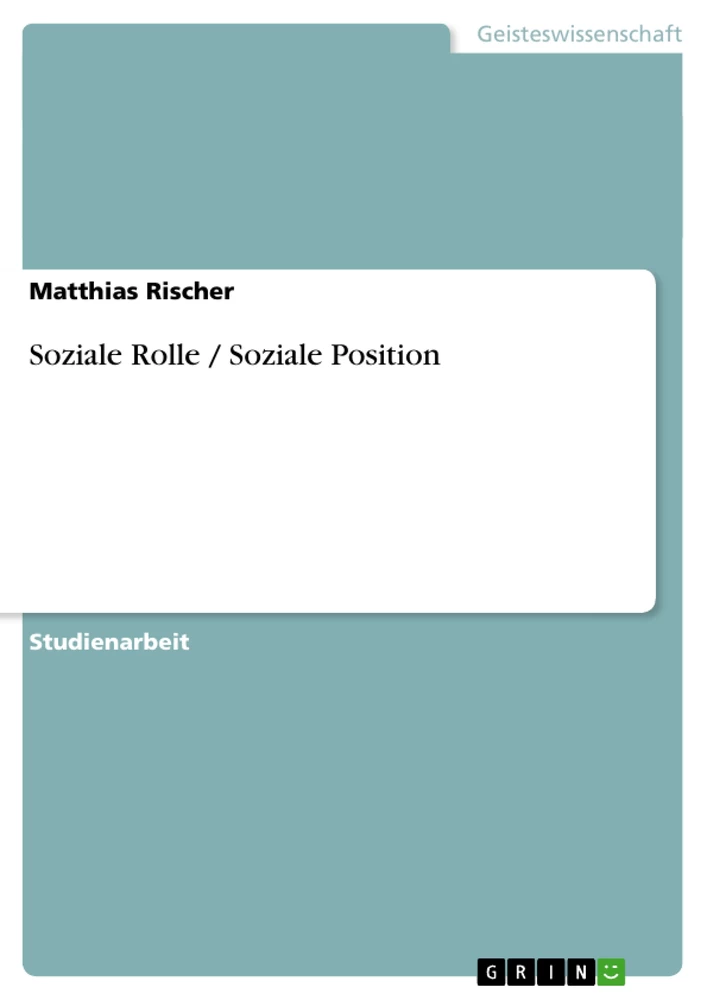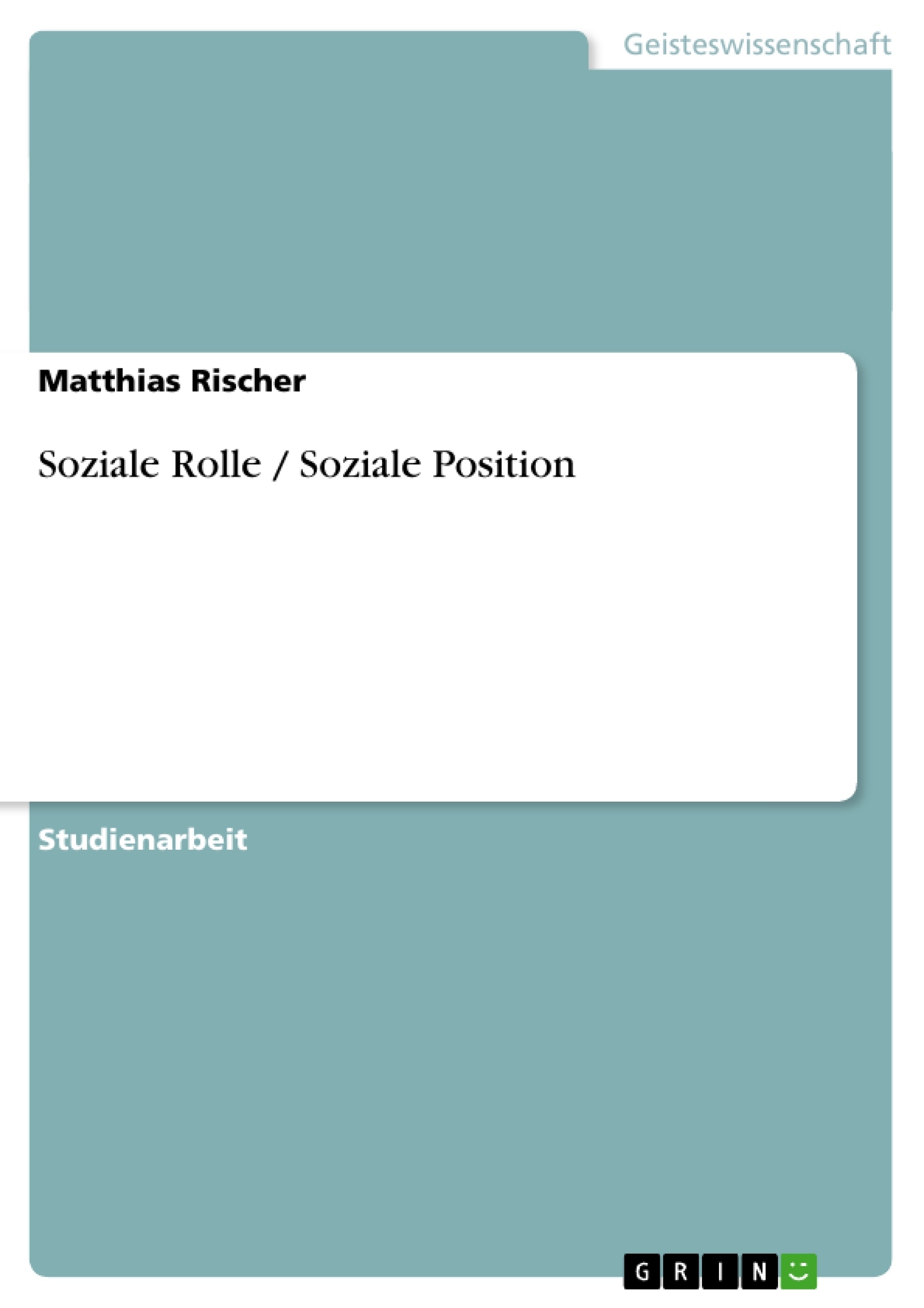In dieser Abhandlung soll es darum gehen, zu erklären, wie soziale Interaktion funktioniert. Die Begriffe „Rolle“ und „Position“ sollen als feste Begriffe dazu dienen, dynamische Prozesse in einer statischen Relation zu veranschaulichen. Ziel der unter Punkt 4 angeführten Rollentheorien ist, zu erklären, wie Interaktion trotz Individuation und prinzipiell nur begrenzter Erkennbarkeit des anderen dennoch möglich ist. Als Gegebenheit werden Individualität, Sozialität und gegenseitige Abhängigkeit der Menschen untereinander angenommen. Der Positionsbegriff stellt den einzelnen in den Zusammenhang von Organisationssystemen, der Rollenbegriff in den von Interaktionssystemen. Der Begriff „soziale Rolle“ wird definiert als „ein Bündel normativer Verhaltenserwartungen, die von einer Bezugsgruppe oder mehreren Bezugsgruppen an Inhaber bestimmter sozialer Positionen herangetragen werden. Rollen sorgen für ein regelmäßiges, vorhersagbares Verhalten als Voraussetzung für kontinuierlich planbare Interaktionen und erfüllen somit eine allgemeine soziale Orientierungsfunktion.“ Die Verhaltenserwartungen werden zwar an Individuen herangetragen, beziehen sich aber auf die sozialen Positionen, die die Individuen einnehmen, sind also auf Individuen als Positionsträger gerichtet. Die Bezugsgruppen erwarten von dem Positionsträger, daß er bestimmte Dinge tut, andere unterläßt. „Sie sind die Regisseure für sein Rollenspiel im wirklichen Leben. Sie schauen darauf, daß er das tut, was man ihrer Meinung nach in seiner Position tun sollte, sie haben normative Erwartungen“ Die Bezugsgruppen wären überrascht, wenn der Positionsträger etwas ganz anderes unternimmt als es ein Inhaber seiner Position gemeinhin tut - Sie haben antizipatorische Erwartungen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Soziale Rolle
- Soziale Position
- Kernbedeutung/Randbedeutung
- Zum Positionsbegriff
- Zum Rollenbegriff
- Die Beziehung: Soziale Rolle/soziale Position
- Von der Position zur Rolle
- Begriffliche Differenzierungen im Anschluß an das Rollenkonzept des „Homo Sociologicus“
- Paradigmen der Rollenanalyse
- Die Rollen-Theorien (Kritik)
- Die Rollentheorie von Talcott Parsons
- Das interaktionistische Rollen-Konzept (nach Mead)
- Zur symbolisch-interaktionistischen Perspektive
- Kritik
- Kritik an der strukturell-funktionalen Rollen-Theorie
- Kritik an dem interaktionistischen Rollen-Konzept
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die soziologischen Konzepte „soziale Rolle“ und „soziale Position“. Ziel ist es, die Funktionsweise sozialer Interaktion zu erklären und die dynamischen Prozesse anhand dieser statischen Begriffe zu veranschaulichen. Die Arbeit analysiert verschiedene Rollentheorien und deren Kritik, um zu verstehen, wie Interaktion trotz individueller Unterschiede und begrenzter gegenseitiger Erkennbarkeit möglich ist. Die Individualität, Sozialität und gegenseitige Abhängigkeit der Menschen bilden dabei die Grundlage der Betrachtung.
- Definition und Abgrenzung sozialer Rollen und Positionen
- Analyse der Kern- und Randbedeutung der Begriffe Rolle und Position
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Rollentheorien (Parsons, Mead)
- Kritik an strukturell-funktionalen und interaktionistischen Ansätzen
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Position, Rolle und Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit, nämlich die Funktionsweise sozialer Interaktion anhand der Begriffe „Rolle“ und „Position“ zu erklären. Sie betont die Annahme von Individualität, Sozialität und gegenseitiger Abhängigkeit der Menschen und die Einordnung des Positionsbegriffs in Organisationssysteme und des Rollenbegriffs in Interaktionssysteme.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „soziale Rolle“ als ein Bündel normativer Verhaltenserwartungen, die an Inhaber bestimmter sozialer Positionen herangetragen werden. Es erklärt die Bedeutung von Bezugsgruppen und deren Erwartungen, positive und negative Sanktionen sowie den Prozess der Internalisierung von Rollen. Der Begriff „soziale Position“ wird als dauerhafter Schnittpunkt sozialer Beziehungen definiert, wobei die Verhaltenserwartungen an den Positionsträger von Personen oder Gruppen herangetragen werden, deren Positionen strukturell auf seine Position bezogen sind.
Kernbedeutung/Randbedeutung: Dieses Kapitel analysiert den Positionsbegriff anhand von Lintons Konzept von „Rolle und Status“, welches die Einordnung des Individuums in seine Kultur durch seine Stellung in der Gesellschaft beschreibt. Der Rollenbegriff wird nach Popitz als ableitbar aus sozialer Differenzierung und Normierung beschrieben, wobei das Theater-Metapher zur Veranschaulichung herangezogen wird. Der Abschnitt diskutiert die Beziehung zwischen Rolle und Position, wobei die Schwierigkeiten einer klaren Abgrenzung der beiden Begriffe beleuchtet werden. Unterschiedliche Ansätze zur Klärung dieser Beziehung werden präsentiert, beispielsweise durch Geller, der Rollen auf Interaktionssysteme und Positionen auf organisierte Sozialsysteme bezieht.
Begriffliche Differenzierungen im Anschluß an das Rollenkonzept des „Homo Sociologicus“: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Paradigmen der Rollenanalyse. Es geht um unterschiedliche Perspektiven auf Rollen und die Herausforderungen, ein umfassendes Verständnis von Rollen zu entwickeln und zu analysieren.
Die Rollen-Theorien (Kritik): Dieses Kapitel stellt die Rollentheorie von Talcott Parsons und das interaktionistische Rollenkonzept nach Mead vor. Es beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit beiden Theorien, indem sowohl Stärken als auch Schwächen der strukturell-funktionalen und interaktionistischen Perspektiven auf soziale Rollen beleuchtet werden. Der Abschnitt zeigt die unterschiedlichen Ansätze und deren Limitationen auf.
Schlüsselwörter
Soziale Rolle, Soziale Position, Rollentheorie, Interaktion, Sozialisation, Parsons, Mead, Funktionalismus, Interaktionismus, Norm, Erwartung, Sanktion, Bezugsgruppe, Positionsträger, Soziales System, Organisationssystem, Individuation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziologische Konzepte „Soziale Rolle“ und „Soziale Position“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die soziologischen Konzepte „soziale Rolle“ und „soziale Position“. Das Hauptziel ist es, die Funktionsweise sozialer Interaktion zu erklären und die dynamischen Prozesse anhand dieser statischen Begriffe zu veranschaulichen. Die Arbeit untersucht verschiedene Rollentheorien und deren Kritik, um zu verstehen, wie Interaktion trotz individueller Unterschiede und begrenzter gegenseitiger Erkennbarkeit möglich ist. Die Individualität, Sozialität und gegenseitige Abhängigkeit der Menschen bilden die Grundlage der Betrachtung.
Wie werden „soziale Rolle“ und „soziale Position“ definiert?
„Soziale Rolle“ wird als ein Bündel normativer Verhaltenserwartungen definiert, die an Inhaber bestimmter sozialer Positionen herangetragen werden. „Soziale Position“ wird als dauerhafter Schnittpunkt sozialer Beziehungen definiert, wobei die Verhaltenserwartungen an den Positionsträger von Personen oder Gruppen herangetragen werden, deren Positionen strukturell auf seine Position bezogen sind. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten, beide Begriffe klar voneinander abzugrenzen, und präsentiert unterschiedliche Ansätze zur Klärung dieser Beziehung.
Welche Rollentheorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Rollentheorie von Talcott Parsons und das interaktionistische Rollenkonzept nach Mead. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit beiden Theorien geführt, wobei sowohl Stärken als auch Schwächen der strukturell-funktionalen und interaktionistischen Perspektiven auf soziale Rollen beleuchtet werden. Die unterschiedlichen Ansätze und deren Limitationen werden aufgezeigt.
Welche Aspekte der Kern- und Randbedeutung von Rolle und Position werden behandelt?
Die Analyse der Kern- und Randbedeutung bezieht sich auf Lintons Konzept von „Rolle und Status“ zur Einordnung des Individuums in seine Kultur. Der Rollenbegriff wird nach Popitz als ableitbar aus sozialer Differenzierung und Normierung beschrieben, wobei die Theater-Metapher zur Veranschaulichung dient. Die Beziehung zwischen Rolle und Position wird diskutiert, wobei die Schwierigkeiten einer klaren Abgrenzung beleuchtet werden. Verschiedene Ansätze zur Klärung dieser Beziehung werden präsentiert, z.B. durch Geller, der Rollen auf Interaktionssysteme und Positionen auf organisierte Sozialsysteme bezieht.
Welche Kritik an den Rollentheorien wird geübt?
Die Arbeit beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit sowohl der strukturell-funktionalen Rollen-Theorie (Parsons) als auch dem interaktionistischen Rollen-Konzept (Mead). Die Kritikpunkte werden explizit genannt und diskutiert, um die Grenzen und Schwächen der jeweiligen Ansätze aufzuzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Soziale Rolle, Soziale Position, Rollentheorie, Interaktion, Sozialisation, Parsons, Mead, Funktionalismus, Interaktionismus, Norm, Erwartung, Sanktion, Bezugsgruppe, Positionsträger, Soziales System, Organisationssystem, Individuation.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsdefinitionen, Kernbedeutung/Randbedeutung, Begriffliche Differenzierungen im Anschluss an das Rollenkonzept des „Homo Sociologicus“, Die Rollen-Theorien (Kritik), und ein Fazit (implizit in der Zusammenfassung der Kapitel enthalten). Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der sozialen Rolle und Position und deren theoretische Einordnung.
- Quote paper
- Matthias Rischer (Author), 1998, Soziale Rolle / Soziale Position, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39747