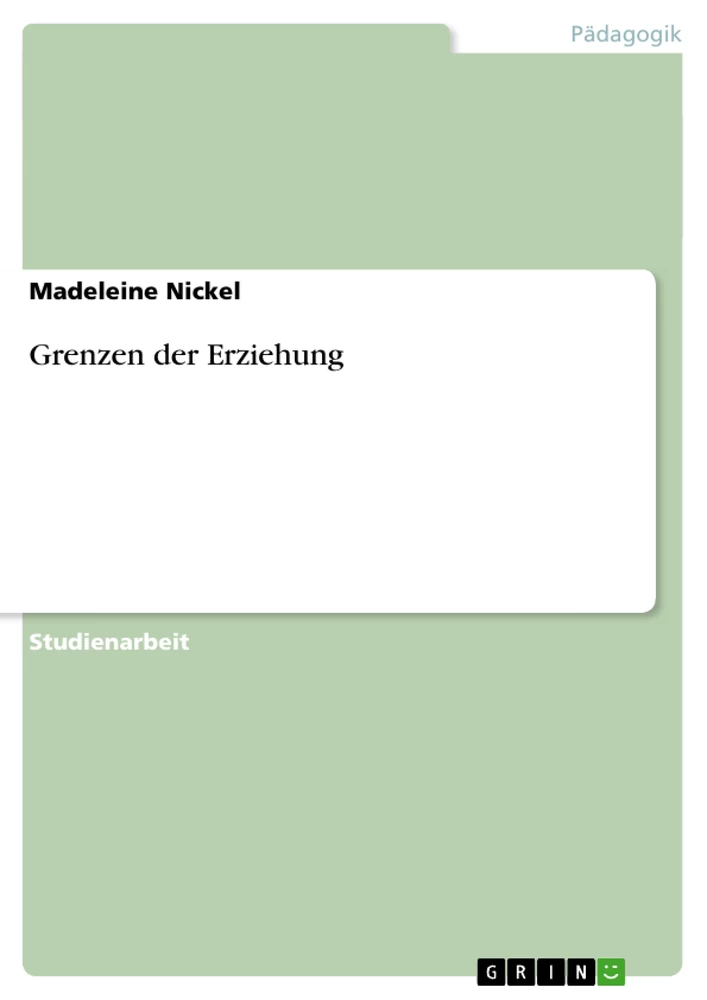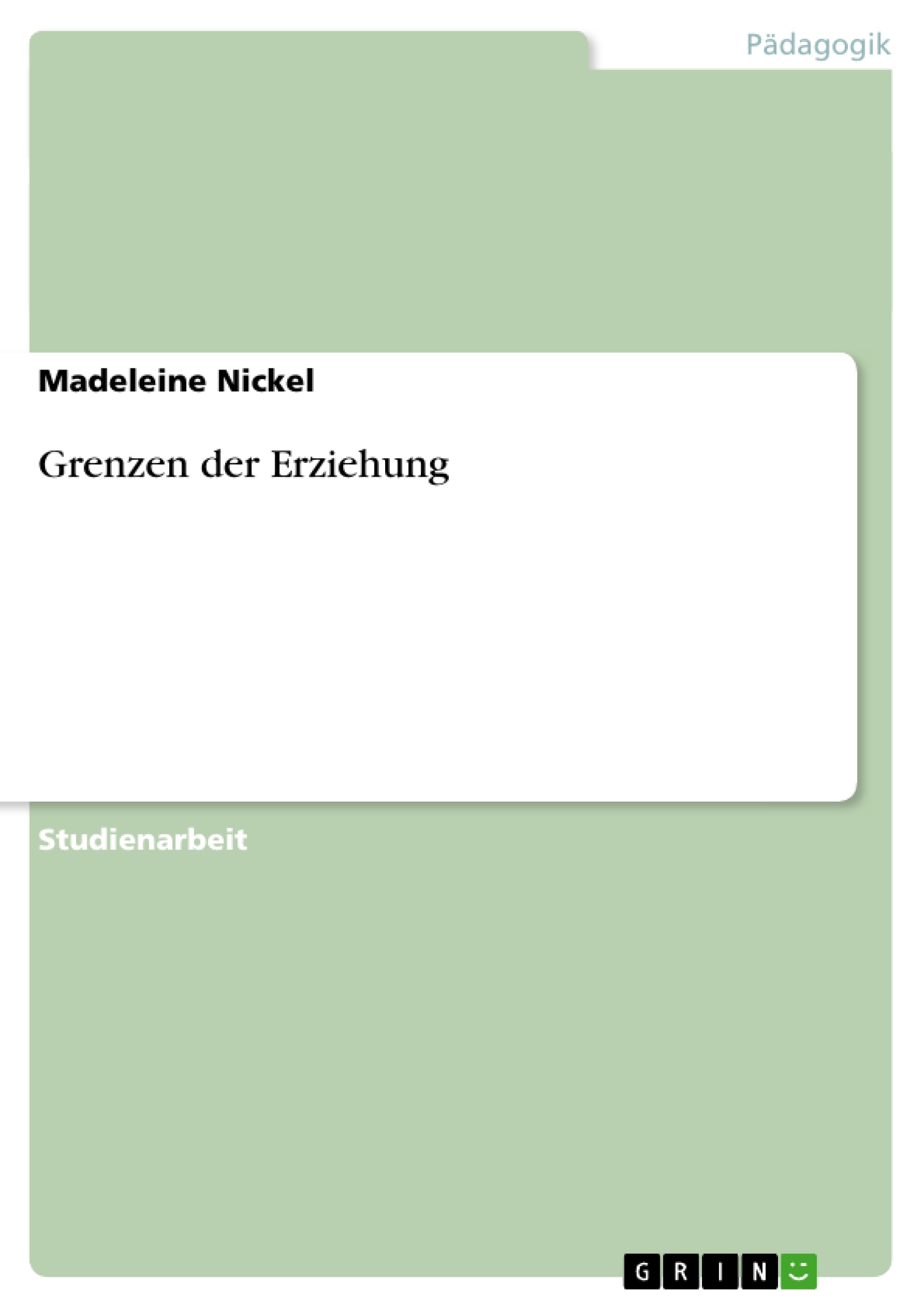Die Persönlichkeit eines jeden Menschen wird stark von der Erziehung geprägt. Denn die Aufgabe der Erziehung ist es, die Persönlichkeit des Zöglings zu entfalten und weiter zu entwickeln. Dies kann im positiven, wie auch im negativen Sinn geschehen. Für den Erziehenden sind die einzelnen Erziehungsvorgänge oft schwierig durchsetzbar. Deshalb werden bei dem Wort Erziehung bei den Menschen unterschiedliche Gefühle hervorgerufen. So entstehen bei dem Einen unbehagliche Gedanken, bei dem Anderen positive Gefühle. Es tauchen plötzlich Bilder der eigenen Kindheit auf. Der Keller, indem man eingesperrt endlose Minuten verbrachte, wenn man unartig war oder die schönen Erinnerungen, wenn man als Kind auf dem Schlitten den Berg herunter rodelte. Weil man sich seiner Gefühlsverknüpfung meistens nicht bewusst ist, gelingt es wenigen Menschen ganz unbefangen in die Erziehung einzusteigen. Man möchte nie wie die Mutter oder der Vater werden, die immer so streng waren. Aus diesem Grund führt man sich immer wieder den Satz vor Augen: „Ich werde mein Kind nie so erziehen, wie ich erzogen worden bin.“ Die negativen Erfahrungen und Erlebnisse in der eigenen Kindheit, werden dem Zögling verweigert. Die positiven Erfahrungen und Wünsche des Erziehenden werden dem Kind mit allen seinen Normen und werten vermittelt. Im Mittelpunkt der Erziehung steht der Mensch mit seinen Fragen nach sich selbst. Er versucht sein Verhalten zu begründen und sein Leben glücklich und sinnvoll zu gestalten. Aus diesem Grund wird es die Erziehung immer geben, bewusst oder unbewusst. Die Menschen streben danach Erwünschtes zu fördern und Unerwünschtes zu vermeiden. Würde es diese Unterscheidung nicht geben, so wäre eine Erziehung nicht nötig. Doch wie sollte sich der Erziehende verhalten, wenn der gewünschte Erziehungserfolg ausbleibt und sie auf ihre Grenzen stoßen?! Auf den folgenden Seiten wird ein Überblick über die Grenzen der Erziehung gegeben. Fragen wie: „Warum gibt es Grenzen?“, „Liegen sie in uns, bei uns oder haben wir sie vor uns?“, „Wer legt sie fest und wie muss man mit ihnen umgehen?“, „Können wir sie umgehen oder besitzt jeder Mensch Erziehungsgrenzen?“ werden analysiert und bearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2.1. Definition des Erziehungsbegriffs und deren Relevanz für die Grenzdiskussion
- 2.2. Wer stellt die Grenzen fest?
- 3. Die Ursachen für das Scheitern in der Erziehung
- 3.1. „Das Fernsehen ist an allem schuld!“
- 4. Grenzen des Erziehers sind Grenzen der Erziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Grenzen der Erziehung und befasst sich mit der Frage, warum Erziehungserfolge nicht immer eintreten und welche Faktoren das Scheitern beeinflussen können. Dabei wird der Erziehungsbegriff kritisch beleuchtet und die Rolle des Erziehers im Kontext der Grenzdiskussion untersucht.
- Der Erziehungsbegriff und seine Relevanz für die Grenzanalyse
- Die Ursachen für das Scheitern von Erziehung
- Die Grenzen des Erziehers und deren Einfluss auf den Erziehungsprozess
- Das Bewusstsein für die Grenzen der Erziehung und die Bedeutung von Toleranz und Relativität
- Die Rolle des Erziehers im Kontext des Scheiterns und die Notwendigkeit von Solidarität und Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung - Die Einführung stellt die Relevanz der Erziehung für die Persönlichkeitsentwicklung heraus und beleuchtet die unterschiedlichen emotionalen Reaktionen auf den Begriff „Erziehung“. Sie führt den Leser in die Thematik der Grenzdiskussion ein und stellt wichtige Fragen zum Thema, wie z. B. die Lokalisierung der Grenzen, die Festlegung und der Umgang mit ihnen.
Kapitel 2.1: Definition des Erziehungsbegriffs und deren Relevanz für die Grenzdiskussion - Dieses Kapitel beleuchtet die Definition des Erziehungsbegriffs nach Wolfgang Brezinka, der Erziehung als einen "Beeinflussungsbegriff" beschreibt, der konkrete Menschen in ihrer Entwicklung verändern soll. Es werden Beispiele für leicht und schwer beeinflussbare Verhaltensänderungen angeführt und die Relevanz des Erziehungsbegriffs für die Grenzanalyse betont.
Kapitel 2.2: Wer stellt die Grenzen fest? - Das Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wer letztendlich die Grenzen der Erziehung festlegt. Es wird argumentiert, dass sowohl der Erzieher als auch der Zögling durch ihre Erwartungen und Wünsche die Grenzen beeinflussen.
Kapitel 3: Die Ursachen für das Scheitern in der Erziehung - Dieses Kapitel analysiert die Ursachen, die zum Scheitern von Erziehung führen können. Es werden verschiedene Faktoren, wie z. B. die Überforderung des Erziehers durch ambitionierte Erziehungsziele und die Entstehung von Wunschbildern, die den realen Möglichkeiten nicht entsprechen, beleuchtet.
Kapitel 3.1: „Das Fernsehen ist an allem schuld!“ - Dieses Unterkapitel widmet sich der Frage nach der Schuldzuweisung bei Erziehungsproblemen und beleuchtet die Neigung, äußere Faktoren für das Scheitern verantwortlich zu machen. Es wird der Einfluss von Medien, wie z. B. dem Fernsehen, auf die Erziehung diskutiert.
Kapitel 4: Grenzen des Erziehers sind Grenzen der Erziehung - Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grenzen des Erziehers, die gleichzeitig die Grenzen der Erziehung darstellen. Es wird die Bedeutung des Grenzbewusstseins für den Erzieher hervorgehoben und die Notwendigkeit, Scheitern als ein mögliches und akzeptables Ergebnis des Erziehungsprozesses zu akzeptieren, betont.
Schlüsselwörter
Erziehung, Grenzdiskussion, Erziehungsbegriff, Beeinflussungsbegriff, Scheitern, Grenzüberschreitung, Toleranz, Relativität, Grenzbewusstsein, Erziehungsziele, Erfolg, Misserfolg, Schuld, Verantwortung, Medien, Einfluss, Zögling, Erzieher, Wunschbild, Realität, Pädagogik.
- Quote paper
- Madeleine Nickel (Author), 2003, Grenzen der Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39552