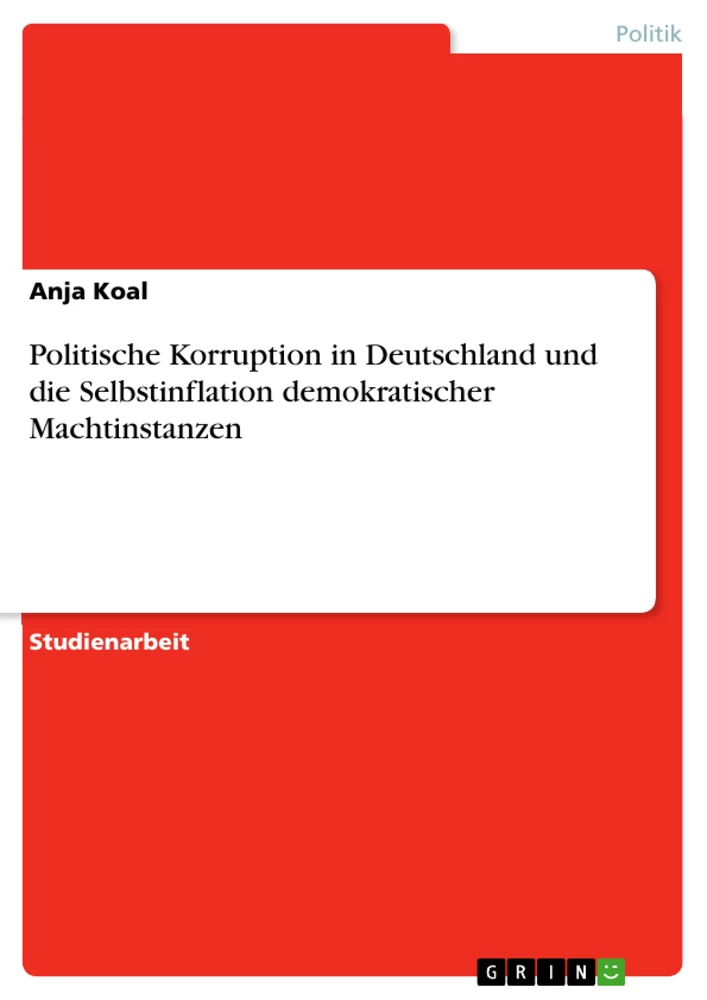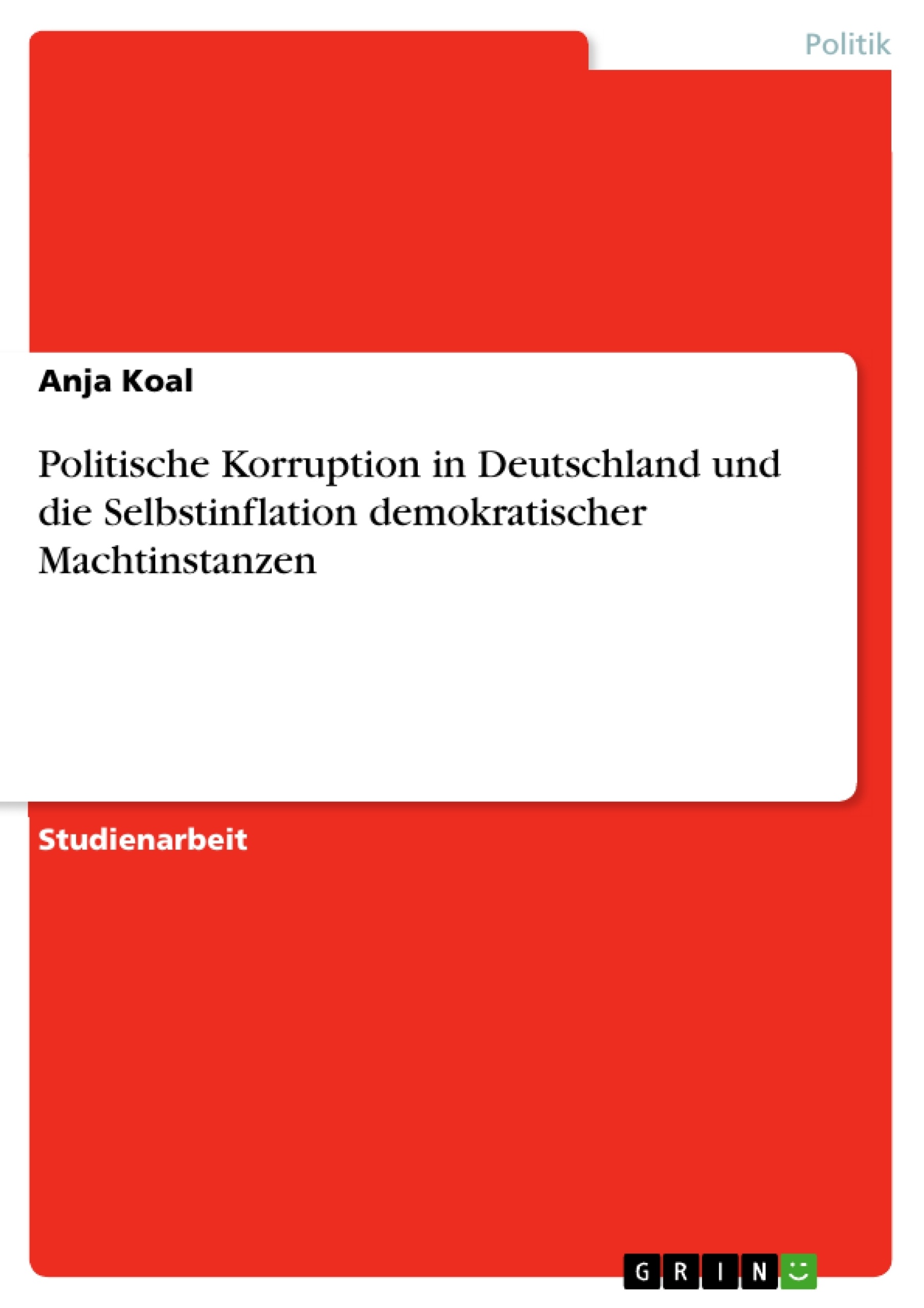[...] „Politische Korruption bezeichnet die mißbräuchliche Nutzung eines Öffentlichen Amtes zum eigenen privaten Vorteil oder zugunsten Dritter (i.d.R. zum Schaden der Allgemeinheit).“ Diese sehr geläufige Definition wird in der Mehrzahl der Literatur als Prämisse anerkannt und ebenso häufig als unvollständiger Ausgangspunkt für weitere Definitionsentfaltungen verwendet. Daraus ergibt sich eine wahre Fülle an Begriffsbestimmungen, die sehr verschiedene Standpunkte einnehmen oder auf einzelne Erscheinungsformen des Phänomens abzielen. Laut Michael Johnston (Colgate University) haben sich drei Korruptionsbegriffe herauskristallisiert: Die „Behavior-classifying definitions“ zielen auf die handlungstheoretischen Aspekte von „Missbrauch“ und abweichendem Verhalten an sich ab. Sie untersuchen die Trennung von privatem und öffentlichem Handeln hinsichtlich der Ursachen und des Vorgangs korrupter Handlungen. Der „Neoclassical Approach“ hebt dagegen eher die gesellschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen hervor, unter denen es überhaupt erst möglich wird ein Amt zu missbrauchen. Und im Grunde genommen gibt es auch „[...] drittens, die Suche nach neuen Paradigmen“. Das meint, die Herausstellung von spezifischen Werte- oder Handlungsmustern in Bezug auf Macht, Kapital und Gesellschaft, die sich permanent im Wandel befinden. Alle diese Faktoren scheinen gleichermaßen von Bedeutung zu sein. Dazu kommen verschiedene Standpunkte, die Korruption aus juristischer, politischer, wirtschaftlicher, soziologischer oder ant hropologischer Sicht betrachten und dem Begriff jeweils eine andere Konnotation beimischen. Obwohl sich die folgenden Ausführungen im speziellen auf Korruption in Deutschland beschränken werden, soll sich trotzdem ein theoretischer Rahmen öffnen, der sich auch auf andere politische und gesellschaftliche Systeme vergleichend anwenden lassen könnte, ohne alternative Wertesysteme zu übervorteilen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Korruption in Deutschland
- Indizien deuten auf Korruption
- Empirische Analysen sind begrenzt
- Das institutionsökonomische Modell
- Die Weisungshierarchie
- Der Betrug
- Der Schaden
- Das Korruptionsphantom - eine Verbindung verschiedener Ansätze
- Generalisierungsgrad der Tauschmedien
- Strukturierung von Korruptionsfällen
- Die normierende Prinzipal – Agent –Vertragspartnerschaft
- Die Norm
- Die Abweichung
- Die Parteien als Volks-Agenturen
- Korruption schafft Korruption – eine Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht politische Korruption in Deutschland. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Definition und Erklärung von Korruption zu beleuchten und anhand von Beispielen aus der deutschen Geschichte zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Schwierigkeit, politische Korruption aufzudecken und zu ahnden.
- Definition und Vielschichtigkeit des Korruptionsbegriffs
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Anreize für Korruption
- Analyse von Korruptionsfällen in Deutschland (z.B. Flick-Affäre, Parteispendenskandale)
- Schwierigkeiten bei der Aufdeckung und Ahndung von Korruption
- Theoretische Modelle zur Erklärung von Korruption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert den vielschichtigen Begriff „Korruption“ und seine unterschiedlichen Perspektiven, abhängig vom gesellschaftlichen Kontext. Sie hebt die Bedeutung der Ursachenforschung für die Bekämpfung von Korruption hervor und wählt einen theoretischen Ansatz zur Analyse politischer Vorgänge, um Vorurteile zu vermeiden. Eine gängige Definition politischer Korruption wird vorgestellt, die als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen dient.
Korruption in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die acht Tatbestände der Korruption im deutschen Strafrecht. Es wird deutlich, dass der formale Rahmen oft nicht ausreicht, um geheime Zahlungen und politische Korruptionsdelikte aufzudecken, da der Nachweis aller drei Komponenten (Geber, Nehmer, illegale Handlung) schwierig ist.
Das institutionsökonomische Modell: (Dieses Kapitel ist nur teilweise im Auszug enthalten, eine vollständige Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Das Korruptionsphantom - eine Verbindung verschiedener Ansätze: Dieses Kapitel erörtert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Korruption, einschließlich der Betrachtung gesellschaftlicher Strukturen und der Rolle von Macht, Kapital und Gesellschaft. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Normen und Abweichungen im Prinzipal-Agent-Modell und diskutiert die Rolle von Parteien als "Volks-Agenturen".
Korruption schafft Korruption – eine Zusammenfassung: (Dieses Kapitel ist im Auszug nicht vollständig enthalten, daher keine Zusammenfassung möglich.)
Schlüsselwörter
Politische Korruption, Deutschland, Institutionenökonomie, Prinzipal-Agent-Modell, Korruptionsbekämpfung, Parteispenden, Strafrecht, Empirische Forschung, Definition von Korruption, Missbrauch von öffentlichem Amt.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse Politischer Korruption in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert politische Korruption in Deutschland. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zur Definition und Erklärung von Korruption und untersucht anhand von Beispielen aus der deutschen Geschichte die Schwierigkeiten bei der Aufdeckung und Ahndung solcher Delikte.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Definition und Vielschichtigkeit des Korruptionsbegriffs, institutionelle Rahmenbedingungen und Anreize für Korruption, Analyse von Korruptionsfällen (z.B. Flick-Affäre, Parteispendenskandale), Schwierigkeiten bei der Aufdeckung und Ahndung von Korruption sowie theoretische Modelle zur Erklärung von Korruption, insbesondere das institutionsökonomische Modell und das Prinzipal-Agent-Modell. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von Parteien als "Volks-Agenturen".
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einleitung (Definition von Korruption und Forschungsansatz), Korruption in Deutschland (Beschreibung der Tatbestände im deutschen Strafrecht und Schwierigkeiten des Nachweises), Das institutionsökonomische Modell (Analyse institutioneller Rahmenbedingungen), Das Korruptionsphantom - eine Verbindung verschiedener Ansätze (theoretische Erklärungsansätze, Prinzipal-Agent-Modell, Rolle der Parteien), und Korruption schafft Korruption – eine Zusammenfassung (Zusammenfassende Schlussfolgerungen).
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das institutionsökonomische Modell und das Prinzipal-Agent-Modell, um Korruption zu erklären. Es wird der Zusammenhang zwischen Normen und Abweichungen im Prinzipal-Agent-Modell erörtert.
Welche Beispiele für Korruptionsfälle werden genannt?
Der Text erwähnt explizit die Flick-Affäre und Parteispendenskandale als Beispiele für Korruptionsfälle in Deutschland.
Welche Schwierigkeiten bei der Aufdeckung und Ahndung von Korruption werden hervorgehoben?
Der Text betont die Schwierigkeit, alle drei Komponenten eines Korruptionsdelikts (Geber, Nehmer, illegale Handlung) nachzuweisen, was die Aufdeckung und Ahndung von Korruption erschwert. Der formale Rahmen des deutschen Strafrechts wird als oft unzureichend beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Politische Korruption, Deutschland, Institutionenökonomie, Prinzipal-Agent-Modell, Korruptionsbekämpfung, Parteispenden, Strafrecht, Empirische Forschung, Definition von Korruption, Missbrauch von öffentlichem Amt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Ansätze zur Definition und Erklärung von Korruption zu beleuchten und anhand von Beispielen aus der deutschen Geschichte zu analysieren, mit einem Fokus auf die Schwierigkeiten bei der Aufdeckung und Ahndung politischer Korruption.
- Arbeit zitieren
- Anja Koal (Autor:in), 2005, Politische Korruption in Deutschland und die Selbstinflation demokratischer Machtinstanzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39388